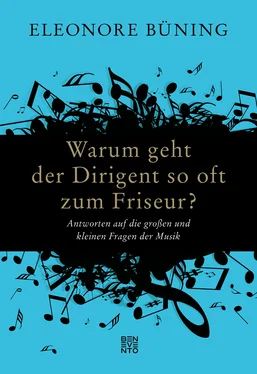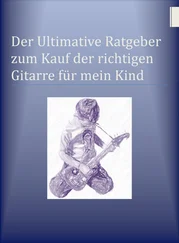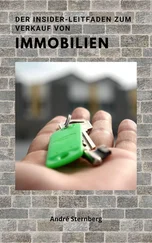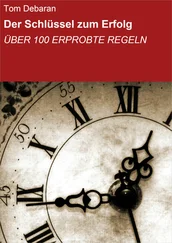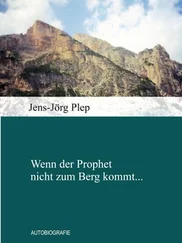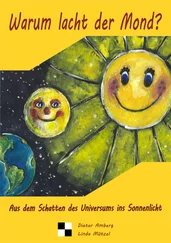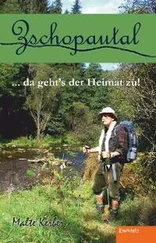Sir Simon Rattle, der dieser Tage seine Serie von Abschiedskonzerten mit den Berliner Philharmonikern beginnt, unter anderem mit Mahlers Sechster, die, wie alle Mahlersymphonien, einige heikle Hornsoli parat hält, vergleicht die Hornspieler statt mit Pferden mit Stuntmen. Man dürfe ihnen auf keinen Fall zuschauen in dem Moment, in dem sie möglicherweise in den Tod fallen: »Never eyeball a hornplayer«. Allerdings hat der Hornist im Live-Konzert, anders als der Stuntman am Set, keine zweite Chance.
Robert Schumann, der, als dem Waldhorn endlich Ventile gewachsen waren, von den neuen chromatischromantischen Möglichkeiten dieses Instruments so hellauf begeistert war, dass er »etwas ganz curioses« komponierte, nämlich ein Konzertstück für vier Ventilhörner und Orchester, erklärte das Horn zur »Seele des Orchesters«. Da ist etwas dran. Denn das Horn ist, ob mit oder ohne Ventil, das Instrument mit den meisten Obertönen. Es kann sich, je nach Register, mit den weichen Holzbläsern verbünden oder auch mit dem schmetternden Rest des Blechs, bei dem es ebenfalls ab und zu mal kiekst. Aber das interessiert niemanden. Nur dem Horn nimmt man es übel.
Nicht überall. Nicht in Wien, zum Beispiel. Kiekser sind zwar grundsätzlich überall unvermeidlich, da von zu vielen nicht kontrollierbaren Faktoren abhängig. Zumal in der hohen Lage, wo die Naturtöne dichter beieinander liegen, reichen optimaler Lippenmuskeldruck und Atemkraft zur Punktlandung nicht immer aus. Die häufigsten, herrlichsten Hornkiekser gibt es, wie unlängst ein Schweizer Kollege nicht ohne Neid feststellte, bei den stolzen Wiener Philharmonikern zu hören, da kommt es vor, dass ganze Konzerte tipptopp verkiekst werden, was daran liegt, dass das Spiel des sogenannten Wiener Horns hier zur Pflicht gehört, seit 1830. Es hat eine noch engere Mensur als üblich, folglich noch mehr Teiltöne. Außerdem hat das Wiener Horn Doppelpumpenventile, was fließenden Übergängen im Legatospiel zugute kommt. Gern zahlt man mit ein paar Kieksern für so viel Schönheit. Selbst die Kiekser sind traumhaft schön.
Das Horn wurde seiner souveränen Unvollkommenheit halber zum Lieblingsinstrument auch der literarischen Romantik: dank der Vielfalt der Farben, Klänge, Rollen und Register, seiner Herkunft aus dem Wald, der Sehnsuchtsrufe in die Ferne, der Echos aus der Vergangenheit, des Archaischen heller Jagdfanfaren, Wielands Ritt ins alte romantische Land, Eichendorffs Waldesgespräch, heller Sommernachtsträume sowie des geheimnisvoll weichen Dunkels tiefer Lagen, die von Trauer und Erinnerung wissen, aber auch Unheimliches ankündigen, Drohungen, Doppelgänger: »Wohl irrt das Waldhorn her und hin./ Oh flieh! Du weißt nicht, wer ich bin.«
Unter diesen Umständen muss man zusammenhalten. »Hornisten sind selten Einzelgänger«, sagt Stephan Dohr, Solohornist der Berliner Philharmoniker. »Wir treten ja immer mindestens zu zweit auf, bei Mozart und Haydn, und bei späteren Komponisten immer zu viert, mindestens, dann auch mal zu sechst oder acht, das ist dann schon fast eine Party.« Die jüngste Feier dieser Art fand am Donnerstag im Münchner Herkulessaal statt, wo ein Konzertstück für acht Hornisten und Orchester von Helmut Lachenmann zur Uraufführung kam, es soll ein rauschendes Fest gewesen sein.
10. Juni 2018
7
Warum ist ausgerechnet die klassische Musik so klassisch geworden?
Der Begriff »Klassik« kann vieles bedeuten. Ihnen, werter Leser, der diese kluge Frage stellt, scheint das klar zu sein. Andere Leser, die vielleicht auch gern ab und zu klassische Musik hören, sich nur bis jetzt noch keine Gedanken gemacht haben darüber, warum sie heißt, wie sie heißt, werden vielleicht denken, dass Ihre Frage redundant und ein bisschen dumm ist. Es ist darum, denke ich, sinnvoll, zunächst die Begrifflichkeiten zu klären.
»Klassik« ist leider kein Homonym (vulgo: »Teekesselchen«). Vielmehr sind die diversen Bedeutungen enger oder weitläufiger miteinander verwandt. Außerdem spiegelt sich in dem Verständnis dessen, was »klassische Musik« ist oder sein sollte, die europäische Geistesgeschichte der letzten dreihundert Jahre mit ihren politischen, sozialen und ökonomischen Implikationen, als da sind Historismus, Nationalismus, Idealismus, Industrialisierung und technischer Fortschritt, um nur einige zu nennen. Daraus folgt:
1.)»Klassik« bezeichnet die Kunst und Kultur der griechisch-römischen Antike. (Epochenbegriff)
2.)»Klassik« bezeichnet jede Kunst- und Kulturleistung oder Kulturepoche, von der man annimmt, dass sie ähnlich vollkommen sei wie die unter 1.) genannte. (Wertungsbegriff)
3.)»Klassik« bezeichnet die europäische Kunstmusik, die zwischen etwa 1750 und 1850 vorwiegend, wenn auch nicht ausschließlich, in Wien komponiert worden ist. (Stilbegriff)
4.)»Klassik« meint jede komponierte Kunstmusik, die seit dem Ende der Gregorianik entstanden ist, mit Unterrubriken wie Frühe Mehrstimmigkeit, Renaissancemusik, Frühbarock, Spätbarock, Vor- und Frühklassik, Wiener Klassik, Romantik, Spätromantik, Impressionismus, Dodekaphonie, Neoklassizismus, Serialismus, Neue Einfachheit, Minimalismus u.v.a.m. (ausgeleierter Stilbegriff, Alltagsbegriff)
5.)»Klassik« bezeichnet jede Musik ohne Beat und Verstärker, die entspannt, beruhigt und nicht länger als drei Minuten dauert. (KlassikRadio-Definition)
6.)»Klassik« bezeichnet E-Musik, i. e. »ernste Musik« im Unterschied zur U-Musik, i. e. »Unterhaltungsmusik«. (ARD-Abteilungsleiter-Definition)
7.)»Klassik« kann im Sinne von 2.) auch Musik klassifizieren, die nicht zur europäischen Kunstmusik gehört; man spricht, zum Beispiel, vom »klassischen Jazz« oder »klassisch chinesischer Musik«. (Umgangssprachlich)
Nun zu Ihrer Frage. Die beste Antwort lautet noch immer: Das erklärt sich von selbst. Hören Sie sich ein Klaviertrio von Beethoven oder eine Symphonie von Haydn oder ein Streichquartett von Schubert oder Schumanns Dichterliebe oder Mozarts Gran Partita an, live im Konzertsaal (nicht aus der Tonkonserve; Sie beurteilen ja auch einen Monet nicht nach der Reproduktion im Katalog). Sie werden wissen, warum diese »klassische Musik« (im Sinne des Stilbegriffs (3.)) so »klassisch« wurde (im Sinne des Wertungsbegriffs (2.)).
Diese Musiken sind vollkommen. Sie sind zeitlos. Sie greifen uns Menschen ins Gemüt. Sie können uns, bei jeder neuen Begegnung, auf immer wieder andere Weise Auskunft darüber geben, wer wir sind oder, besser gesagt, wer wir sein könnten. Das ist die vielleicht wichtigste Aufgabe klassischer Kunst, im Sinne von 1.) und 2.). Trifft aber natürlich auch auf viele andere Musikwerke zu, auch solche, die im Sinne des ausgeleierten Stilbegriffs (4.) »klassisch« zu nennen sind.
Zwischen etwa 1750 und 1850 sind so viele vollkommene und geniale Werke entstanden im Abendland wie nie zuvor oder danach. Warum es in einer so kurzen Zeitspanne auf so überschaubarem Raum zu diesem Output kommen konnte, weiß ich nicht. Es gibt aber jemanden, der es in nur sechs Minuten zu erklären versuchte: Leonard Bernstein, in seinen Norton-Lectures, in Harvard, 1973. Er selbst hat behauptet, es seien sogar nur zwei Minuten gewesen. Der YouTube-Beitrag dazu heißt: The greatest 5 min. in music education.
Bernstein führt am Klavier vor, wie sich das abendländische Harmoniesystem aus den Obertönen ableitet, parallel zur Entwicklung von der Einstimmigkeit zur Tonalität, bis hin zur diatonischen und chromatischen Harmonik. Wenn man ihm zugehört hat, denkt man, für ein paar Minuten wenigstens, man habe es kapiert: Wie bei einem Komposthaufen akkumulierte sich die Substanz, Schicht um Schicht. Eines Tages, als Bach noch ein kleiner Junge war, schlug Quantität um in Qualität. Zack. Aber das ist nur so eine Idee, nichts weiter.
23. September 2018
Читать дальше