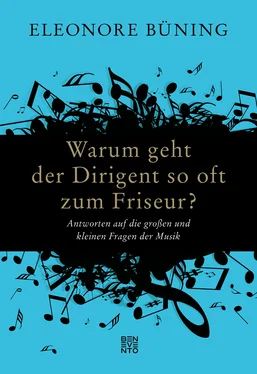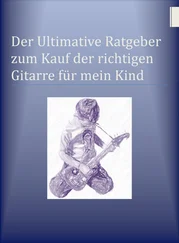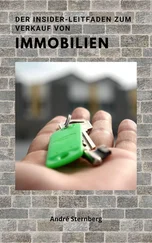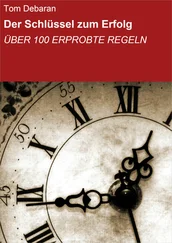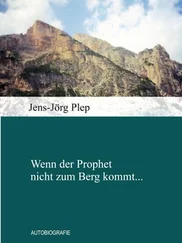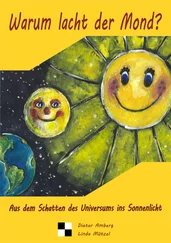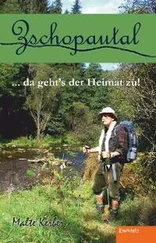8
Was ist ein Meisterwerk?
Bachs Matthäuspassion. Stockhausens Gruppen. Die sieben letzten Worte von Haydn in der Quartettfassung. What a Wonderful World. White Rabbit. Figaros Hochzeit. Don Giovanni. Lear von Reimann. Dichterliebe. Winterreise. Müllerin. Das Italienische Liederbuch. Lieder eines fahrenden Gesellen. Die Sommernachtstraum-Musik von Mendelssohn. Schumanns Violinkonzert. Am Fenster von City. Different Trains. Die Metamorphosen von Richard Strauss. Die Harzreise von Rihm. Tutuguri. Princess Crocodile von Gry. Master of Puppets. Waldszenen und Kinderszenen von Schumann. Und: Kreisleriana. Weberns vier Stücke op. 7. Nonos Prometeo. Germania von DJ Hell. Die Gran Partita KV 361, außerdem sämtliche Mozartschen Klavierkonzerte von KV 271 aufwärts und das Klarinettenquintett KV 581. Die fünf Klavierkonzerte von Beethoven, seine zweiunddreißig Klaviersonaten plus die drei Kurfürstensonaten, die sechzehn Streichquartette und die Streichtrios, ganz besonders op. 8. Außerdem Beethovens Symphonien Nr. 1–8. Nachtstücke und Arien von Henze. An der schönen blauen Donau. Moon River. Starry Starry Night (Vincent). Paint It Black. La Valse von Ravel. Purcells In-nomine-Fantasien, Bartóks Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta. Mendelssohns Lieder ohne Worte. Verdis Requiem. Tschaikowskys Klavierkonzerte. Chopins Nocturnes. Die Psalmen von Lili Boulanger. No Woman No Cry. Chattanooga choo choo. Schuberts Moments Musicaux und Impromptus. Seine Tänze. Sowieso eigentlich alles von Schubert. Das Doppelkonzert a-moll BWV 1043, außerdem Goldbergvariationen, Wohltemperiertes Klavier, alle Bachkantaten, alle Bachkonzerte, die Johannes-Passion BWV 245; auch von Bach ohne Ausnahme alles. The Winner Takes It All. All along the watchtower. La Petite Messe solennelle. Madama Butterfly. Cosí fan tutte. Des pas sur la neige von Debussy. La Mer. Pelléas et Mélisande. Meyerbeers Hugenotten. Mahlers Erste. Bruckners Dritte. Tristan und Isolde. Die dritte Sonate von Galina Ustwolskaya. Jag Älskar Sverige. Keine Macht für Niemand. Die Zweite von Sibelius. Rach 3. Die Freischütz-Ouvertüre. Egmontmusik. Die Cellosonaten von Brahms. The People United Will Never Be Defeated von Rzewski. Riders On The Storm. Das Trio op. 11 von Fanny Hensel. Der Rosenkavalier. Imagine. So, das sollte fürs Erste reichen.
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch habe ich meine Auswahl musikalischer Meisterwerke streng subjektiv getroffen. Willkürlich ist sie deshalb noch lange nicht. Ob ein Werk zum Meisterwerk taugt, darüber entscheidet nicht der individuelle Geschmack, es gibt dafür ein paar Messlatten, alte und neue. Zum Beispiel: Kein Meisterwerk gleicht dem anderen. Jedes ist einzigartig und unwiederholbar, überlebt aber trotzdem auch noch die mieseste Coverversion und alle Moden, unabhängig von Bearbeitern oder Interpreten.
Was beweist, dass Gertrude Stein auf dem Holzweg war, als sie 1936 die Frage »What are masterpieces?« mit jener anderen Frage kombinieren zu müssen glaubte: »And why are there so few of them?« Letzteres mochte Mitte der Dreißiger noch als Provokation im Bereich der bildenden schönen Künste für irgendetwas nützlich gewesen sein. In der Musik indes gab es damals bereits eine Fülle von Meisterwerken, die seither laufend weiter wuchs, wobei eines das andere in den Schatten stellte, auch Enzyklopädien, Ranglisten und Sammeleditionen von Meisterwerken entworfen wurden dergestalt, dass dieser handfeste alte Begriff, wie er aus den Zünften in die Ästhetik hinübergewachsen war, ausgehöhlt und zu einer Floskel wurde, von der Kritiker heute gerne Gebrauch machen, wenn sie einen Komponisten mal so richtig ärgern wollen.
Sie loben ihn dann und nennen ihn: Maestro. Schlimmes Wort! »Nicht Meister, nein!«, ruft Walther von Stolzing in den Meistersingern. Richard Wagner, der sich persönlich zwar ganz gern von seiner Entourage zu Tode loben ließ, widmete dem Problem am Ende seines Lebens diese dreiaktige, abendfüllende Künstleroper, in der die alten Meister am Ende ihre Messlatten wegwerfen und das Knie beugen vor einem jungen, der macht, was er will. Spätestens seither erklärt sich jedes Meisterwerk von selbst. Immerhin, das hat Gertrude Stein auf den Punkt gebracht: Ein Meisterwerk ist ein Meisterwerk ist ein Meisterwerk. Basta.
3. April 2016
9
Sind Wagners Meistersinger antisemitisch?
Ja. So, wie die Zauberflöte rassistisch ist, die Verkaufte Braut sexistisch, der Nabucco patriotisch und Boris Godunow nationalistisch. Nachweisbar in den Textbüchern dieser Opern. Ob es aber auch Spuren von Antisemitismus und Rassismus in der Musik gibt? Hm.
Ein Lackmuspapier zu dieser Frage liefert uns der Komponist Richard Wagner alle Sommer wieder um den 25. Juli herum. Das Bayreuther Mediengetöse pflegt allemal schon in der Probenzeit zu beginnen, so ab Mai. Wenn Christian Thielemann, der amtierende Musikdirektor der Richard-Wagner-Festspiele, dann gebetsmühlenartig entnervt immer mal wieder darauf hinweist, dass ein C-Dur- oder ein cis-moll-Akkord keine politische Aussage habe, so zeigt dies nicht nur die Häufigkeit an, mit der ihm die Antisemitismusfrage gestellt wird; es indiziert auch ihre Unbeantwortbarkeit und eine gewisse Irrationalität des Hypes. Längst werden überall anderswo auf der Welt die Werke Wagners aufgeführt, oftmals besser inszeniert und gesungen als im fränkischen Familienbetrieb. (By the way: Voriges Jahr gab es in Bayreuth eine Neuinszenierung des Parsifal, da haben Sie, verehrte Leser, an dieser Stelle nachgefragt, wie antisemitisch wohl der Parsifal sei. Ich habe jetzt schon mal Ihre Frage, was antisemitisch am Tannhäuser sein könnte, für Juli 2018 in meinen Kalender eingetragen.)
Richard Wagner war bekennender Antisemit, wie viele Künstler seiner Zeit. Jens Malte Fischer, der eine Dokumentation zu Wagners Pamphlet über Das Judentum in der Musik herausgebracht hat, die in jeder deutschen Hausbibliothek stehen sollte, spricht von einem »kulturellen Code des Antisemitismus im 19. Jahrhundert«. Was nichts entschuldigt. Aber doch ein paar Details ausleuchtet, die dem Blick zurück, post Holocaust, grauenvoll verstellt sind. Fischer zeigt, wie der Antisemitismus für Wagner zu einer »lebensbegleitenden Obsession« wurde. Er ist sich sicher, dass diese Obsession bis in die Werke hinein verfolgt werden kann, bis in die Noten. Allerdings sei sie camoufliert, versteckt und nur aus dem Kontext ersichtlich. Zum Beispiel: Die Meistersinger sind eine komische Oper. Aber worüber Wagners Publikum damals selbstverständlich lachte, das erkennen wir heute nicht einmal mehr als Witz. Viele Witzigkeiten wirken unheimlich. Sie sind »heuchlerisch, tückisch, infam und obendrein noch chauvinistisch«, so sagte es einmal Marcel Reich-Ranicki. Und weiter: »Es ist schon ein abstoßendes Werk. Nur muss ich noch erklären, warum ich gerade für diese Oper eine Schwäche habe, ja, warum ich sie liebe …« Und redete sich dann heraus, auf die schöne Musik.
Wie es schon Thomas Mann getan hat. Und viele andere mehr. Ach ja, ein schlimmer Text! Unerträglich! Doch die Musik, dieses selige Morgentraumdeutweise-Quintett im dritten Akt: Einfach himmlisch. An dieser Stelle kommen wir nicht weiter. Auch Fischer nicht. Auch Barrie Kosky nicht, der das Werk jetzt in Bayreuth neu inszeniert und in die Privatsphäre von Haus Wahnfried verlegt, wo Wagner Witze macht auf Kosten seines »Hausjuden«, Hermann Levi.
Fast alle Witze in den Meistersingern gehen auf Kosten des Nürnberger »Hausjuden« Sixtius Beckmesser. Im zweiten Prosaentwurf 1861/62 hatte Wagner diese Figur umbenannt in Veit Hanslich, um den Musikkritiker Eduard Hanslick zu ärgern, den er irrtümlich für einen Juden hielt. Im zweiten Aufzug der Oper löst Hanslich-Beckmesser mit einem grauenvoll falsch betonten, französizierenden Ziergesang die berühmte Prügelfuge der Johannisnacht aus. Nach und nach, mit Dominoeffekt, werden die Nürnberger Bürger wach von dem Lärm in der Gasse, sie stürzen im Nachthemd aus den Häusern und schlagen sich gegenseitig grün und blau. Grundlos, haltlos. Als der Spuk mit einem Glockenschlag endigt, haben sie Beckmesser aus der Gemeinschaft hinausgeprügelt, und der ist daran selbst schuld, hat das Pogrom verursacht, vielleicht gar herbeigesehnt, in seinem von Wagner-Sachs liebevoll-infam vorgeführten, ahasvermäßigen Todestrieb.
Читать дальше