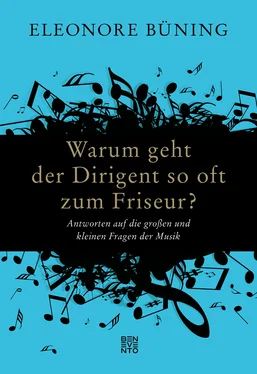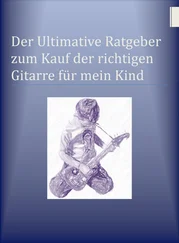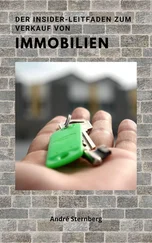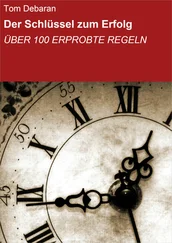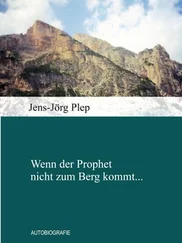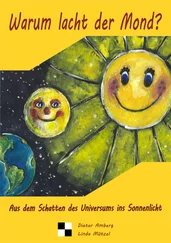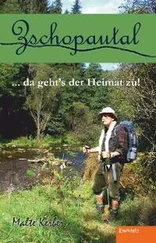Die ersten drei oder vier Fragen kamen damals direkt aus der Redaktion. Danach hat sich ein Pool aus Leserfragen gebildet, gestellt und gemailt von allen möglichen Opern- und Konzertgängern, aber auch von Pianisten, Sängern, Freunden und Kollegen, in Pausengesprächen und Probenpausen. Dieser Pool wird nicht kleiner, egal, wie viele Fragen ich herausfische. Beunruhigend, aber schön. Es gibt Fragen, die, während ich versuche, sie zu beantworten, ganz von allein umkippen in eine ganz andere Frage. Auch hat der Fragenpool mich gelehrt, dass ich über Fragen, die mich nicht interessieren, überhaupt nicht schreiben kann. Das gibt Schiffbruch. Totale Blockade. Alles schon vorgekommen.
Und noch etwas: Weil die in diesem Buch abgedruckten Kolumnen zuerst in einer Zeitung standen, sind sie nicht zeitlos. Einige beziehen sich auf eine aktuelle Debatte, die sich inzwischen erledigt hat. Oder auch nicht. Das können Sie, wenn Sie wollen, jeweils am Datum ablesen. Es kommt außerdem vor, dass eine Frage wie die Fortsetzung einer Antwort auf eine andere Frage wirkt. Und es gibt, das habe ich erst beim letzten Redigat gemerkt, so etwas wie zufällige Leitmotive, die von einer Antwort in die andere mäandern, bei Fragen, die gar nichts miteinander zu tun haben. Sie können dieses Büchlein also von vorn nach hinten lesen oder von hinten nach vorn oder auch mittendrin anfangen. Das spielt keine Rolle. Sie können auch jederzeit wieder aufhören. Viel Spaß dabei.
1
Darf ich im Konzert einschlafen?
Selbstverständlich. Wo sonst? Mehr als die Hälfte der Menschen in der westlichen Welt leidet unter Schlafstörungen, Tendenz steigend. Eine Volkskrankheit. Wir leben, so nennt es der Schlafexperte Peter Spork, in einer »chronisch unausgeschlafenen Gesellschaft«, was extrem ungesund ist, für jeden Einzelnen, aber auch für Wirtschaft und Politik. Zurückzuführen ist dies auf die Erfindung der Elektrizität im neunzehnten Jahrhundert, was die Arbeitswelt veränderte, inzwischen aber auch die Tierwelt tangiert: Selbst die Amseln und Füchse in der Großstadt sind akut schlafgestört. Das nur nebenbei.
Die gleichfalls aus dem vorvorigen Jahrhundert überlieferte klassische Konzertform stellt eine archaisch-ritualisierte, vorindustrielle Situation her, wie geschaffen für die erste Einschlafphase: Eine Gruppe/Sippe trifft sich zu kontemplativem Nichtstun im Schutze einer abgedunkelten Höhle. Dabei wird, wohl nicht zufällig, episch-ausgedehnten Symphonien und lyrischen Sonaten, anders als rhythmusgeprägten Popmusiktiteln, eine beruhigende, wenn nicht sedierende Wirkung zugeschrieben. Also: Schlafen Sie! Der Musik macht das nichts aus. Die Musiker spielen eh weiter. Wenn Sie aufwachen, spielen sie, mit etwas Glück, wunderbarerweise immer noch. Allerdings sollten Sie nicht in den Tiefschlaf (»Delta-Phase«) und Ihrer Sitznachbarin auf den Schoß sinken. Auch Schnarchen, Schlafwandeln und dergleichen sind unerwünscht.
Das gilt gleichermaßen für den qualifizierten Theater- und Kinoschlaf. Aber es gilt nicht daheim für das Herdfeuer der Moderne, den Fernseher: Hier kann jeder nach Lust und Laune seine fünf Schlafphasen durchwandern, mit und ohne Nebengeräusch und auch mehrmals hintereinander, bis zum Morgengrauen. Noch gibt es gebührenpflichtige Schlafsender, die nicht von selbst abschalten, anders als beispielsweise, aus Kostengründen, Netflix und Co. Noch immer schauen viele beim individuellen Einschlafritual in ein Buch oder in die Zeitung von gestern. Und einige wenige beherrschen die Kulturtechnik des Konferenzschlafs.
Letzterer ist offenen Auges auszuführen, kurz vor Eintritt in die sogenannte »Alpha-Phase« der Schlafkurve, die auch zuständig ist für den Sekundenschlaf am Steuer. Das Erstaunlichste am Konferenzschlaf aber, der wiederum in aller Öffentlichkeit ausgeübt wird, ist, dass er in der Regel folgenlos bleibt.
Wieso fährt der Sekundenschläfer an die Leitplanke, aber der Konferenzschläfer wacht im richtigen Moment auf und sagt genau den Satz, auf den alle gewartet haben? Das Gehirn arbeitet weiter im Schlaf, so viel ist bekannt. Aber es arbeitet quasi auf eigene Rechnung. Wie überhaupt eine der interessantesten, noch ungelösten Fragen in der Schlafforschung lautet: Für wen schlafen wir eigentlich? Und wie viel kriegt der Schläfer noch mit von dem Schlafmittel, das ihn einschläferte? Im Falle des Konzertschläfers ist festzuhalten: Er kriegt viel mit. Manchmal mehr als die Wachenden. Denn das unbewusste Hören ist dem kognitiv gesteuerten, womöglich gar von einer Taschenpartitur auf den Knien unterstützten allemal hundertfach überlegen.
»Unbewusst« bedeutet freilich nicht »unwissend«. Es geht, ganz im Gegenteil, um einen Zustand oder vielmehr eine Haltung, einen momentweise offenen Durchgang: »Man gibt sich hin, man gibt sich auf, man lässt sich fallen« – so sagte es einmal der Filmkritiker Michael Althen, dem auch das schöne Zitat zugeschrieben wird: »Im Kino schlafen heißt dem Film vertrauen«. Andere Quellen nennen Jean-Luc Godard als Urheber dieses Satzes, der in Wahrheit aus einem Liebesfilm von Rudolf Thome aus den Achtzigerjahren stammt, in dem es noch Zigarettenautomaten gab und Hanns Zischler im Kino einschlief. Drei ungleiche Söhne hat Hypnos, der Gott des Schlafes, sie heißen Morpheus (Gestalt), Phobetor (Schrecken) und Phantasos (Einbildung). Er bringt sie alle drei mit, zum dritten Akt von Jean-Baptiste Lullys Oper Atys, damit sie gemeinsam in Terzen die allerherrlichste Einschlafmusik singen, die je komponiert worden ist. Der Fehler passiert dann erst später, beim Aufwachen.
27. Oktober 2019
2
Warum heißt die Ukulele Ukulele?
Zu dieser berechtigten Frage gibt es glücklicherweise gleich zwei Antworten, eine lexikalisch-mythologisch-wikipedische (siehe unten) und eine logisch-musikalisch-onomatopoetische. Sie haben die Wahl! Zunächst: Die Ukulele heißt, wie sie klingt. Nämlich ulkig. Der Klang einer Ukulele kann, je nach Größe, Holzsorte und Besaitung, mehr oder weniger niedlich oder nervtötend ausfallen, stupsnäsig oder ehrlich und flach, auf jeden Fall ist er immer liebens- und beschützenswert. Und auch ein bisschen straßenkötermäßig dreist, wie kleine Mädchen manchmal vorgeben, zu sein.
Wer könnte einer Ukulele etwas zuleide tun? Man muss sie einfach gernhaben! Hat nur vier Saiten, passt in jedes Handgepäck und beansprucht für C-Dur und für a-moll jeweils nur einen Finger, was jedes Sugarbaby im Handumdrehen erlernen und womit es sich dann bei einigen Herzensliedern schon ganz famos selbst begleiten kann; ja, wenn ihm jemand dann auch noch F-Dur (zwei Finger) oder sogar G-Dur und den Septakkord auf E (jeweils drei Finger) gezeigt hat, kann Sugar fortan jeden beliebigen Song der Weltliteratur performen, vom Brunnen vor dem Tore bis zur Bridge Over Troubled Water. Letztlich hat der Siegeszug der Ukulele dem alten hausmusikalischen Brauch des Selbersingens, der im Zeitalter technischer Reproduzierbarkeit schon fast verloren schien, wieder mächtig Auftrieb gegeben. Die Ukulele ist also ein Geschenk der Götter. Man sollte jedem Neugeborenen eine mit in die Wiege legen.
Auf Wikipedia indes wird verbreitet, dass die Ukulele auch ein Geburtsdatum besitzt, nämlich den 23. August 1879, jenen Tag, an dem die Ravenscrag in den Hafen von Honolulu segelte, mit vierhundertneunzehn portugiesischen Einwanderern an Bord, darunter etliche namentlich bekannte Musiker, Manuel Nunes, José do Espirito Santo, Augusto Dias und João Fernandes. Sie importierten allerhand europäische Zupfinstrumente, was die Bevölkerung von Hawaii so beeindruckte, dass sie sofort ein kleines hawaiisches Zupfinstrument (nach-) baute und es »Ukulele« taufte. Was wiederum, in der Landessprache, »hüpfender Floh« bedeutet.
Wieder andere Quellen berichten, dass »uku« auf Hawaiisch so viel wie »Geschenk« heißt und »lele« so viel wie »kommen«, aber auch, dass die namensgebende Patentante des Instruments die Ukulele spielende Schwester von König Lili’uokalani gewesen sei. Aus alledem kann man schlussfolgern, dass in den Ohren der Hawaiier das Wort »Ukulele« nicht halb so onomatopoetisch klingen könnte wie in den unsrigen, ja, vielleicht finden sie ihrerseits eher Klang und Name von »Harfe« oder »Hammerflügel« ulkig.
Читать дальше