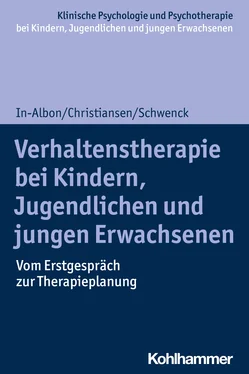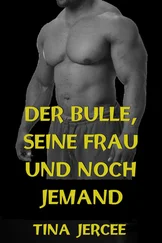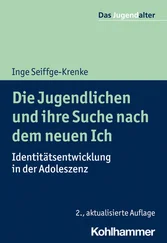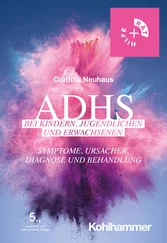Die ersten Konditionierungen fanden mit einer Ratte statt. Als Albert die Ratte berührte, wurde hinter ihm mit einem Hammer auf eine Eisenstange geschlagen. Beim zweiten Durchgang begann Albert zu wimmern und zögerte, die Ratte zu berühren. In der Folge fanden mehrere Konditionierungsdurchgänge statt, in denen die Ratte gleichzeitig mit dem lauten Ton präsentiert wurde. Daraufhin begann Albert bei der alleinigen Präsentation der Ratte zu weinen und krabbelte weg. Es wurde dann untersucht, ob sich die Angst generalisiert hatte. Bei der Präsentation eines Hasen und Pelzes lehnte er sich weg, wimmerte und brach in Tränen aus. Mit Holzblöcken spielte er nach wie vor gerne. Einige Tage später fixierte Albert die Ratte mit den Augen und zog sich zurück, weinte jedoch nicht. Damit war es den Autoren leider noch nicht genug und es wurden weitere Konditionierungsversuche durchgeführt, dieses Mal in einen anderen Raum. Bei der Konfrontation mit der Ratte, dem Hasen und dem Hund zeigte Albert leichte Angstreaktionen und versuchte, seine Hände so weit weg wie möglich von den Tieren zu halten. Erneut wurde dann bei der Präsentation der Tiere auf eine Eisenstange geschlagen. Dies führte bei Albert wiederum zu einem Rückzugsverhalten.
Danach wird beschrieben, dass im Anschluss an diese (letzte) Sitzung die Mutter mit Albert weggezogen sei, so dass keine Rekonditionierung durchgeführt werden konnte. Weshalb die Mutter wegzog und was aus Albert wurde, ist bis heute nicht bekannt.
Im Zusammenhang mit dieser Studie können, neben den ethischen Aspekten hinsichtlich der Durchführung der Studie und der Nicht-Beseitigung der willkürlich erzeugten Angst, weitere Probleme festgehalten werden: Es fehlte eine Operationalisierung der Variable »Furcht« und eine klare Quantifizierung des Verhaltens von Albert. So wird im Studienprotokoll von »verzieht das Gesicht«, »wimmert« und »fällt vorn über« berichtet. Zudem werden gegen Ende des Experiments die Reaktionen von Albert immer unklarer beschrieben. Des Weiteren wurde der Versuchsplan immer wieder neu angepasst. Beispielsweise wurden weitere Konditionierungsversuche durchgeführt, als die Reaktionen von Albert schwächer wurden.
Ein entscheidender Unterschied zu anderen Therapieverfahren ist, dass historisch in der Verhaltenstherapie nicht konzeptionell zwischen dem Vorgehen mit Kindern und Erwachsenen getrennt wurde. Bei Kindern und bei Erwachsenen wurden lerntheoretische Konzepte gleichermaßen angewendet. Es ging also in der Verhaltenstherapie mehrheitlich um die Methoden, die bei Kindern und Erwachsenen den gleichen Gesetzmäßigkeiten folgen. Dies steht im Gegensatz zur Psychoanalyse wo, in der z. B. Anna Freud und Melanie Klein spezifische Behandlungsmethoden für Kinder entwickelten.
Die konkrete Umsetzung der Methoden in der Verhaltenstherapie ist jedoch an die Altersgruppe angepasst: z. B. können bei Jugendlichen und Erwachsenen operante Methoden zur Selbstverstärkung (z. B. »Wenn ich mich dem angstauslösenden Reiz aussetze und diese Angst aushalte, belohne ich mich danach mit einem Stück Kuchen und Kaffee«) eingeübt werden, wohingegen bei einem Kind ein Token-Programm gemeinsam mit den Eltern erstellt wird (z. B. die Regel, dass das Kind, wenn es sich morgens selber anzieht, hierfür einen Punkt bekommt). Diese Anpassung impliziert auch, dass jeweils die entwicklungspsychologische Perspektive zu berücksichtigen ist. Als weitere Besonderheit ist sicherlich die Berücksichtigung des Therapiesettings aufzuführen.
Borg-Laufs beschreibt auf der Homepage der DGVT ( www.dgvt.de), dass das Psychotherapeutengesetz 1999 den entscheidenden Schritt zur Trennung zwischen Kinder- und Erwachsenentherapie markiert. Allerdings stellen Meyer und Kollegen 1991 in ihrem Gutachten zum Psychotherapeutengesetzes fest, dass diese Trennung in der Verhaltenstherapie keine Tradition hat, und es auch inhaltlich keinen Sinn macht, zwischen Kinder- und Erwachsenentherapie zu unterscheiden.
1.1 Definition Verhaltenstherapie
Die Verhaltenstherapie orientiert sich an der empirischen Psychologie und vereinigt unterschiedliche spezifische Techniken (z. B. Verstärkung) und Behandlungsmaßnahmen (z. B. Exposition). Da die Verhaltenstherapie nicht auf ein einziges theoretisches Modell zurückgeführt werden kann und auch zukünftige Entwicklungen zugelassen werden sollen, fassen Margraf und Lieb (1995) die Verhaltenstherapie als psychotherapeutische Grundorientierung auf, weniger als Therapieschule oder Gruppe von Verfahren.
Margraf (2018) definiert die Verhaltenstherapie wie folgt:
»Die Verhaltenstherapie ist eine auf der empirischen Psychologie basierende psychotherapeutische Grundorientierung. Sie umfasst störungsspezifische und -unspezifische Therapieverfahren, die aufgrund von möglichst hinreichend überprüftem Störungswissen und psychologischem Änderungswissen eine systematische Besserung der zu behandelnden Problematik anstreben. Die Maßnahmen verfolgen konkrete und operationalisierte Ziele auf den verschiedenen Ebenen des Verhaltens und Erlebens, leiten sich aus einer Störungsdiagnostik und individuellen Problemanalyse ab und setzen an prädisponierenden, auslösenden und/oder aufrechterhaltenden Problembedingungen an. Die in ständiger Entwicklung befindliche Verhaltenstherapie hat den Anspruch, ihre Effektivität empirisch abzusichern.« (Margraf, 2018, S. 5).
Hervorzuheben sind die Grundprinzipien der Verhaltenstherapie (Margraf, 2018), die allen verhaltenstherapeutischen Methoden zugrunde liegen. Der nachfolgende Kasten gibt einen Überblick der Grundprinzipien.
Überblick der Grundprinzipien der Verhaltenstherapie
Verhaltenstherapie
• orientiert sich an der empirischen Psychologie,
• ist problemorientiert,
• setzt an den prädisponierenden, auslösenden und aufrechterhaltenden Problembedingungen an,
• ist zielorientiert,
• ist handlungsorientiert,
• ist nicht auf das therapeutische Setting begrenzt,
• ist transparent,
• soll »Hilfe zur Selbsthilfe« sein,
• bemüht sich um ständige Weiterentwicklung.
Verhaltenstherapie ist problemorientiert, d. h. die Therapieplanung und -durchführung wird anhand der aktuell beschriebenen Probleme ausgerichtet. Basierend auf einem individuellen Störungsmodell wird ein Behandlungsplan erstellt, der spezifisch und individuell auf die Verringerung der vorhandenen Probleme ausgerichtet ist. Im Störungsmodell werden prädisponierende, auslösende und aufrechterhaltende Faktoren für die beschriebene Problematik identifiziert und Behandlungsmethoden mit dem Fokus der Identifikation auslösender Faktoren und der Reduktion von aufrechterhaltenden Faktoren abgeleitet. Die Verhaltenstherapie ist weiterhin ziel- und handlungsorientiert. Mit Patientin und ggf. Bezugspersonen werden konkrete Ziele zu Beginn der Therapie erarbeitet, die realistisch erreichbar sind. Die Zielerreichung wird während der Behandlung regelmäßig überprüft und wenn nötig angepasst. Zur Erreichung der Ziele ist das aktive Mitwirken der Patientin und der Eltern wichtig. Die Patientin soll selbst zur Expertin für den Umgang mit den eigenen Symptomen werden. Im Rahmen von Psychoedukation wird der Patientin auf eine altersangepasste und verständliche Art und Weise Wissen über ihre psychische(n) Störung(en) vermittelt und die Ableitung des Behandlungsplans transparent gestaltet. Im Vordergrund steht das Neulernen oder der Wiedererwerb eines funktionalen Umgangs mit Symptomen (z. B. Konfrontation bei Angststörungen), welche auch zu Hause geübt und erprobt werden. Hausaufgaben sind ein wesentlicher Bestandteil der Verhaltenstherapie, die in den Sitzungen jeweils vor- und nachbesprochen werden. Der Transfer von erarbeiteten Strategien und Aufbau von funktionalem Verhalten im therapeutischen Setting in den Alltag ist in der Verhaltenstherapie von zentraler Bedeutung. Die Psychotherapeutin hilft der Patientin und den Eltern dabei, einen funktionalen Umgang mit Symptomen zu erwerben, z. B. mit Strategien, die der Patientin nach Abschluss der Therapie weiterhin zur Verfügung stehen. Die Verhaltenstherapie sieht sich als Hilfe zur Selbsthilfe und fördert die Eigenständigkeit und das Selbstwirksamkeitserleben der Patientin.
Читать дальше