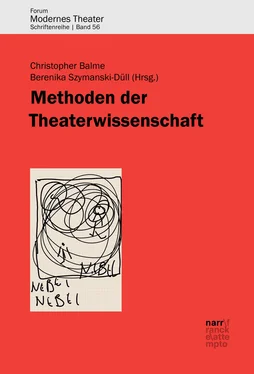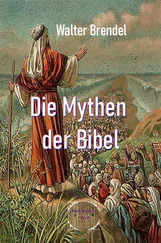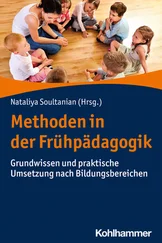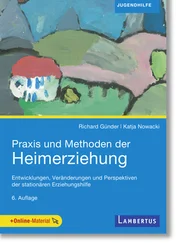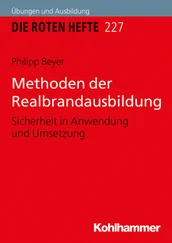Methode im Plural. Eine Methodologie des Heuristischen für die Theaterwissenschaft?
Julia Stenzel
I. Methode: Weg oder Ziel?
Jenseits des Systems Wissenschaft bereitet die Definition von ‚Methode‘ scheinbar wenig Probleme. „Eine Methode ist der Weg zum Ziel“ – diese ebenso selbstbewusste wie schlichte Begriffsbestimmung nimmt ein online-Ratgeber für sich in Anspruch, der seinen Leser*innen in 5 Schritten zu mehr Ordnung im Büro verhelfen möchte. Allerdings suggeriert der unmittelbare Kontext eine spezifische Betonung des Satzes, die jene dann doch enttäuschen muss, die nach einer einigermaßen eindeutigen Definition suchen: Denn „ Eine Methode ist der Weg zum Ziel“, so muss es heißen; und das im Titel des Bandes formulierte Ziel ist ein Schreibtisch ohne Bücher- und Dokumentenmassive. Was aber eine Methode ist, das wird als selbsterklärend vorausgesetzt und einem allgemeinsprachlichen Ungefähren überlassen. Es ist dem Verfasser eben nicht darum zu tun, einen Begriff ‚Methode‘ zu definieren, sondern eine spezifische, nämlich die für mehr Ordnung im Büro, anwendbar zu machen.
Diese Beobachtung an einem Text, der vieles für sich beanspruchen kann, sicherlich aber nicht Wissenschaftlichkeit, ist symptomatisch. Aber selbst wo es in Texten mit wissenschaftlichem Anspruch um Methoden geht, wird die Frage danach, was denn eine solche eigentlich sei, oft geflissentlich übergangen: Nicht was eine Methode, sondern was die hier angewandte Methode ist, ist dann die erste Frage.
Auf dem Weg zur Methode den Umweg über methodologische Fragen zu gehen, soll hier vorgeschlagen werden; und die folgenden Überlegungen setzen es sich zum Ziel, dafür einen möglichen Rahmen zu skizzieren. Ich mache es mir also zur Aufgabe, noch diesseits des Methodischen über methodologische Fragen nachzudenken. Es soll und kann mir im Folgenden entsprechend auch nicht um die Frage gehen, was eine Methode ist. Der Versuch einer normativen Bestimmung mit den unvermeidlichen Inklusions- und Exklusionsmechanismen wäre nicht nur vermessen, sondern auch wenig produktiv. Ich möchte stattdessen versuchen zu rekonstruieren, welche Aspekte dazu führen können, dass geistes- oder kulturwissenschaftliches Arbeiten als methodisch geleitet und kontrolliert beschreibbar wird. Unter welchen Bedingungen wird das Umgehen1 mit Aufführungen, Texten, Bildern, Räumen, Inszenierungen, Situationen; unter welchen Voraussetzungen wird der Blick auf ihre Dokumentationen, Reenactments, journalistischen oder ganz anderen Verhandlungen wissenschaftlich? Und: Ist Wissenschaftlichkeit an Methodik gekoppelt? Um diese Fragen stellen zu können, ist jedoch zunächst zu klären, unter welchen Prämissen ich in diesem Zusammenhang von ‚Methoden‘ sprechen werde – ich will explizit keinen Begriff etablieren, sondern eine methodologische Argumentationsweise vorschlagen.
Speziell für das Fach Theaterwissenschaft und sein – nicht erst seit der performativen Wende – genuin prozessorientiertes Umgehen mit einem medial hybriden Gegenstand ergibt sich dann die Frage nach dem Verhältnis seiner Methoden der Beschreibung und den Methoden auf der Gegenstandsebene, die es beschreibt. Interessant ist weiterhin, wie und wann diese Formen des Methodischen in produktive Interferenzen geraten (dieser letzte Punkt ist für das Fach wahrscheinlich neuralgisch). Kurz: Was heißt für die in dieser Hinsicht spezifische Theaterwissenschaft in welchem Sinne und auf welcher argumentationslogischen Ebene ‚Methode‘?
Wissenschaftstheoretische Verständnisse von ‚Methode‘ können diese Überlegungen konturieren, sollten sie aber keinesfalls deduktiv bestimmen. Arnd Mehrtens etwa unterscheidet wissenschaftstheoretisch zwischen deskriptiver und präskriptiver (man könnte auch sagen: normativer) Methodologie.2 Demgegenüber kündige ich mit einer Methodologie des Heuristischen schon im Titel meines Beitrags eine Art ‚dritten Weg‘ an. Eine solche appellative Methodologie ist auf einer Beschreibungsebene anzusiedeln, die quer zur Dichotomie von ‚präskriptiv‘ und ‚deskriptiv‘, von ‚Vorschrift‘ und ‚Beschreibung‘ steht: Auf diesem Wege soll es gelingen, das Methodische theaterwissenschaftlichen Arbeitens als solches ansprechbar zu machen, ohne schon den Anspruch des Metawissenschaftlichen zu erheben.
Die folgenden Überlegungen gliedern sich in vier Teile und sind auf die eben entwickelte Leitperspektive bezogen, kommen jedoch nicht mit ihr zur Deckung: Nach einer knappen etymologischen und historischen Einordnung (II) ist zunächst kurz darzustellen, was unter einer dynamischen Methode verstanden werden soll (III). Sodann ist die Pluralität theaterwissenschaftlicher Methoden von der Pluralität dessen her zu beschreiben, was ich ihre operativen Grundhaltungen nennen werde (IV), um schließlich der Spezifik inter-methodischen Sprechens in den Geistes- und Kulturwissenschaften versuchsweise nahe zu kommen (V).
II. Methode und Antimethode
Mit ‚Methodologie‘ soll an dieser Stelle, wie gesagt, dezidiert zugleich mehr und weniger als die Gesamtheit der Methoden des Fachs Theaterwissenschaft (oder eines spezifischen Erkenntniszusammenhangs, oder gar der Wissenschaft allgemein) angesprochen werden. Dahinter stünde ein Anspruch, der einerseits vermessen wäre, sich aber andererseits auch in einer bloßen Additionsaufgabe erschöpfen müsste, verbände er sich nicht mit der grundlegenden Frage nach einer Typologie (theater-)wissenschaftlicher Methoden.1 Aus Gründen, die aus dem Folgenden deutlich werden sollten, halte ich eine solche Frage jedoch für wenig hilfreich. So scheint es konsequent, dass sich die Herausgeber*innen des vorliegenden Bandes dagegen entschieden haben, mit der Auswahl der Beiträge ein Gesamtbild aller Methoden des Fachs zeichnen oder Vollständigkeit auch nur suggerieren zu wollen. Dass diese Entscheidung mit der historischen Genese, der institutionellen Einbettung und der spezifischen Unschärfe des Gegenstandsbereiches von ‚Theaterwissenschaft‘ zu tun hat und dass der vorgeschlagene Rahmen – gerade in der Vielfalt der einzelnen Methoden, die im Fach Theaterwissenschaft zur Anwendung kommen – klar disziplinär begründet ist, liegt dabei auf der Hand.
Zurück zum Begriff: Das im einleitend angeführten Bonmot stellvertretend skizzierte, einigermaßen vage Verständnis von ‚Methode‘ als ‚Weg‘ ist etymologisch gewendet plausibel: Das griechische Kompositum methodos (μέθοδος < μεθ- < μετά- und ὁδός) beschreibt einen spezifischen ὁδός (hodos), einen Weg, μετά (meta), nach irgendwo, aber auch auf irgendetwas hin. Das Wort ‚Methode‘ hat also einen konzeptmetaphorischen Hintergrund,2 und es lohnt sich, darüber nachzudenken, inwieweit dessen Implikationen belastbar sind: Ein Weg auf etwas hin – sagen wir: ein Wanderweg – ist, hat man ihn erst einmal gebahnt, beschreib- und markierbar. Er kann von ganz unterschiedlichen Akteur*innen immer wieder beschritten und bewältigt werden und führt mit einiger Sicherheit immer zum selben Ziel. Diese Hintergrundmetaphorik macht sich die Ratgeber- und Selbstoptimierungsliteratur zunutze; mit Disziplin und der rechten Methode (so wird suggeriert) sei das Erreichen des Ziels – Ordnung auf dem Schreibtisch, der perfekte Körper, gar ein glückliches Leben – nur eine Frage der Zeit.
Nun ist ein fachwissenschaftliches Methodenhandbuch kein Wanderführer und kein Diät-Ratgeber; das, worauf wissenschaftliches Arbeiten zielt, ist komplexer als der ordentliche Schreibtisch und weniger umfassend als individuelles Glück. Tatsächlich jedoch setzt auch die klassische Definition des Historischen Wörterbuchs der Philosophie an dem bestechend konkreten Bild an, welches das griechische Wort transportiert. ‚Methode‘ im engeren Sinne meint, so Joachim Ritter, den „Nachgang im Verfolgen eines Zieles im geregelten Verfahren“.3 Und gerade im 20. Jahrhundert hat sich die Diskussion um das Für und Wider einer spezifischen Methode oder methodischen Arbeitens generell immer wieder an den Implikationen der Metaphorik von Weg und Ziel gerieben: Sei es mit der Annahme, Methoden übertrügen ihre eigene Gleichförmigkeit auf den Gegenstand – so etwa bei Hans Magnus Enzensberger, der unter Aufgreifen des bekannten Sontag’schen Essays „Against Interpretation“4 die martialische Metapher prägt, eine literaturwissenschaftliche Interpretation mache aus einem Gedicht eine Keule –5, sei es mit der Vorstellung, erst mit dem Abweichen vom Weg entstünde neues Wissen oder könne sich das alte verändern (so bei Paul Feyerabend).6
Читать дальше