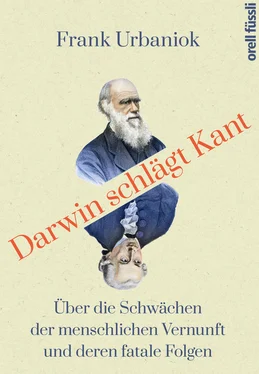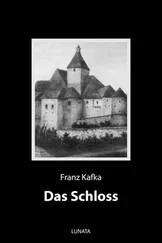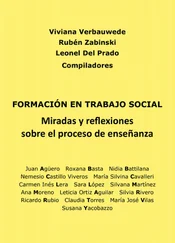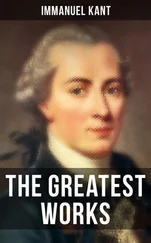Das Gegengewicht gegen diesen starken Leim ist die Flexibilität in seiner Anwendung. Ob der Leim wirksam wird oder nicht, hängt von der Kategorie ab, in der das Lebewesen subjektiv erfasst wird. Wir haben diesen Mechanismus bereits anhand identitätsbildender Konflikte zwischen Fans des eigenen Fußballvereins und Fans eines anderen Fußballvereins oder den Einwohnern der eigenen und den Einwohnern einer Nachbarstadt kennengelernt. In andere Dimensionen gesteigert wirkt derselbe Mechanismus bei Kriegen und bei fundamentalistischen Ideologien. Die »Anderen« sind hier oft eine Kategorie, deren Individuen nicht mehr als Menschen betrachtet werden. Es ist der namenlose Feind, es sind die Ungläubigen, die den Tod verdienen, Angehörige einer Rasse, die keine Lebensberechtigung haben, etc.
Konnten KZ-Aufseher treusorgende Familienväter sein? Ja, selbstverständlich. Denn das, was uns von außen als logischer Widerspruch erscheint, muss subjektiv keiner sein. Die Arbeit im KZ oder bei Erschießungskommandos im Feindesland wurde vielleicht sogar gerade aufgrund ihrer abstoßenden Qualität subjektiv als besonderer Dienst für das eigene Land kategorisiert. Sicher fehlen in der vorherrschenden Kategorisierung der Opfer aber die Aspekte, die das Kooperationsprogramm auslösen können (Bindung). Durch die Kategorisierung findet eine Entmenschlichung statt. Dadurch wird die mit dem Kooperationsprogramm einhergehende Tötungshemmung hinfällig. Das alles hat dann aber in der eigenen Wahrnehmung selbstverständlich nichts mit der eigenen Familie oder gar den eigenen Kindern zu tun. So wie das Stück Fleisch auf dem Teller nicht als ein verhaltensrelevanter Widerspruch zur eigenen Tierliebe empfunden wird oder der eigene Jagdhund vergöttert werden kann, ohne dass ein subjektiver Widerspruch zum Abschlachten vieler anderer Tiere in einem anderen Kontext entsteht.
Wir gehen Ambivalenzen nach Möglichkeit aus dem Weg und sind bestrebt, kognitive Dissonanzen zu vermeiden. Besonders große Hemmungen, bequeme und vertraute Sichtweisen infrage zu stellen, bestehen, wenn sie eng mit dem eigenen Selbstbild verknüpft sind. Da leisten die dargestellten Mechanismen im Alltag gute Dienste. Sie ermöglichen eine Kontinuität in der Lebensführung, eine Stabilität des eigenen Selbstbildes und schaffen dadurch eine klare Handlungsgrundlage. Logische Widersprüche, die wir mit der Vernunft erkennen können, führen nicht auf direktem Weg zu Einstellungs- oder gar Verhaltensänderungen. Im Gegenteil. Denn das Credo lautet: besser falsch, dafür schnell und/oder eindeutig. Das heißt auch: Die gefühlte, bequeme Wahrheit schlägt oft die unbequeme, kognitive Wahrheit.
Wir haben verschiedene Mechanismen betrachtet, die dem Menschen im Wege stehen können, wenn es darum geht, die Wirklichkeit differenziert zu erfassen und darauf aufbauend vernünftig und human zu handeln. Basale erkenntnistheoretische Limitationen betreffen in gewisser Weise das Betriebssystem unserer Wahrnehmungs- und Erkenntnisfähigkeit. Diese grundlegenden erkenntnistheoretischen Begrenzungen können in einer übergeordneten Perspektive als existenzielle metaphysische Aspekte eines im Universum existierenden Lebewesens aufgefasst werden. Auch auf dieser grundlegenden Ebene spielt bereits die Projektion von Strukturen und Mechanismen unseres Erkenntnisapparates in die Außenwelt eine Rolle. Damit ist die Gefahr verbunden, Ordnungsprinzipien, die wir in die für uns wahrnehmbaren Erscheinungen hineinprojizieren, als objektive Eigenschaften der Dinge zu interpretieren. Diese Dinge sind für uns aber nur durch ihre »Erscheinungen« wahrnehmbar, also durch die Art, in der sie uns »erscheinen«. Subjektiv determinierte Wahrnehmungs- und Erkenntnisstrukturen in die Außenwelt hineinzuprojizieren, ohne sie als fehleranfällige Projektion zu erkennen, ist auch auf den beiden nachfolgenden Ebenen ein zentrales Phänomen.
So findet sich auf der nächsten Ebene eine Vielzahl psychologischer Mechanismen, die als gravierende Schwachstellen unserer Erkenntnisfähigkeit anzusehen sind. Jedenfalls muss man es so sehen, wenn man das Ziel verfolgt, die Wirklichkeit differenziert zu erfassen und darauf aufbauend in humanistischer Tradition vernünftig zu handeln. Ist es nicht irritierend, dass unsere Vernunft so viele psychologische Konstruktionsmängel hat? Sind wir ein Montagsauto der Evolution, das man umtauschen sollte, wenn man es nur könnte? Nun haben wir aber bereits gesehen, dass es einen einfachen Grund für die scheinbaren Konstruktionsmängel gibt: Aus Sicht der Evolution geschah die Weiterentwicklung der Vernunft gar nicht mit dem Ziel, die Wirklichkeit differenziert abzubilden. Das Ziel der Evolution war beim Menschen wie auch bei allen anderen Organismen, Überlebens- und Reproduktionsvorteile für die gesamte Art zu schaffen. Vorangehend wurden viele Mechanismen im Detail dargestellt, die man unter dem Motto »Besser falsch, dafür schnell und/oder eindeutig« zusammenfassen kann. Dabei steht manchmal die Geschwindigkeit, manchmal die Eindeutigkeit und manchmal beides als Zielgröße im Vordergrund.
Auf der dritten Ebene ist schließlich auf Persönlichkeitsprofile zu verweisen, die über das übliche Maß hinaus in besonderer Weise zu problematischen Wahrnehmungs-, Erkenntnis-, aber auch Handlungsmustern disponieren. Denn Menschen sind nicht gleich, sondern unterscheiden sich in ihren Charaktermerkmalen. In einer erheblichen Spannbreite finden sich akzentuierte Persönlichkeiten, die in bestimmten Eigenschaften weit von der Mitte der menschlichen Population entfernt sind. Bei solchen Personen treten neben problematischen Verhaltensweisen meist auch die allgemeinen psychologischen Fehlerquellen in verschärfter Form auf.
Die hier angesprochenen Mechanismen bewegen sich zudem zwischen zwei Polen mit gegensätzlichem Charakter. Sie bestimmen die fundamentale Ausrichtung der menschlichen Natur. An dem einen Pol ist die egoistische Selbstbehauptung im Sinne des Willens zur Macht lokalisiert. An dem anderen Pol befinden sich die mit der Vernunft des Menschen neu geschaffenen und exorbitant gesteigerten Möglichkeiten zur Kooperation, die als das basale Kooperationspotenzial anzusprechen sind.
In Abhängigkeit von den erwähnten individuellen Persönlichkeitsprofilen finden sich bei einzelnen Menschen starke Betonungen des einen oder anderen Pols. Ansonsten schließen sich beide Prinzipien in der Praxis keineswegs aus. Im Gegenteil finden sich bei den meisten Menschen Meinungen und Handlungsweisen, die dem einen, und solche, die dem anderen Pol zuzuordnen sind, manchmal aber auch eine Mischung aus beiden Anteilen darstellen können. Welches der beiden basalen Potenziale jeweils im Vordergrund steht, ist stark von speziellen Eigenschaften einer Person, unterschiedlichen Situationen (zum Beispiel im Privaten oder im Beruf) oder als solchen wahrgenommenen Aufgaben und Problemen abhängig. Meist sind Betonungen des einen oder anderen Pols mit einer starken Emotionalität der jeweils nachdenkenden oder handelnden Person verbunden.
Die vielfältigen psychologischen Mechanismen lassen sich übergeordnet im nachfolgend beschriebenen RSG-Modell zusammenfassen. Es besteht aus drei Elementen:
1.Registrieren
2.Subjektivieren
3.Generalisieren
Unser Wahrnehmungsapparat registriert permanent Informationen. Die meisten dieser Wahrnehmungen erfolgen unbewusst. Ich gehe hier von einem weit gefassten Wahrnehmungsbegriff aus. Er ist nicht auf die sinnliche Wahrnehmung beschränkt. Beim Wahrnehmungsbegriff in diesem Schema geht es weniger um die Quelle der Wahrnehmung, sondern um den Zeitpunkt, in dem eine Information bewusst als solche registriert wird, egal woher sie stammt. Das heißt, es geht um ein bewusstes Wahrnehmen als mögliche Vorstufe weiterer gedanklicher bzw. gedanklich-emotionaler Prozesse, die von dieser initialen Wahrnehmung ausgehen.
Читать дальше