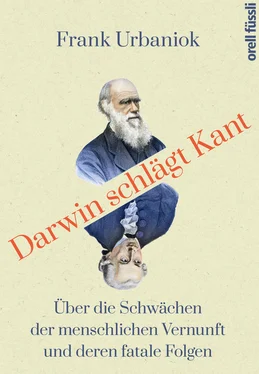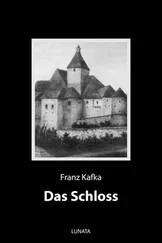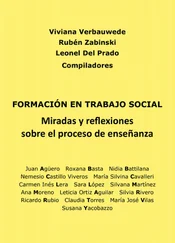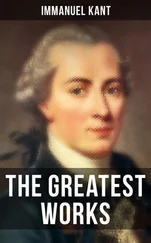Dass wir die ausgeprägte Tendenz haben, Geschichten zu konstruieren, die sich an einer subjektiven Stimmigkeit und nicht an der Abbildung der äußeren Realität ausrichten, kommt beispielhaft in einem berühmten Experiment zum Ausdruck.
Ende der 60er-Jahre wurde bei Patienten mit einer bestimmten Form von Epilepsie durch operative Eingriffe die Verbindung zwischen den beiden Hemisphären des Gehirns unterbrochen. Aufgrund dieser Operation war es bei den (ansonsten psychisch gesunden) Patienten möglich, die linke oder die rechte Hirnhälfte durch bestimmte Versuchsanordnungen gezielt anzusprechen, weil sie nicht mehr in einem ständigen Austausch miteinander standen.
In der Folge wurden verschiedene Untersuchungen an diesen sogenannten Split-Brain-Patienten durchgeführt. [15; 16; 17]
»Erstaunt nahm man zur Kenntnis, dass jede Hemisphäre über ein gewisses Eigenleben verfügte. Rechte und linke Hirnhälfte unterschieden sich in ihren Wahrnehmungen, Konzepten und Handlungsimpulsen […]. Beide Hemisphären haben unterschiedliche Stärken. So konnten beispielsweise Gegenstände, die in der rechten Gesichtsfeldhälfte gezeigt wurden, benannt werden und durch die rechte Hand aus einer Reihe anderer Gegenstände herausgefunden werden. Worte konnten gelesen oder notiert und mit der rechten Hand der zugehörige Gegenstand identifiziert werden. Rechte Hand und rechte Gesichtsfeldhälfte entsprechen dabei einer Verarbeitung in der linken Hirnhälfte, da die Verbindungswege auf ihrem Weg vom Gehirn zur Peripherie die Seite wechseln.
Gegenstände, die der rechten Hirnhälfte präsentiert wurden, konnten weder mündlich noch schriftlich wiedergegeben werden. Allerdings war es möglich, mit der Hand die entsprechenden Gegenstände herauszufinden, ohne daß sie sprachlich bezeichnet werden konnten. Worte konnten nicht gelesen werden.
Daraus ergaben sich folgende Schlußfolgerungen:
1.›Bezüglich Sprache und Bewußtsein ist die isolierte linke Hemisphäre weder aus der subjektiven Sicht des Patienten noch nach dem objektiv beobachtbaren Verhalten von den Leistungen des Gesamthirns zu unterscheiden. Die linke Hemisphäre kontrolliert beim Rechtshänder das Sprechen und das Schreiben.
2.Die isolierte rechte Hemisphäre kann sich weder schriftlich noch mündlich sprachlich äußern. Ihre integrativen sensomotorischen Prozesse werden dem Patienten nicht bewußt. Sie können nur vermittels der linken Hirnhälfte zum Bewußtsein gelangen. Sie erscheinen passiv der linken Hirnhälfte untergeordnet.
3.Weiterhin haben die Versuche gezeigt, daß nur die linke Hemisphäre rechnerische Operationen ausführen kann, die über das Addieren und Subtrahieren von einstelligen Zahlen hinausgehen. Sie ist zuständig für das Erfassen von Einzelheiten und für analytische Denkaufgaben, die offensichtlich an die sprachliche Kommunikation gebunden sind.‹ [18, S. 167–168]
Dennoch ist die rechte Hemisphäre durchaus zu eigener Erfassung und Wahrnehmung in der Lage. Ein Experiment mit den oben erwähnten sogenannten Split-Brain-Patienten verdeutlicht dies: Wurde der rechten Hemisphäre das Bild eines nackten jungen Mädchens dargeboten, so erklärten die Patienten, daß sie ein weißes Licht gesehen hatten, aber nichts erkannten. Das war eine typische Reaktion für Bilder, die der rechten Hemisphäre angeboten wurden, da sie nicht logisch zusammengesetzt werden konnten. Aber es ließ sich etwas anderes beobachten. Die Patienten lächelten, erröteten, kicherten oder veränderten den Tonfall ihrer Stimme. Befragte man die Patienten, so sagten sie zum Beispiel, daß sie über den Diaprojektor oder das Licht lachten. Die ›sprechende‹, linke Hemisphäre hatte keine Vorstellung, worum es sich handelte. Dennoch hatte die rechte Hirnhemisphäre, die sich nicht sprachlich artikulieren kann, eine deutliche Vorstellung von dem Bild entwickelt.« [15; 19, S. 235–236]
5.2.3Funktionen der Subjektivierung
Der Prozess der Subjektivierung hat wichtige Funktionen. Er reduziert die Komplexität einer unübersehbaren Vielzahl von Informationen und verdichtet sie in Geschichten, Erklärungen und überschaubaren Überzeugungen. Die Subjektivierung vermittelt vor allem aber das Gefühl, die Welt und sich selbst verstehen und dadurch kontrollieren zu können. Das heißt, der Gebrauch der Vernunft führt häufig zum Erleben von Kompetenz. Evolutionär wäre es ein Problem, wenn der Gebrauch der ausgeprägten menschlichen Vernunft zum Gegenteil führen würde. In der Tat gibt es ja die Meinung, dass der exzessive Gebrauch der Vernunft eher zum Unglücklichsein und zu Zweifeln disponiert, nicht zuletzt, weil viele Fragen unbeantwortet bleiben. Man kann viele der aufgezeigten Mechanismen so verstehen, dass sie das Individuum vor dieser Nebenwirkung der Vernunft schützen. Damit kommen wir wieder auf das schon zitierte evolutionäre Credo zurück:
Besser falsch, dafür aber schnell und/oder eindeutig. Es ist egal, wenn der Mensch einem Irrtum unterliegt, solange er nur selbst daran glaubt, Richtiges erkannt zu haben, und sich dadurch gut fühlt. Das stärkt das eigene Kompetenzerleben, den Selbstwert und ist ein Element der eigenen Identitätsbildung.
Es gibt Menschen, bei denen die Kompetenzüberzeugung in der Weise vorliegt, dass sie subjektiv davon überzeugt sind, in vielen Bereichen über mehr oder genaueres Wissen zu verfügen als andere Menschen. Nun ist diese Überzeugung offensichtlich einer subjektiven Verzerrung geschuldet. Denn es ist immer so, dass man nur in einigen wenigen Themen überdurchschnittliches Wissen haben kann, verglichen mit unendlich vielen Bereichen, in denen man nur grobe Kenntnisse hat oder überhaupt nichts weiß.
Die Generalisierung wurde bislang unzureichend berücksichtigt, obwohl auch sie weitreichende Konsequenzen hat. Sie findet nicht immer statt. Viele alltägliche Eindrücke, Gedanken, Erkenntnisse und Bewertungen sind flüchtiger Natur, sodass sie deswegen im Hintergrund bleiben und sich nicht für eine Generalisierung eignen. Aber mit den vorangehend zusammengefassten Mechanismen ist eine generelle Tendenz verbunden, Erkenntnisse zu generalisieren. So steckt die Generalisierungstendenz bereits in vielen Mechanismen der Subjektivierung. Sie wird schon durch die Tendenz zur Polarisierung (schwarz/weiß, entweder/oder etc.) nahegelegt. Denn etwas, das schwarz oder weiß ist, ist zu hundert Prozent schwarz oder zu hundert Prozent weiß. Auch der Halo-Effekt ist nichts anderes als die unkritische Generalisierung der Bewertung einer einzelnen Information auf viele weitere Aspekte, die mit der ursprünglichen Information gar nichts zu tun haben. Zahlreiche andere Mechanismen (z. B. Selektion von Informationen, Vermeidung widersprüchlicher Informationen, Ausrichtung der Informationen an einem eigenen, inneren Skript, das nicht infrage gestellt wird) sind ebenfalls sehr gut geeignet, Ideen oder Theorien auszuweiten, aufzupumpen und letztlich zu generalisieren.
Es kommt hinzu, dass die Generalisierung dem Pol der menschlichen Natur entspricht, der als egoistische Selbstbehauptung bzw. Wille zur Macht bezeichnet wurde. Die egoistische Selbstbehauptung als Wille zur Macht hat, wie bereits erwähnt, etwas Fortschreitendes und Grenzenloses. Sie ist mit einer Überbewertung der eigenen Perspektive und des eigenen unbedingten Wertes verbunden. Sie lebt vom Prinzip, die Umwelt und insbesondere andere Menschen zu kontrollieren, zu unterwerfen und zu beherrschen. Die mit der Generalisierung verbundene Ausweitung und Allgemeingültigkeit eigener Sichtweisen kommt all diesen Aspekten entgegen.
Die Generalisierungstendenz begegnet uns deshalb überall im Alltag. Aus einem punktuell richtigen Gedanken wird eine umfassende Theorie, aus einer Regel eine ausufernde Bürokratie, aus einer bequemen Sichtweise eine Ideologie oder Religion.
Читать дальше