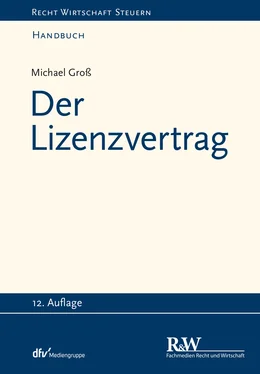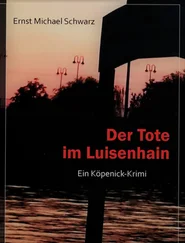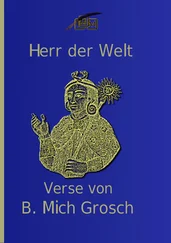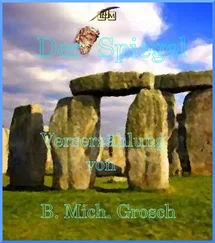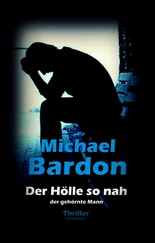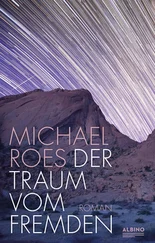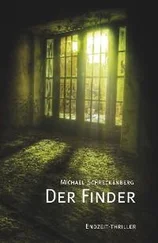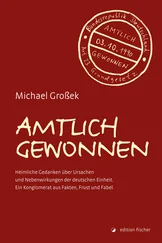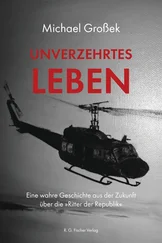Michael Groß - Der Lizenzvertrag
Здесь есть возможность читать онлайн «Michael Groß - Der Lizenzvertrag» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Der Lizenzvertrag
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Der Lizenzvertrag: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Der Lizenzvertrag»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Die neue GVO der EU-Kommission zu Technologietransfer-Vereinbarungen und die entsprechenden Leitlinien werden ausführlich
kommentiert; die Texte sind im Anhang abgedruckt.
Der Lizenzvertrag — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Der Lizenzvertrag», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Im Zusammenhang mit der Übertragung von Know-how sollte dabei nicht übersehen werden, dass aufgrund des Fehlens der Schutzrechte ein allgemeines Verbotsrecht des Inhabers des Know-how nicht besteht. Nachbau und Nachahmung sind nach dem Wettbewerbsrecht fast aller Länder in weitem Umfang zulässig, es sei denn, dass besondere Umstände vorliegen, durch die der Nachbau und die Nachahmung unlauter werden.20
Eine neue Qualität erlangt der Know-how-Schutz durch die Richtlinie (EU) 2016/943 vom 8.6.2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertrauliche Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung.21
Am 26.4.2019 trat das deutsche GeschGehG in Kraft und setzt damit die vorgenannte Richtlinie um. Es ersetzt die §§ 17 ff. UWG (a.F.) und passt den Know-how-Schutz an die anderen Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums (z.B. PatG, GebrMG, DesignG, MarkenG etc.) an:
– Der Begriff des „Geschäftsgeheimnisses“ umfasst alle denkbaren Informationen“, die den Vorgaben des § 2 Nr. 1 GeschGehG genügen. Der Begriff der „Information“ wird im GeschGehG nicht definiert und ist daher sehr breit zu verstehen. Diese Ansicht wird durch die Begründung des Referentenentwurfs des BMJV gestützt, der darauf verweist, dass „ausweislich des Erwägungsgrunds 14 der Richtlinie Grundlage der Definition des Geschäftsgeheimnisses ist, dass sie Know-how, Geschäftsinformationen und technologische Informationen abdeckt, ...“. Außerdem entspreche die Definition des Geschäftsgeheimnisses Art. 39 Abs. 2 TRIPS und im Wesentlichen der von der Rechtsprechung zu § 17 UWG a.F. entwickelten Definition des Geschäftsgeheimnisses.
– Eine weitere Kernaussage gemäß § 2 Nr. 1 a)–c) GeschGehG betrifft die Notwendigkeit, dass die Information geheim, Gegenstand von den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber ist und ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht. Bei der Angemessenheit der Geheimhaltungsmaßnahmen dürfte es gerade kleineren und mittleren Unternehmen, die schon erhebliche Probleme mit der Umsetzung der DSGVO haben, z.B. schon schwerfallen, alle entsprechenden Informationen zu kategorisieren und dann entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Auch die in § 2 Nr. 1c) GeschGehG geforderte Nachweispflicht bzgl. des „berechtigten Interesses an der Geheimhaltung“ dürfte in Kombination mit den „angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen“ viele KMU überfordern.
– Schließlich sind auch die in § 3 Abs. 1 Nr. 2 GeschGehG genannten erlaubten Handlungen des „Beobachtens, Untersuchens, Rückbauens oder Testens eines Produkts oder Gegenstands“ gerade auch im Bereich der Software- und Datenbankentwicklung und der Software-/Datenbankverwertung sehr bedeutsam, da bisher mithin bzw. überwiegend immer noch das Reverse Engineering – gestützt durch die Rechtsprechung – verboten war. Im Umkehrschluss zu § 2 Abs. 2 GeschGehG, der die Erlangung, Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses ermöglicht, wenn dies durch Gesetz, aufgrund eines Gesetzes oder durch Rechtsgeschäft gestattet ist, und aufgrund des § 4 Abs. 2 Nr. 2, 3, der ausdrücklich die Handlungsverbote des Verstoßes „gegen eine Verpflichtung zur Beschränkung der Nutzung des Geschäftsgeheimnisse (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 GeschGehG) oder gegen eine Verpflichtung, das Geschäftsgeheimnis nicht offenzulegen (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 GeschGehG)“ enthält, muss also in Verträgen das Verbot des Reverse Engineering ausdrücklich geregelt werden, wenn dies im Interesse des Unternehmens ist, das seine Software bzw. seine Datenbanken entsprechend schützen will. Diese Vorschriften hätten also seit spätestens 26.4.2019 dazu führen müssen, dass gesonderte Geheimhaltungsvereinbarungen und Geheimhaltungsvereinbarungen in z.B. F&E- und Lizenzverträgen umgehend hätten angepasst werden müssen bzw. in neueren entsprechenden Verträgen gleich berücksichtigt werden müssen. Es ist dabei sorgfältig zu prüfen, ob es – je nachdem, ob es sich um vertikale (z.B. einseitige Geheimhaltungsvereinbarungen, Auftragsforschung, Lizenzverträge), und/oder horizontale Verträge (z.B. wechselseitige Geheimhaltungsvereinbarungen, Forschungskooperation, Verträge über gemeinschaftliche Erfindungen/Urheberrechte) handelt – notwendig ist, derartige Reverse Engineering-Klauseln in den Verträgen je nach Interessenlage vorzusehen bzw. nicht vorzusehen. Da insbesondere aber nicht nur gesonderte Geheimhaltungsvereinbarungen immer häufiger dem Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingen unterliegen, empfiehlt es sich, insbesondere das Verbot des Reverse Engineering ausdrücklich individuell in Verbindung mit Geheimhaltungsverträgen zu verhandeln, um auch AGB-rechtliche Probleme zu vermeiden.22
3. An einem Softwareurheberrecht/an einer Datenbank
17
Aus § 29 Abs. 2 i.V.m. § 31 Abs. 1 UrhG und aus § 87b UrhG ergibt sich, dass auch die urheberrechtlichen und die datenbankherstellerrechtlichen (ausschließlichen) Benutzungsrechte positive Benutzungsrechte sind, ähnlich wie bei den gewerblichen Schutzrechten (z.B. selbstständiges Klagerecht des ausschließlichen Lizenznehmers).23
4. An einer Marke
18
§ 30 MarkenG bringt im Gegensatz zum vorher bestehenden WarenzeichenG zum Ausdruck, dass die Marke Gegenstand einer (ausschließlichen oder nichtausschließlichen) Lizenz sein kann und es sich daher bei diesen Lizenzen ebenfalls um positive Benutzungsrechte handelt.24
1Vgl. dazu Klauer/Möhring, PatG, Rn. 21 zu § 9; zuletzt Ann, GRUR Int. 2004, 698; Kraßer, 925 ff., 927, und Pahlow, S. 16 ff. 2In der Fassung vom 16.12.1980, BGBl. I 1981, 1, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19.10.2013 (BGBl. I, 3830). 3Das heißt nach dem Gesetzeswortlaut „Der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent“. 4Vgl. BT-Drucks. 8/2087, 25; vgl. auch § 43 Abs. 1, 2 GPÜ. 5BGH, 5.7.1960, GRUR 1961, 27. 6Klöppel, passim; vgl. auch einschränkend Lichtenstein, NJW 1965, 1839, und die Kritik dazu von Lüdecke, NJW 1966, 815 ff.; RG, 17.12.1886, RGZ 17, 53; Pahlow, S. 45 ff. 7Kohler, 509; Isay, Anm. 31 zu § 6; Pietzcker, Anm. 16 und 18 zu § 6; Klauer/Möhring, PatG, Anm. 23 zu § 9; Krausse/Kathlun, Anm. 8 A zu § 9; Kisch, 215; Rasch, 6; Lüdecke-Fischer, 370; Lichtenstein, NJW 1964, 1345, 1346; Benkard/Scharen, PatG, Rn. 5 ff. zu § 9 m.w.N.; Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG, § 15, Rn. 56 f., RG, 18.8.1937, RGZ 155, 306; Kraßer/Ann, S. 982 ff., 986 f.; Pahlow, S. 47 ff. 8Vgl. unten Rn. 36, 362 f. 9Vgl. unten Rn. 291 ff.; zur negativen Lizenz Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG, Rn. 57 zu § 15; B. Bartenbach, Mitt. 2002, 503 ff., sowie Kraßer/Ann, S. 984, und die folgenden Fallbeispiele; Dombrowski, GRUR-Prax 2015, 149. 10Vgl. dazu BGH, 23.3.1982, NJW 1982, 2861; BGH, 24.6.1952, GRUR 1953, 29; BGH, 16.11.1954, GRUR 1955, 286, 289. 11BGH, 26.6.1969, GRUR 1969, 677; BGH, 17.3.1961, GRUR 1961, 466, 468. 12Wird kein Schutzrecht erteilt, ergeben sich im Hinblick auf das mit der Veröffentlichung verbundene Problem der Offenkundigkeit für das Know-how erhebliche Probleme, vgl. dazu Stumpf, Der Know-How-Vertrag, Rn. 259 ff.; zu Verbesserungen und Weiterentwicklungen BGH, 29.1.1957, 485, 487; Klauer/Möhring, PatG, Rn. 84 zu § 9; Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG, Rn. 156 zu § 15; ständige Rechtsprechung des BGH, vgl. z.B. BGHZ 86, 330, 334; siehe unten Rn. 308, 331, 337, 359. 13Wie Fn. 12 und BGH, 23.3.1982, NJW 1982, 2861, 2863; siehe auch Benkard, PatG, Rn. 166 ff. zu § 15; vgl. unten Rn. 73, 74. Am 14.12.2010 hat die EU-Kommission einen Vorschlag für einen Ratsbeschluss unterbreitet, der ein einheitliches EU-Patent ermöglichen soll, SZ v. 9.12.2010. Am 10.3.2011 wurde vom Wettbewerbsrat der EU zwar dem Gemeinschaftspatent, nicht aber einer gemeinsamen EU-Gerichtsbarkeit zugestimmt, was der Akzeptanz des Gemeinschaftspatents nicht dienlich sein dürfte. 14Pietzcker, Anm. 2, 7, 16 zu § 6; Reimer, PatG, Anm. 21 zu § 9; Krausse/Katluhn/Lindenmaier, Anm. 17 zu § 9; Benkard/Ulmmann/Deichfuß, PatG, Rn. 13 zu § 15 m.w.N. 15BGBl. I 2004, 390. 16Vom 10.10.2013 (BGBl. I, 3799; bisher: Geschmacksmustergesetz). Das Designgesetz wurde in der Fassung 24.2.2014 (BGBl. I, 122) berücksichtigt. S. zum Geschmacksmusterrecht z.B.: Kur, GRUR Int. 1998, 977 ff.; Text der Richtlinie 98/71/EG vom 13.10.1998, ABl. 1998 Nr. 289, 28 vom 28.10.1998 = GRUR Int. 1998, 959 ff.; zur Umsetzung der Richtlinie 98/71/EG siehe Pentherondakis, GRUR Int. 2002, 668 ff., und Eichmann, Mitt. 2003, 1 ff., 102; ders., MarkenR 1/2003, 10 ff.; zu den Prüfungsrichtlinien für Gemeinschaftsgeschmacksmuster siehe Schlötelburg, Mitt. 2003, 100 ff.; zu den Kriterien der Eigenart, Sichtbarkeit und Funktionalität siehe Koschtial, GRUR Int. 2003, 973 ff.; das Verhältnis zum Markenrecht untersuchen Lewalter/Schrader, Mitt. 2004, 202 ff.; Beyerlein, WRP 2004, 676 ff. Siehe auch zur verneinten Frage der Übertragung von Nutzungs- und Verwaltungsrechten bei Entwicklung eines Bekleidungsstücks OLG Hamburg, 10.6.2002, GRUR-RR 2004, 322 ff.; LG Stuttgart, 26.7.2018, „Porsche 911“, GRUR 2019, 241 ff.; Pahlow, GRUR Int. 2019, 900 ff. 17BGH, 29.6.1966, NJW 1966, 1707 ff.; demgegenüber vertritt das OLG München, 23.10.2003, GRUR-RR 2004, 99 = GRUR 2004, 323 f. (nicht rechtskräftig), die Auffassung, dass die Gebrauchsvorteile, die ein Miterfinder durch die über seinen Anteil hinausgehende Nutzung der gemeinsamen Erfindung hat, auch dann auszugleichen sind, wenn der andere Miterfinder sich der Nutzung nicht verweigert hat – der BGH hat inzwischen die Sache an das OLG München zur erneuten Entscheidung zurückverwiesen; siehe hierzu Tilmann, GRUR 2006, 2006, 827 f.; Meier-Beck, GRUR 2007, 11 ff., 15 f.; Henke, GRUR 2007, 90 ff. Teplitzky, GRUR 2007, 177 ff.; und bzgl. Marken Haedicke, GRUR 2007, 23 ff. und OLG Frankfurt a.M., 6.12.2005, ZUM 2006, 332 ff., siehe auch BGH, 21.12.2005, WRP 2006, 483 ff. = GRUR 2006, 401 ff. = Mitt. 2006, 169 ff. zur Berücksichtigung möglicher Miterfinderstellung bei Geltendmachung einer Alleinerfindervergütung BGH, 17.10.2000, GRUR 2001, 226 ff.; TGI Paris, 4.5.2006, GRUR Int. 2007, 85; Lüdecke, 1 ff.; Fischer, GRUR 1977, 313; Benkard, § 6 Rn. 35 ff.; Sefzig, GRUR 1995, 302; Storch, FS Preu, 1988, 44; van Venrooy, Mitt. 2000, 26 ff.; Niedzela-Schmutte, 1 ff. m.w.N.; Kraßer, S. 338 ff.; Loewenstein, les Nouvelles, March 1998, 1 ff.; Dillahunty, les Nouvelles, March 2002, 1 ff. m.w.N.; Großbritannien: z.B. Court of Appeal, 11.12.1987, GRUR Int. 1998, 811 f. m.w.N.; Japan: z.B. GRUR Int. 1998, 507 ff.; USA: z.B. US Court of Appeals Federal Circuit, 45 USP Q2d 1545, 3.2.1998, No. 97–1269 – Ethicon Inc. v. United States Surgical Corp.; vgl. auch zu Lizenzgebührenklauseln bei Gemeinschaftserfindungen Groß/Rohrer, Lizenzgebühren, Rn. 216 ff.; Henke/von Falck/Haft/Jaekel/Lederer/Loschelder/McGuire/Viefhues/von Zumbusch, GRUR 2007, 503 ff.; Hellebrand, Mitt. 2008, 433 ff.; Trimborn, Mitt. 2010, 461 ff., 466 unter Verweis auf BGH „Gummielastische Masse II“, Mitt. 2006, 354, und OLG Düsseldorf, 1.10.2009, 2 U 41/07 (ohne Fundstelle) – Glasverbundplatten; Haberl, GRUR-Prax 2014, 415; Hauck, GRUR-Prax 2014, 430 ff.; BGH, 12.3.2009 „Blendschutzbehang“, GRUR 2009, 657 ff., Mitberechtigung trotz Teilbarkeit der Patentanmeldung; BGH, 27.9.2016 „Beschichtungsverfahren“, GRUR-Prax 2016, 533; BGH, 16.5.2017 „Sektionaltor II“, Mitt. 2017, 416 ff. = GRUR 2017, 890 ff.; OLG Düsseldorf, 26.7.2018 „Flammpunktprüfung“, Mitt. 2018, 37 ff. = GRUR 2018, 1037 ff.; Meier-Beck, GRUR 2017, 1067 m.w.N. in Fn. 18 f.; Schwab, GRUR 2018, 670 ff.; BFH, 22.11.2018, Mitt. 2019, 420 ff. – endoskopische Gewebecharakterisierung (Bruchteilsgemeinschaft in der Umsatzsteuer). 18Vgl. dazu Stumpf, Der Know-How-Vertrag, Rn. 1 ff.; Cour de Cassation, 13.6.2006, GRUR Int. 2006, 1039 ff. – Parfüm. 19Stumpf, Der Know-How-Vertrag, insb. Rn. 4 ff., 10; siehe zum engeren EU-kartellrechtlichen Know-how-Begriff Rn. 606; § 33 PatG. 20Stumpf, Der Know-How-Vertrag, Rn. 10; vgl. dazu auch Beschluss der Internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz, GRUR Int. 1974, 358, 362; vgl. auch Liuzzo, GRUR Int. 1983, 25. Aktuell hierzu Oehlrich, GRUR 2010, 33 ff. und McGuire/Joachim/Künzel/Weber, GRUR Int. 2010, 829 ff. Im Bereich der Biotechnologie werden Materialien häufig mit Material Transfer Agreements überlassen, vgl. dazu Czychowski/Engelhard/Nordemann, Mitt. 2013, 108 ff.; siehe zum Know-how-Schutz in Europa die „Stellungnahme des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb vom 12.5.2014 zum Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Richtlinie über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) von rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung vom 28.11.2013, COM (2013) 813 final“ GRUR Int. 2014, 554 ff.; Rauer, WRP 2014, Editorial; Ohly, GRUR 2014, 1 ff.; Ann, GRUR 2014, 12 ff. Die geplante Richtlinie der Kommission wird hoffentlich dazu beitragen, den Know-how-Transfer in der Praxis zu vereinheitlichen und besser als bisher abzusichern. Der Know-how-Schutz erfolgte bisher insbesondere nur durch Geheimhaltungsvereinbarungen und/oder durch entsprechende Regelungen in z.B. F+E- und Lizenzverträgen und durch in Europa nur teilweise und dazu nicht einheitlich geregelten Vorschriften. 21ABl. L 157/1 ff. 22BGBl. I, 466; Referentenentwurf des BMJV, S. 21, B. zu Art. 1, zu § 1, Abs. 1, Nr. 1, Abs. 2; vgl. zum GeschGehG im gewerblichen Rechtsschutz z.B. Triebe, WRP 2018, 795 ff.; Kiefer, WRP 2018, 910 ff.; Müllmann, Auswirkungen der Industrie 4.0 auf den Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, WRP 2018, 1177 ff.; Leister, GRUR-Prax 2019, 75 ff.; Hoeren/Münker, WRP 2018, 150 ff.; Ohly, GRUR 2019, 441 ff.; Hauck, GRUR-Prax 2019, 22; siehe auch zum Schutz von Betriebsgeheimnissen die außereuropäische Rechtsprechung z.B. in der Schweiz: Bundesgericht, 28.11.2016, GUR Int. 2017, 135 ff. – Entwicklungszusammenarbeit, und in Japan: Bezirksgericht Tokio, 27.7.2015, GRUR Int. 2017, 639 – Nippon Steel AG v. POSCO AG; Schuster/Tobuschat, GRUR-Prax 2019, 248 ff.; Rehaag/Straszewski, Mitt. 2019, 249 ff.; Lauck, GRUR 2019, 1132 f.; Schregle, GRUR 2019, 912 ff.; OLG München, 8.8.2019, GRUR-RR 2019, 443 ff. zur zögerlichen Geltendmachung von Ansprüchen nach GeschGehG. Hoppe/Oldekop, GRUR-Prax 2019, 324 ff. 23Siehe z.B. Schricker, Einleitung Rn. 18 ff., Vor §§ 28 ff., Rn. 43 ff., 48 bzgl. der Urheberrechte und Vor §§ 87a ff. Rn. 22, § 87b Rn. 1 ff. bzgl. der Datenbankherstellerrechte. Siehe auch OLG Frankfurt a.M., 12.6.2019, GRUR-RR 2019, 457 ff. – Logo (zur konkludenten Lizenzerteilung an einem zur Produktkennzeichnung entworfenen Logo). 24Vgl. Fammler, S. 5 ff., unter Verweis auf Fezer, § 30 Rn. 6 ff., und Ingerl/Rohnke, § 30 Rn. 48 a.E.; OLG Hamburg, 28.4.2005, MarkenR 2006, 55; Ströbele/Hacker, § 30 Rn. 7 ff., 12 ff.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Der Lizenzvertrag»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Der Lizenzvertrag» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Der Lizenzvertrag» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.