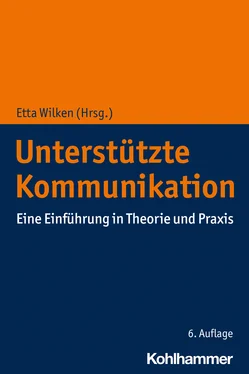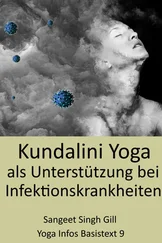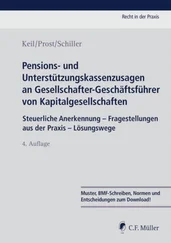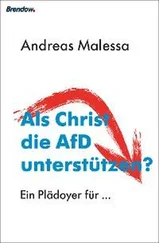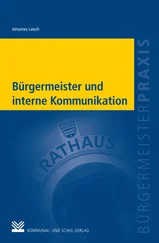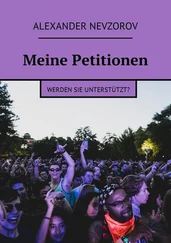Durchführung der Untersuchung
Allgemeine Regeln für die Diagnostik durch Verhaltensbeobachtung: Für die Durchführung der Beobachtungen der Kommunikation gibt es einige Grundregeln, die hier zunächst dargestellt werden sollen. Da die meisten Regeln auch für die Beobachtung des kognitiven Verhaltens gelten, werden sie an dieser Stelle für beide Bereiche gemeinsam dargestellt. Wird die Untersuchung von einer dem Kind fremden Person durchgeführt, so sollte eine Bezugsperson anwesend sein. Dies gibt dem Kind wichtigen emotionalen Rückhalt und ermöglicht es darüber hinaus, das kindliche Verhalten während der Untersuchung mit seinem Alltagsverhalten zu vergleichen. Optimal ist, wenn die Untersuchung auf Video aufgezeichnet werden kann, da es während der Durchführung schwierig ist, subtile Verhaltensweisen eines Kindes zu erkennen. Dies gilt vor allem für die frühen Entwicklungsphasen.
Es hat sich bewährt, die Beobachtungen am Tisch sitzend durchzuführen, wobei nur die für die jeweilige Situation benötigten Gegenstände auf dem Tisch sein sollten. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind die Vorgabe beachtet und seine Verhaltensweisen tatsächlich Reaktionen auf die vorgegebene Situation sind. Dadurch wird wahrscheinlicher, dass sie im Bereich der Kommunikation die erwartete Funktion haben, selbst wenn die Funktion nicht eindeutig am Verhalten zu erkennen ist. Dies ist besonders wichtig bei Kindern auf relativ niedrigem Entwicklungsstand und bei Kindern mit wenig ausgeprägten Reaktionen. Die Dauer der Beobachtung sollte auf die Ausdauer des Kindes abgestimmt werden. Bei schlechter Motivation, Ermüdung oder Irritation sollte man abbrechen. Erfahrungsgemäß können viele Kinder etwa 15 bis 20 Minuten mitarbeiten, wenn die Untersuchung locker und abwechslungsreich gestaltet wird.
Die Vorgabe der Situationen ist nicht standardisiert. Ziel ist es, möglichst vielfältige Reaktionen auszulösen. Für jede Situation muss die Motivation des Kindes geweckt werden. Dies geschieht zum einen durch intensiven positiven Kontakt zum Kind, durch Beachtung seiner Aufmerksamkeit und Ermüdung und durch Abstimmung der verwendeten Gegenstände auf die Interessen des Kindes, wobei (als Ausnahme) auch Leckereien angeboten werden können.
Die einzelnen Aufgaben können in beliebiger Reihenfolge gegeben werden, abgestimmt auf die Präferenzen des Kindes. Oft bieten sich inhaltlich sinnvolle Darbietungssequenzen an. Ein Beispiel aus dem Bereich der Kommunikation ist, dass man zunächst eine Seifenblasendose außer Reichweite stellt, nach einer Reaktion des Kindes ihm diese fest verschlossen gibt und abwartet, wie es fordert, dass die Erwachsene blasen soll. Wenn man dann geblasen hat, kann man beobachten, ob das Kind auf die fliegenden Blasen mit einem Kommentar reagiert. Jede der Situationen sollte mehrmals und mit unterschiedlichen Materialien gestaltet werden, damit man mehrere Verhaltensbeispiele erhält. Bei der Untersuchung der kognitiven Entwicklung ist es auch günstig, wenn man zwischen den Untertests wechselt, um durch neue Aufgabentypen das Interesse des Kindes wach zu halten. Löst ein Kind eine Aufgabe nicht, so ist es sinnvoll, diese nochmals zu einem späteren Zeitpunkt mit anderen Materialien anzubieten, um zu klären, ob eventuell fehlende Motivation oder Ermüdung die eigentliche Ursache hierfür sind.
Spezielle Regeln für die Kommunikationsbeobachtung: Grundsätzlich sollten stets die Erwartungen des Kindes erfüllt bzw. seine Botschaften erfolgreich sein, d. h. das, was es fordert, bekommt es auch, oder da, wo es protestiert, wird dies akzeptiert. Da die Untersucherin die Situationen vorgibt, kann sie meist auch bei unklaren Signalen angemessen reagieren. Allerdings fanden wir in einer Untersuchung (Hammer, Zürn, Kane 1998), dass Kinder oft zunächst als Reaktion auf die kommunikationsauslösenden Situationen sehr einfache Signale benutzen, um Interesse oder Wünsche mitzuteilen. Hier können gezielte »Missverständnisse« weitere Mitteilungen des Kindes anregen. Dabei reagiert die Untersucherin zunächst mit einem nicht der Mitteilung entsprechenden Verhalten (z. B. legt sie das Spielzeug, auf das das Kind blickt, an die andere Ecke des Tisches, statt es ihm zu geben), bleibt aber im Kontakt mit dem Kind und macht deutlich, dass sie an einer Auflösung des Missverständnisses interessiert ist. In unserer Untersuchung folgte fast immer auf eine falsche Reaktion der Erwachsenen eine erneute Botschaft. Mehr als die Hälfte dieser neuen Botschaften war auf einem höheren Niveau als die erste Mitteilung und äußerst selten auf niedrigerem. Missverständnisse schafften somit zusätzliche Gelegenheiten zur Kommunikation und forderten häufig eine Verdeutlichung der Äußerung heraus.
Allerdings zeigt eine Untersuchung von Wilcox und Webster (1980), dass Missverständnisse emotional belasten können. Sie fanden in der Interaktion von Eltern mit ihren nichtbehinderten Kindern im zweiten Lebensjahr häufig Missverständnisse und deutliche Hinweise auf Stresserleben, bis hin zu Kommunikationsabbrüchen. In der Untersuchung von Hammer et al. waren ebenfalls Frustrationssignale nach Missverständnissen zu beobachten; einige Kinder wandten sich nach Missverständnissen kurz ab, nestelten an ihrer Kleidung, lutschten am Daumen usw. Die Belastung blieb aber begrenzt und Kommunikationsabbruch wurde völlig vermieden, wenn die Untersucherin dem Kind signalisierte, dass sie sich um ein Verstehen bemühte und das Kind letztendlich die gewünschte Reaktion erfuhr.
Auswertung der Beobachtungen
Allgemeinverhalten bei der Beobachtung von Kognition und Kommunikation
1. Kontakt: Wie war der Kontakt zum Kind? Suchte es Blickkontakt? Mochte es Körperkontakt? Wirkte es zurückhaltend oder offen? War es eventuell durch Schüchternheit gehemmt?
2. Interesse und Motivation: Wie war die Mitarbeit des Kindes? Ermüdete es schnell? Interessierte es sich nur für wenige Dinge oder sprach es auf viele Situationen an? Galt sein Interesse eher Gegenständen, Ereignissen oder den Erwachsenen? Waren kommunikative Äußerungen auf die auslösenden Situationen beschränkt oder machte es auch spontane Mitteilungen, so als habe es ein großes Mitteilungsbedürfnis? Zeigte es Freude an gelungenen Problemlösungen und wiederholte es diese z. T. spontan?
3. Umgang mit Belastung: Zeigte es negative Emotionen, wenn Wünsche nicht sofort erfüllt wurden oder es eine Aufgabe nicht lösen konnte? Zeigte es Belastungssignale (z. B. Abwenden, Gähnen, Stereotypien, Schreien, Aggressionen) bei Missverständnissen oder bei Unter- oder Überforderung? Waren sie eher subtil, wie kurzes Abwenden, oder heftig, wie Schreien oder Versuche, aus der Situation zu kommen?
4. Generalisierbarkeit der Beobachtungen: Entsprach das Verhalten des Kindes nach Eindruck seiner Eltern oder Erzieher seinem Alltagsverhalten?
In unseren Untersuchungen fanden wir fünf Stufen der vorsprachlichen Entwicklung, die die meisten Kinder in gleicher Reihenfolge erlernen. Allerdings ist es nicht so, dass ein Kind kontinuierlich eine Stufe nach der anderen erklimmt und die niedrigeren Stufen jeweils hinter sich lässt. Die Verhaltensweisen einer neuen Stufe erweitern das verfügbare Kommunikationsrepertoire, sie ersetzen nicht die früheren (Kane 1994). Im Folgenden werden die fünf Stufen kurz beschrieben, für eine ausführliche Darstellung der Stufen mit Besonderheiten der Entwicklung bei Kindern mit Behinderungen wird auf Kane (1992) und Rotter, Kane, Gallé (1992) verwiesen. Zur Bestimmung der Stufe werden vor allem die Modalitäten Blickrichtung, Gesten und Laute verwendet. Die gerade für die Befindlichkeit des Kindes ebenfalls sehr informative Mimik wurde für die Bestimmung des Niveaus nicht berücksichtigt, da sie schon in den ersten Lebenswochen sehr differenziert und ausgeprägt ist und sich keine so deutliche Entwicklungslinie zeigt wie in den anderen Modalitäten. Aber sicherlich spielt in der Verständigung auch der gezeigte Affekt eines Kindes eine sehr große Rolle für die Interpretation seiner Äußerungen.
Читать дальше