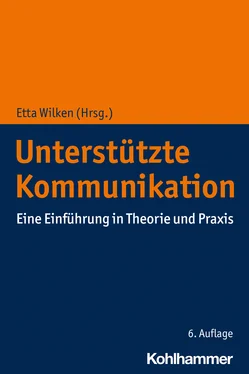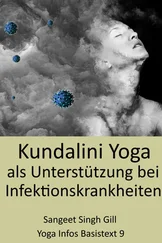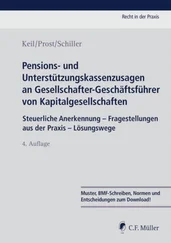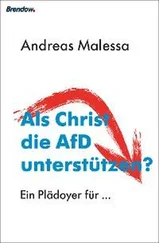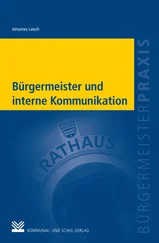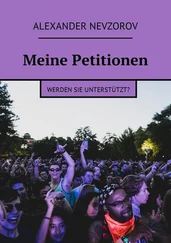Ein wichtiger ergänzender Gesichtspunkt bezieht sich auf den geeigneten Lernort und die notwendigen Rahmenbedingungen. Aufgezeigt wird deshalb, welche Möglichkeiten der kommunikativen Förderung im gemeinsamen Unterricht gestaltet werden können (siehe Hömberg). Gerade für die Weiterentwicklung der inklusiven Beschulung ist es wichtig, die dafür erforderlichen personellen und sächlichen Ressourcen kriteriengeleitet und den individuellen Bedürfnissen entsprechend zu gewährleisten.
Unterstützte Kommunikation ist auch Erwachsenen noch anzubieten, denen bisher kein Zugang zu angemessenen alternativen oder ergänzenden Kommunikationsformen ermöglicht wurde (siehe Bober). Zunehmend wichtig ist zudem, die Bedürfnisse von Personen zu berücksichtigen, die aufgrund krankheitsspezifischer oder allgemeiner altersbedingter Abbauprozesse immer weniger in der Lage sind, sich verbal zu verständigen. Dabei sind sowohl das Lebensalter als auch die individuellen Lebensbedingungen – ob zu Hause, in eigener Wohnung oder im Wohnheim – und die sich daraus ergebenden speziellen Bedürfnisse der Erwachsenen differenziert zu reflektieren.
Die Zunahme von Kindern und Erwachsenen, die alternative oder ergänzende Kommunikationshilfen benötigen und das anwachsende Bedürfnis nach Beratung und Information auch der Bezugspersonen in der Familie und in den verschiedenen Institutionen machen dringend erforderlich, nicht nur entsprechende regionale Angebote an Beratungsstellen aufzubauen (siehe Karus), sondern auch Fortbildung und Forschung weiter zu entwickeln.
Das vorliegende Buch will nicht nur Informationen über die verschiedenen Verfahren vermitteln und die aktuelle Diskussion der Ansätze darstellen, sondern auch dazu beitragen, dass eine Kooperation von Betroffenen, ihren Angehörigen und Professionellen zunehmend besser gelingt.
Alle Autoren fühlen sich einem Menschenbild verpflichtet, dass den grundsätzlichen Anspruch auf Selbstbestimmung und Autonomie betont und darum auch in Therapie und Förderung die Bedeutung von Eigenaktivität gegenüber normorientierten, direktiven Verfahren vertritt. In allen Beiträgen geht es deshalb um die günstige Gestaltung förderlicher Bedingungen, die das einzelne Kind bzw. den Erwachsenen unterstützen, seine Kompetenzen unter den gegebenen behinderungsspezifischen Beeinträchtigungen und den kontextbezogenen Aktivitäts- und Partizipationsmöglichkeiten zu entwickeln.
Unterstützte Kommunikation
Mit Unterstützter Kommunikation werden alle pädagogischen und therapeutischen Hilfen bezeichnet, die Personen ohne oder mit erheblich eingeschränkter Lautsprache zur Verständigung angeboten werden.
Die im internationalen Sprachgebrauch übliche Bezeichnung ergänzende und alternative Kommunikation ist zwar eindeutiger (AAC = Augmentative and Alternative Communication), aber im deutschsprachigen Bereich hat sich der Terminus Unterstützte Kommunikation (U.K.) überwiegend durchgesetzt (vgl. Braun, 1994).
Alternative Kommunikationsformen werden Menschen mit Behinderungen angeboten, die aufgrund fehlender oder erheblich eingeschränkter Sprechfähigkeit statt der gesprochenen Sprache ein anderes Kommunikationssystem benötigen. Dabei handelt es sich überwiegend um Gebärden, graphische Symbole oder Schrift sowie um sehr unterschiedliche technische Hilfen mit und ohne Sprachausgabe.
Unter ergänzender Kommunikation versteht man dagegen Verfahren, die unterstützend bzw. begleitend zur Lautsprache eingesetzt werden. Sie sollen einerseits bei Kindern mit erheblich verzögerter Sprachentwicklung die lange Zeit fehlende lautsprachlicher Verständigung überbrücken und den Spracherwerb fördern und andererseits bei Personen mit schwer verständlicher Sprache das Verstehen erleichtern sowie ergänzend zu nicht normsprachlichen Lauten (z. B. ai oder e-e für nein und mm für ja) eine effektivere Kommunikation ermöglichen.
Es gibt sehr viele und unterschiedliche Ursachen, die zu vorübergehenden, lang anhaltenden oder dauerhaften Beeinträchtigungen der Sprechfähigkeit führen oder auch zum Abbau verbaler Fähigkeiten oder deren Verlust. Deshalb weist die Personengruppe, der Unterstützte Kommunikation angeboten wird, eine große Heterogenität auf, und es ist wichtig, sowohl altersbedingte Faktoren zu berücksichtigen als auch schädigungsspezifische Aspekte, soziale Bedingungen und subjektive Bedürfnisse. Eine zunehmende Bedeutung hat auch im Kontext von Unterstützter Kommunikation die Berücksichtigung der besonderen Bedingungen bei Zwei- oder Mehrsprachigkeit und der Lebenswelt bezogenen Relevanz der jeweiligen Sprache.
Von besonderer Bedeutung ist der Zeitpunkt, wann die sprachbeeinträchtigende Schädigung erfolgte. So ist es ein Unterschied, ob die Behinderung von Geburt an oder doch in sehr jungen Jahren und damit vor oder im Erwerb der Lautsprache sich auswirkte oder erst erfolgte, nachdem Sprechen und andere Sprachkompetenzen bereits erworben und gefestigt wurden – einschließlich schriftsprachlicher Fähigkeiten.
Die Ausführungen in diesem Buch beziehen sich auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die aufgrund früh erfolgter Schädigungen eine erhebliche Behinderung erlitten haben, die sich als motorische, kognitive oder emotionale Beeinträchtigung in einem oder mehreren Entwicklungsbereichen auswirkte und bei denen dadurch sehr unterschiedlich ausgeprägte Einschränkungen im Erwerb kommunikativer und sprachlicher Kompetenzen verursacht wurden und bei denen insbesondere das Sprechen deshalb oft nicht oder nur erheblich eingeschränkt möglich ist oder sich erheblich verzögert entwickelt.
Angemessene Hilfen für Jugendliche und Erwachsene, bei denen zu einem späteren Zeitpunkt infolge von Krankheit (Schlaganfall, ALS) oder Unfall eine Einschränkung ihrer Verständigungsfähigkeit aufgetreten ist, müssen berücksichtigen, dass diese Personen aufgrund normaler Entwicklung und biographischer Erfahrung bereits entsprechende Kompetenzen erworben haben und deshalb oftmals auch andere Verfahren und Hilfsmittel benutzen können.
Kommunikation, Sprache und Sprechen
Obwohl im allgemeinen Sprachgebrauch die Begriffe Kommunikation, Sprache und Sprechen oft wenig differenziert werden, haben sie doch recht unterschiedliche Bedeutung und gerade für das Verständnis der vielfältigen Probleme, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit speziellen Beeinträchtigungen haben, ist eine Unterscheidung sehr wichtig.
Mit Kommunikation bezeichnen wir alle Verhaltensweisen und Ausdrucksformen mit denen wir mit anderen Menschen bewusst oder unbewusst in Beziehung treten 1 1 Eine Überdehnung des Begriffes auf alle Formen von Aktivität ist jedoch problematisch. Kommunikation ist eingebunden in wechselseitige personale Beziehungen – auch wenn noch keine Intentionalität vorliegt. Es ist deshalb fraglich, ob z. B. von pränataler Kommunikation gesprochen werden kann.
. Kommunikation umfasst deshalb viel mehr als nur die verbale Sprache.
So können Nähe und Distanz Vertrautheit oder Befremden ausdrücken; mit Berührung, Anfassen und Anblicken können Interessen deutlich werden. Kummer, Schmerz, Freude oder Wut zeigt sich mit entsprechender Mimik. Auch Körperhaltung, Erblassen und Erröten oder verweinte Augen können etwas über unser Befinden aussagen, erfordern aber eine kontextbezogene Interpretation. Zustimmendes oder ablehnendes Kopfnicken bzw. -schütteln oder Achselzucken ist situationsabhängig zu verstehen. Wie wir uns anziehen – ob festlich oder sportlich, Trauerkleidung, typische Trend- oder Peergruppenmode – drückt Vorhaben, eine bestimmte Stimmung oder auch Einstellung aus. Mit Gestik betonen wir unsere Ansichten, lenken das Interesse, zeigen Emotionen und verdeutlichen Gesagtes. Schon das kleine Kind zeigt – wenn auch ohne entsprechende Intention – mit seinem Verhalten seine Bedürfnisse, Vorlieben, Schmerz und Abneigung.
Читать дальше