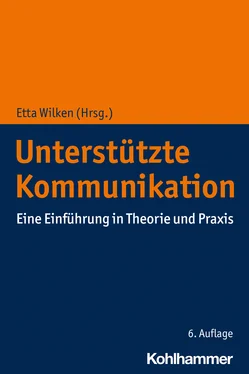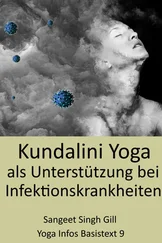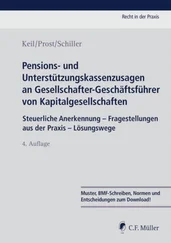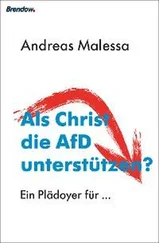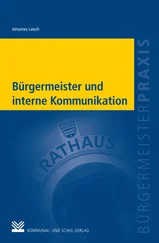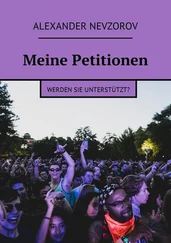Roth, S. (2017): Eine Welt voller Gründe, glücklich zu sein. In: ZEIT Magazin vom 22.6., 15–23
Wetzel, J. (2000): Erfassung der Kommunikationsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern einer Heim-Sonderschule für Geistigbehinderte. In: ISAAC (Hrsg.): Unterstützte Kommunikation mit nichtsprechenden Menschen. Karlsruhe
Wilken, E. (2014): Sprachförderung bei Kindern mit Down-Syndrom. Stuttgart
Wilken, E. (2000): Statistische Erhebung zur Schülerpopulation an Sonderschulen und Tagesstätten für geistig Behinderte in Niedersachsen. Unv. Umfrage
Wilken, E. (1982): Verstehst du mich? In: Zusammen, 7, 6–9
Wilken, E. (1974): Das Fingeralphabet als Kommunikationshilfe bei einem zerebralparetischen und gehörlosen Jungen. In: Heese, G./Reinartz, A. (Hrsg.): Aktuelle Beiträge zur Körperbehindertenpädagogik. Berlin
1Eine Überdehnung des Begriffes auf alle Formen von Aktivität ist jedoch problematisch. Kommunikation ist eingebunden in wechselseitige personale Beziehungen – auch wenn noch keine Intentionalität vorliegt. Es ist deshalb fraglich, ob z. B. von pränataler Kommunikation gesprochen werden kann.
Diagnose der Verständigungsfähigkeit bei nicht sprechenden Kindern
Gudrun Kane
Kinder entwickeln ihre Verständigungsfähigkeit im Kontakt mit ihren Bezugspersonen. Zwar spielt in der Sprachentwicklung die Veranlagung eines Kindes eine sehr wichtige Rolle, doch hat auch die Umwelt großen Einfluss (Chapman 2000). Die affektive Beziehung zum Kind, die Häufigkeit, mit der mit ihm gesprochen wird, die Abstimmung des Gesagten mit dem Aufmerksamkeitsfocus des Kindes und das Eingehen auf seine Äußerungen sind einige wichtige Faktoren. Und bei einer Diagnose sollte stets auch betrachtet werden, welche Anregungen und Lernmöglichkeiten ein Kind in seinem natürlichen Umfeld vorfindet. Bei dieser Arbeit aber steht das Kind selbst im Mittelpunkt, dieser Ansatz betrachtet seine Verständigungsmöglichkeiten vor dem Beginn der Sprache.
Die Entwicklung der Verständigungsfähigkeit hängt mit einer Vielzahl von anderen Fähigkeiten zusammen, die die meisten Kinder im Laufe der ersten beiden Lebensjahre erwerben (Kane 1992). An dieser Stelle sollen zwei Bereiche genauer betrachtet werden, die eng mit der Verständigungsfähigkeit zusammenhängen, Kommunikation und Kognition. Im Bereich der Kommunikation lernt ein Kind, dass es Wünsche und Interessen mitteilen kann, seine Mitteilungen verstanden und beantwortet werden, und dass es diese Mitteilungen durch Übernahme in seiner Kultur üblicher Formen effektiver gestalten kann. Im Bereich der Kognition erwirbt das Kind z. B. die Grundlage für den Umgang mit Symbolen, für die Nachahmung spezifischer Mitteilungsformen durch Gesten oder Worte und für die Verwendung von Kommunikation als Mittel zum Erreichen von Zielen. Man geht heute davon aus, dass die Entwicklung in den beiden Bereichen eng zusammenhängt und sich gegenseitig beeinflusst. Deshalb sollte eine Diagnose der Verständigungsfähigkeit bei nicht sprechenden Kindern stets beide Bereiche erfassen.
Diagnose der Kommunikationsentwicklung
Schon lange vor dem Beginn des eigentlichen Sprechens kommunizieren Kinder mit vielfältigen Mitteln. Vom ersten Lebenstag an »verstehen« Eltern ihre Kinder anhand ihrer Reaktionen auf ihre Befindlichkeit und auf Umwelteinflüsse. Eltern erkennen, wann Kinder hungrig oder müde sind und welche Formen der Ansprache sie mögen, lange bevor das Kind selbst um seine Bedürfnisse weiß. Typischerweise wird der Beginn der Verständigung im ersten Schrei eines Kindes gesehen, wie es Buchtitel wie »Vom ersten Schrei zum ersten Wort« (Kluge 1997; Papousek 1998) deutlich machen. Doch schon in den ersten Lebenstagen teilt sich ein Kind nicht nur stimmlich mit, sondern auch durch Körpersignale, wie Anspannung und Entspannung, Ruhe oder Unruhe, Hin- oder Wegschauen, und Eltern verstehen diese Signale. Die Entwicklung der Verständigung findet entsprechend nicht nur im Bereich der Laute statt, sondern ganz wesentlich auch im Bereich von Blick und Gestik, und es gibt eine Reihenfolge, in der Kinder kommunikative Fähigkeiten erlernen.
Kane (1992) beschreibt den Entwicklungsweg von den frühen Anzeichen für Befindlichkeit zur gezielten Kommunikation von Wünschen oder Interessen mit Worten oder Gebärden. Diesen Entwicklungsweg gehen auch Kinder mit erschwerter Entwicklung der Verständigungsfähigkeit, und das Erkennen des gegenwärtigen Entwicklungstandes und Niveaus hilft abzuklären, wo auf diesem Weg das Kind im Moment steht. Hieraus lässt sich z. B. erkennen, wo eine Kommunikationsförderung ansetzen könnte, bzw. ob ein Kind im Bereich der Kommunikation die Voraussetzungen für eine gezielte Sprach- bzw. Gebärdenförderung beherrscht. Denn es ist davon auszugehen, dass ein bestimmtes Kommunikationsniveau Voraussetzung für eine Verständigung mit sprachlichen oder nichtsprachlichen Symbolen ist. Die Diagnostik der Verständigungsfähigkeit ist möglich über eine gezielte Verhaltensbeobachtung. Hierzu wurde von Rotter, Kane und Gallé (1992) ein Beobachtungsverfahren entwickelt, das im Folgenden kurz beschrieben werden soll.
Ziel der Beobachtungen ist die Beschreibung des Verhaltens in kommunikativen Situationen. Hierzu werden Situationen vorgegeben, die das Kind zu kommunikativen Reaktionen anregen sollen. Reaktionen auf die kommunikationsauslösenden Situationen können Stufen der Kommunikationsentwicklung zugeordnet werden, um so den Entwicklungsstand eines Kindes zu beschreiben. Dabei geht es vor allem um die Beschreibung seines »typischen« Kommunikationsverhaltens, weniger um nur vereinzelt gezeigte »maximale« Leistungen.
Kommunikationsauslösende Situationen
Als Kommunikationsanlass werden relativ lebensnahe Situationen vorgegeben, die bei den meisten Kindern eine Reaktion mit Kommunikationscharakter hervorrufen. Dabei hängt die Art einer Mitteilung wesentlich mit dem Ziel zusammen, das erreicht werden soll, also mit ihrer Funktion. Allerdings ist die Funktion nicht immer eindeutig erkennbar, deshalb wird bei diesen Beobachtungen die Funktion über die auslösende Situation und nicht über ein spezifisches Verhalten definiert. In der frühen Kommunikation stehen vor allem drei Funktionen im Vordergrund:
• das Fordern von Gegenständen oder Handlungen
• das Kommentieren von Ereignissen
• Protest.
Fordern wird wahrscheinlich, wenn beim Kind ein Wunsch geweckt wird, den es sich nicht allein erfüllen kann. Liegt ein interessanter Gegenstand außer Reichweite, so liegt nahe, dass das Kind mit seinem Verhalten seinen Wunsch im Sinne eines »Gib ihn mir« signalisiert. Ein interessantes Spielzeug oder eine Flasche mit dem Lieblingsgetränk sind gut geeignet, diesen Wunsch auszulösen
Lässt sich der Gegenstand nur mit einer Handlung nutzen, die das Kind nicht alleine ausführen kann, so kann sein Verhalten diese Handlung vom Erwachsenen einfordern. Ein Luftballon muss aufgeblasen werden, Seifenblasen sollen fliegen oder die Flasche mit dem Lieblingsgetränk ist so fest verschlossen, dass nur die Erwachsene sie öffnen kann. Allerdings setzt das Fordern einer Handlung voraus, dass das Kind weiß, dass die entsprechende Handlung, z. B. Flasche öffnen, Mittel ist zum Zweck, den Saft aus der Flasche zu bekommen.
Kommentieren ist am ehesten zu beobachten, wenn ein Kind etwas Interessantes sieht oder hört und diese Erfahrung mit einer Erwachsenen teilen möchte. Erklingt plötzlich ein Glockenspiel, fällt ein Aufziehmotorrad vom Tisch oder leuchten bunte Lichter auf, so kann dies ein Kind dazu anregen, die Erwachsene auf diese Ereignisse hinzuweisen (z. B. durch Zeigen oder durch »oh«), oder sein Interesse durch das Pendeln des Blicks zwischen Ereignis und Erwachsener mitzuteilen.
Protest kann man auslösen, indem man einem Kind unbeliebte Aktivitäten oder Gegenstände anbietet, oder ihm etwas fortnimmt, an dem es Interesse zeigt. Vielleicht verwundert es, dass bei dieser Diagnostik Protest gezielt provoziert werden soll, da ja gerade in der Arbeit mit behinderten Kindern oft der Wunsch nach Kooperation im Vordergrund steht. Doch für ein selbstbestimmtes Leben ist das »Nein-Sagen« ebenso wichtig wie das Fordern oder die Äußerung von Zustimmung. Außerdem haben manchmal »störende« Verhaltensweisen wie Schreien, Aggressionen und auch Selbstverletzung die Funktion von Protest. Gerade deshalb ist es wichtig abzuklären, welche Verhaltensweisen ein Kind in Protest anregenden Situationen zeigt.
Читать дальше