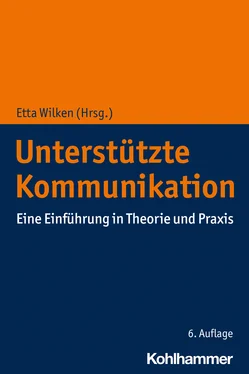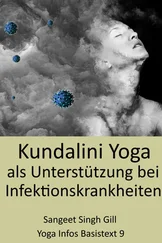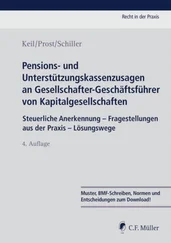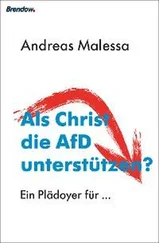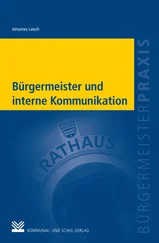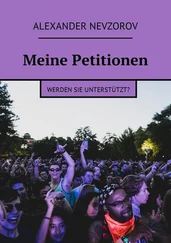Alle diese Formen der Kommunikation sind vorwiegend nur situationsgebunden zu verstehen und bedürfen der besonderen Interpretation. Dabei werden innerhalb enger personaler Beziehungen, in einem Kulturbereich oder in der gleichen Peer-Gruppe diese verschiedenen Zeichen noch relativ gut verstanden, aber bei größerer Distanz, stärkeren Normabweichungen oder speziellen Beeinträchtigungen wird die erforderliche Interpretation oft erschwert und kann leicht misslingen. Deshalb können sich durch abweichende mimische, gestische und körpersprachliche Kommunikationsformen nicht nur in internationalen Beziehungen Störungen ergeben, sondern es gilt zu bedenken, dass auch Kinder mit migrationsbedingten anderen Erfahrungen verunsichert auf scheinbar allgemein verständliche »Kommunikationskulturen« reagieren können.
Zu den wichtigen individuellen Grundlagen der Kommunikation gehören – mit unterschiedlicher Relevanz – die sensorischen Fähigkeiten Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Riechen, aber auch kinästhetische, propiozeptive und vestibuläre Wahrnehmung. Gelernt werden muss dabei die spezielle erfahrungsgebundene Bedeutungsgebung dieser über die Sinne aufgenommenen Eindrücke und ihre Koordinierung sowie »Sensorische Integration«.
Auch die mögliche Einflussnahme durch Blickkontakt, mimischer und gestischer Ausdruck, das abwechselnde Handeln in Interaktionen (turn-taking) sowie das Einhalten von alters- und kulturtypischem Kommunikationsabstand (Proxemik) zählen zu den basalen Kompetenzen, die in sozialen Beziehungen erworben werden.
Sprache ist ein speziesspezifisches Kommunikationssystem, das auf festgelegten Symbolen beruht. Gleich ob es sich dabei um Gebärden, Wörter oder optische Zeichen handelt, repräsentieren diese Symbole die Dinge, Handlungen, Abfolgen und Beziehungen. Sprache ist eine wesentliche Grundlage für das bedeutungsbezogene Verarbeiten von Wahrnehmungen, damit flüchtige Sinneseindrücke gespeichert werden können. Sie ist wichtig für das Vergleichen und Bewerten, für das Erinnern sowie die Bildung von Kategorien und sie ist eine wesentliche Voraussetzung für vielfältige kognitive Leistungen.
Allerdings sind diese Funktionen nicht gebunden an die Lautsprache, sondern an das Vorhandensein eines differenzierten Symbolsystems. Deshalb können Menschen ohne Lautsprache auch mit anderen Sprachsystemen wie Gebärden, Symbolsysteme oder Sprechausgabegeräte entsprechende kognitive Fähigkeiten entwickeln. Deshalb sind ein gutes Sprachverständnis und eine normale Sprachkompetenz – wie zahlreiche Beispiele belegen – keineswegs abhängig von der Sprechfähigkeit (vgl. Nolan 1989, Lemler 2013).
Als eine wesentliche Voraussetzung für das Erlernen von Sprache gilt die Bereitschaft zur sozialen Interaktion, die Entwicklung von Objektpermanenz und ein gewisses Symbolverständnis. Mit dem differenzierten Aufbau des Vokabulars (Lexik) ist auch die genaue Bedeutung zu erwerben (Semantik). Dabei unterstützt die Betonung (Prosodie) ganz wesentlich das Verstehen, wie das Gesagte gemeint ist (Lob, Tadel, Zweifel, Ironie). Auch die verschiedenen grammatischen Strukturen (Fragen, Passivsätze) müssen verstanden werden. Unabhängig vom Kontext ist zu lernen, sprachliche Mitteilungen zu erfassen und angemessen darauf zu reagieren (Pragmatik).
Sprechen bezeichnet das Produzieren der hörbaren Sprache. Dazu ist erforderlich, dass die sprachtypischen Normlaute gebildet, zu Wörtern verbunden und bedeutungsbezogen benutzt werden. Sprechen ist ein besonders effektives und differenziertes Mittel der Kommunikation. Das Erlernen erfordert sowohl vielfältige basale Voraussetzungen als auch spezielle motorische und kognitive Fähigkeiten.
Für die normale Realisierung von Sprechen sind viele verschiedene Aspekte wichtig. So müssen die einzelnen Laute korrekt gebildet werden (Artikulation), bei der Wortfolge und Satzstruktur sind Regeln zu beachten (Syntax) und mit den geäußerten Wörtern werden Absichten verbunden (Pragmatik). Auch die Sprechfüssigkeit (Stottern, Poltern), die Lautstärke, Betonung (Prosodie) und Resonanz (Näseln) sind wichtig für eine ungestörte Kommunikation.
Ein besonderer Aspekt bezieht sich auf Regeln der Konversation. So ist zu beachten, wie und wann Nachfragen gestellt werden können und wann ein Sprecher unterbrochen werden darf, wie ein Gespräch begonnen, ein Thema bestimmt oder gewechselt werden kann. Missverständnisse müssen korrigiert und unterschiedliche Annahmen geklärt werden können. Die (Vor)Kenntnisse des Gesprächspartners bei einem Thema sind zu berücksichtigen. Auch gilt es angemessene Höflichkeitsformen zu beachten – das bezieht sich auch auf situationsgerechte Wortwahl und das Verwenden von typischen Peer-Gruppenausdrücken.
Bedeutung hat auch das Verhältnis von Gesprächsthema und aktueller Tätigkeit. Während beim kleinen Kind gemeinsame Gespräche überwiegend kontext- und handlungsgebunden sind, indem wir verbalisieren, wohin das Kind blickt oder womit es sich gerade beschäftigt oder indem wir eigene Tätigkeiten kommentieren, löst sich mit zunehmendem Alter des Kindes das Gespräch von der aktuellen Handlung und von der Situation (so kann beim gemeinsamen Kochen über einen Film gesprochen werden oder beim Essen über Erlebnisse in der Schule).
Auswirkung von Behinderung auf Verstehen und Verständigung
Behinderungen können bereits zu Veränderungen der basalen Grundlagen von Kommunikation und Sprache führen. Sie können die kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigen, die Motivation und das Bedürfnis, sich mitzuteilen, oder sie beziehen sich nur auf den motorischen Bereich. Manchmal sind allerdings alle verschiedenen Aspekte betroffen.
Deshalb ist es notwendig, die individuellen Voraussetzungen und Möglichkeiten zu erfassen und die Bedürfnisse und Interessen des Kindes und seiner Bezugspersonen zu erkennen, um geeignete Hilfen anzubieten. Dabei ist wichtig, eine zu enge Zielsetzung bezüglich der verbalen Sprache zugunsten einer möglichst effektiven Kommunikationsfähigkeit zu überwinden.
Die Kompetenzen von Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen der Lautsprache weisen eine große Streubreite auf, von eingeschränkter kontextgebundener präintentionaler Kommunikationsfähigkeit bis zu völlig normalem Sprachverständnis. Für alle Kinder gilt jedoch, dass die allgemeinen Fähigkeiten meistens deutlich weiter entwickelt sind als das Sprachverhalten vermuten lässt. Deshalb kommt es häufig zu einer erhebliche Unterbewertung der kognitiven Fähigkeiten, und nicht nur Erwartungen und Ansprüche der Bezugspersonen werden reduziert, sondern diese Fehleinschätzung und die dadurch bedingte Unterforderung kann auch die Motivation und Mitteilungsbereitschaft des behinderten Kindes einschränken.
Der Spracherwerb bei Kindern mit gravierenden Behinderungen der motorischen und/oder der geistigen Entwicklung ist fast immer mehr oder minder stark verzögert. Dadurch erfolgt jedoch nicht nur eine langsamere Entwicklung, sondern durch die dissoziierte Ausprägung von Fähigkeiten aufgrund von schädigungsbedingten und ätiologiespezifischen Veränderungen kann auch die normale wechselseitige Beeinflussung der verschiedenen Entwicklungsbereiche behindert bzw. nicht in gleicher Weise aktiviert werden. Zusätzlich zu diesen unmittelbaren Beeinträchtigungen haben viele behinderte Kinder auch Störungen des Sehens und Hörens sowie Wahrnehmungsschwächen in visuellen, auditiven, taktilen und kinästhetischen Bereichen, die eine bedeutungsbezogene Verarbeitung von Informationen erschweren und Erfahrung und Lernen in spezifischer Weise verändern können und dadurch zu erheblichen Auswirkungen auf den Spracherwerb führen.
Diese verschiedenen möglichen Störungen der unmittelbaren oder sekundären Grundlagen der sprachlichen Entwicklung bei Menschen mit Behinderungen können differenziert werden nach sensorischen, motorischen, emotionalen und kognitiven Voraussetzungen.
Читать дальше