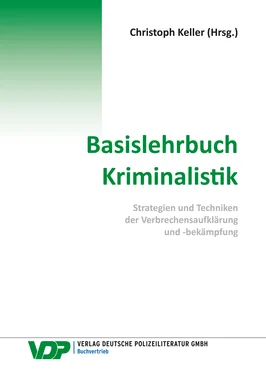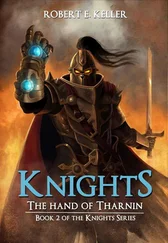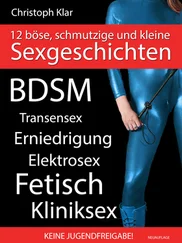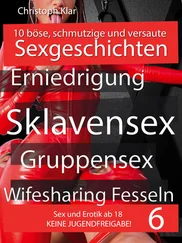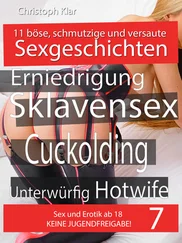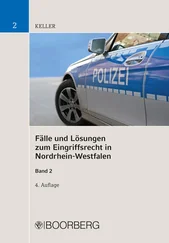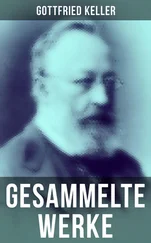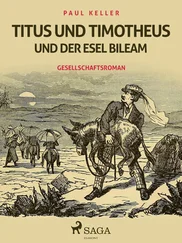Der Urkundsbeweis besteht in der Auswertung des Gedankeninhaltes von Schriftstücken, § 249 StPO. Ist nicht der Gedankeninhalt, sondern sind Sachgegebenheiten eines Schriftstückes beweiserheblich, z.B. die Altersbestimmung, ist das Schriftstück nicht Urkunds-, sondern Augenscheinsbeweis. Der Urkundsbeweis ist nur und ausschließlich in den von der StPO vorgesehenen Versagungsgründen verboten. Dies ist z.B. in § 250 StPO für sinnliche Wahrnehmungen von Zeugen der Fall, die (selbst und unmittelbar) in der Hauptverhandlung aufgerufen werden müssen, die Ersetzung durch eine Protokollverlesung kommt nur unter den Voraussetzungen des § 251 StPO in Betracht.
Die Stellung des Zeugen im Strafverfahren ist wesentlich geprägt durch seine Eigenschaft als persönliches Beweismittel. Als solches hat er in erster Linie Auskunft über seine Wahrnehmungen von einem in der Vergangenheit liegenden tatsächlichen Vorgang zu geben. In Bezug auf die Kundgabe seiner Wahrnehmungen ergeben sich für den Zeugen im Wesentlichen drei Pflichten: 82
•Erscheinungspflicht gemäß § 48 Abs. 1 StPO
•Aussage- und Wahrheitspflicht gemäß §§ 48 Abs. 1, 57 StPO
•Beeidigungspflicht gemäß §§ 57, 59 ff. StPO.
Ein Zeuge ist eine Person, die in einem Strafverfahren ihre Wahrnehmungen über Tatsachen durch Aussage kundgeben soll, ohne durch eine andersartige Verfahrensrolle von dieser Position ausgeschlossen zu sein. Der Beschuldigte kann daher nicht Zeuge sein; ebenso wenig kann ein Mitbeschuldigter Zeuge über den Tatbeitrag eines anderen Beschuldigten sein. 83Der Betroffene muss sich nicht unbedingt als Zeuge offenbaren. Auch durch logische Schlussfolgerung kann jemand als Zeuge in Betracht kommen (z.B. Beifahrer in einem Unfallfahrzeug).
Wer nichts aussagen kann, sondern nur in Augenschein genommen werden soll, ist kein Zeuge. Zeuge in einem Strafverfahren kann jeder sein, ohne Rücksicht auf Alter, geistige Fitness, Beruf o.Ä.
Zum besseren Verständnis der Struktur der Zeugenaussage ist vom Begriff des Beweismittels der Begriff der Beweistatsache zu unterscheiden. „ Beweistatsachen“ sind konkrete Geschehnisse, Umstände und Zustände der äußeren Welt, innerpsychische Vorgänge und Gegebenheiten und das Bestehen oder nicht Nichtbestehen von Zusammenhängen. Mit dem Beweismittelsoll die Beweistatsache bewiesen werden. Unter Beweiszielwird der Nachweis eines unter ein gesetzliches Tatbestandsmerkmal subsumierbares (oder gerade nicht subsumierbares) Geschehen verstanden. Beweistatsache und Beweisziel bilden in Kombination das Beweisthema.
Beispiel: 84T schlägt nachts dem O mit der Faust ins Gesicht. Z hat den Vorgang von seinem Balkon aus beobachtet.
| •Beweisziel: |
Nachweis des Faustschlags von T gegen O, da dieser Vorgang den Tatbestand der Körperverletzung (§ 223 StGB) erfüllt |
| •Beweistatsache: |
Wahrnehmungen des Z |
| •Beweismittel: |
Zeugenaussage in der Hauptverhandlung |
Der Zeugenbeweis wird durch die Vernehmung des Zeugen zur Sache erhoben. Die Zeugenaussage ist Beweismittel. Gegenstand des Zeugenbeweises sind die Wahrnehmungen des Zeugen. Damit ist der Gegenstand der Zeugenaussage in zweierlei Hinsicht abzugrenzen. Zum einen gehören dazu nicht Meinungen oder Werturteile, Prognosen über künftige Entwicklungen oder Schlussfolgerungen. Zum anderen sind aber auch die wahrgenommenen Vorgänge selbst nicht Gegenstand der Zeugenaussage. 85
Der sachverständige Zeuge (§ 85 StPO) ist eine Sonderform des Zeugenbeweises. Er bekundet Tatsachen, für deren Wahrnehmung eine besondere Sachkunde erforderlich ist.
§ 85 StPO verweist auf die Vorschriften über den Zeugenbeweis. Dadurch wir klargestellt, dass der sachverständige Zeuge eben nicht Sachverständiger ist, sondern nur Zeuge mit einer besonderen Sachkunde. Demnach wird der Sachverständige Zeuge auch nicht bestellt, und er kann auch im Verfahren nicht abgelehnt werden. 86
Der Beschuldigte (Angeschuldigter oder Angeklagter) zählt zwar nicht zu den förmlichen Beweismitteln im Strafprozess, seine Aussagen oder Einlassungen zur Sache, z.B. das Geständnis oder Aussagen zu seiner Entlastung, gehen jedoch in die Beweisführung und die Beweiswürdigung ein. Der Beschuldigte ist insoweit Beweismittel i.w.S. Damit wird dem Rechtsgrundsatz Rechnung getragen, dass dem Beschuldigten Gelegenheit gegeben werden muss, zu den gegen ihn erhobenen Beschuldigungen Stellung zu nehmen und zu seiner Entlastung beizutragen. 87
Beschuldigter ist der Tatverdächtige, gegen den das Verfahren betrieben wird. Der Verdächtige ist zum Beschuldigten zu machen, sobald gegen ihn ermittelt wird. Das ist der Fall, wenn ein Strafverfolgungsorgan eine Maßnahme getroffen hat, die erkennbar darauf abzielt, wegen einer möglichen Straftat gegen diese Person vorzugehen. 88Die Person muss ernstlich als Täter der untersuchten Straftat in Betracht kommen. Liegt „nur“ die vage, entfernte Möglichkeit einer Täterschaft vor (Person ist verdächtig, aber für eine Beschuldigung reichen die Fakten noch nicht), wird die Person zunächst als Zeuge zu vernehmen sein. 89Das dürfte der Fall sein, wenn jemand anonym angezeigt wird.
Beschuldigt werden kann nur, wer rechtswidrig und schuldhaft eine prozessual verfolgbare Tat begangen hat. Kinder unterliegen keinen strafrechtlichen Sanktionen (§ 19 StGB); sie können daher nicht zu Beschuldigten gemacht werden. 90Auch wer eine rechtswidrige Tat im Zustand der Zurechnungsunfähigkeit (§ 20 StGB) begangen hat, ist nicht Beschuldigter. Vermindert schuldunfähige Personen handeln schuldhaft; denn § 21 StGB ist nur ein Strafmilderungsgrund.
Kriminalistisch ist die Beschuldigtenaussage u.a. von Bedeutung, um von dem Beschuldigten Angaben über die Tat und die Art seiner Tatbeteiligung zu erlangen, so z.B. sein Geständnis. Darüber hinaus können über seine Aussage weitere Ermittlungsansätze zur Aufklärung der Tat oder der Täterschaft erlangt werden. 91
Im Strafermittlungsverfahren geht es zum einen um die Aufklärung einer Straftat, zum anderen um gegen den Verdächtigen eine strafgerichtliche Verurteilung zu erreichen. Dabei ist ein justizförmiges faires Strafverfahren zu wahren. Im Ermittlungsverfahren müssen verwertbare Beweise gewonnen werden. Beweisergebnisse, die unter einem Verstoß gegen das justizförmige Verfahren leiden, können einem Beweisverwertungsverbot unterliegen. Das Ziel der polizeilichen Arbeit im Ermittlungsverfahren muss die Gewinnung verwertbarer Beweise sein.
Beweisverbote ist der Oberbegriff für Beweiserhebungs- und Verwertungsverbote. 92
Ein Beweiserhebungsverbot (Beweisgewinnungsverbot) normiert die Unzulässigkeit einer Ermittlungshandlung und begrenzt die aus § 244 Abs. 2 StPO folgende Amtsaufklärungspflicht, führt aber nicht immer automatisch dazu, dass das Beweismittel gesperrt ist.
Bei den Beweiserhebungsverboten werden unterschieden
•Beweisthemaverbote,
•Beweismittelverbote und
•Beweismethodenverbote.
Die Aufklärung bestimmter Sachverhalte ist unzulässig. Die Erörterung bestimmter bereits getilgter Vorstrafen ist z.B. ein unzulässiges Beweisthema (§ 51 BZRG). 93
Bestimmte Beweismittel dürfen nicht eingesetzt werden, z.B. die Ersetzung des Personalbeweises durch den Urkundenbeweis in § 250 Satz 2 StPO. Zu dieser Gruppe der Beweismittelverbote gehören auch die zahlreichen Zeugnis- und Untersuchungsverweigerungsrechte (§§ 52 ff., 81c Abs. 3 StPO). Die Aufklärung des Sachverhalts mit anderen Beweismitteln bleibt zulässig.
Читать дальше