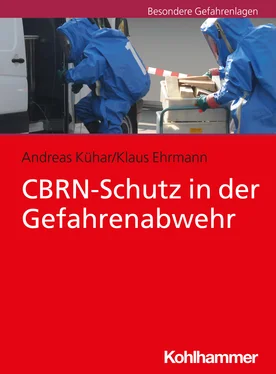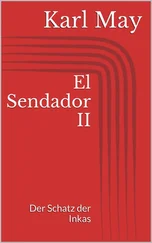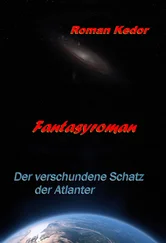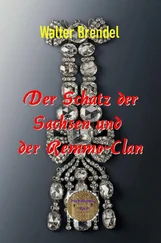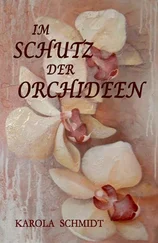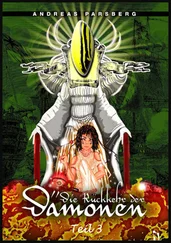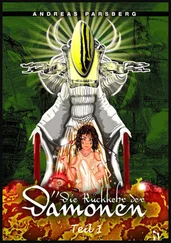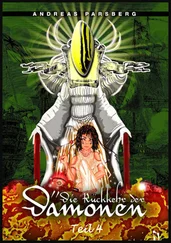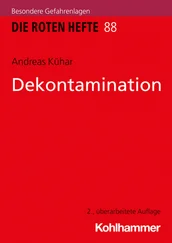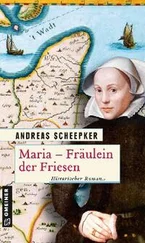Nach dem Eindringen in den Wirtsorganismus verbreiten sich verschiedene Mikroorganismen über die Blutbahn oder das Lymphsystem im Körper, während andere lokal wirken. Innerhalb des Wirtskörpers muss ein Pathogen dem Abwehrsystem des Wirts widerstehen können. Das Immunsystem richtet sich sowohl selektiv als auch unspezifisch gegen körperfremde Stoffe. Pathogene Mikroorganismen können dabei durch gegen sie gerichtete Enzyme biologisch abgebaut als auch durch Abschotten von anderen Körperbereichen unschädlich gemacht werden. Gegen die Immunabwehr des Wirtsorganismus haben Erreger verschiedene Methoden entwickelt. Rickettsien (Auslöser des Fleckfiebers) verstecken sich im Zytoplasma ihrer Wirtszellen. Verschiedene Viren verstecken ihr Erbgut durch Einschleusen in die DNA der Wirtszelle. Wird die Gastzelle durch äußere Einflüsse geschwächt, beginnt der Virus, die Zelle umzuprogrammieren (Herpes-simplex-Viren).
Das Vermögen eines Pathogens, nach einer Infektion tatsächlich eine Krankheit auszulösen, wird als Virulenz bezeichnet. Die Virulenz stellt dabei einen quantitativen Begriff der Pathogenität dar, der nicht an absolute Zahlen gekoppelt werden kann. Die Virulenz wird durch die Infektionsdosis ID 50(nicht zu verwechseln mit der handlungsunfähig-machenden Dosis (Incapacitating Dose, ID) bei chemischen Gefahrstoffen) ausgedrückt. Das ist die Erregeranzahl, deren Aufnahme bei 50 Prozent einer Population zu einem Krankheitsausbruch führt. Je kleiner die Infektionsdosis eines biologischen Agens, desto größer ist sein Vermögen, eine Krankheit auszulösen und damit seine Virulenz.
Tabelle 14: Virulenz verschiedener Infektionskrankheiten

MikroorganismusKrankheitInfektionsdosis ID50
Ein wesentlicher Faktor für die Infektionsdosis ist der Aufnahmeweg in den Körper. Beispielsweise ist bei Aufnahme über den Magen-Darm-Trakt eine wesentlich höhere Infektionsdosis erforderlich als bei Inhalation. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Mikroorganismen durch den Kontakt mit der Magensäure abgetötet werden. Virulenz und Infektionsdosis stehen außerdem in Zusammenhang mit dem Abwehrsystem des Wirts. Die Funktion der körpereigenen Immunabwehr kann sowohl individuell als auch in Abhängigkeit von den Lebensumständen unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Zu den Faktoren, die das Immunsystem beeinflussen, gehören Stress, Schlafmangel und Ernährungszustand. Daneben existieren Risikogruppen mit niedrigerer Widerstandskraft, wie Kleinkinder, ältere Menschen, und Menschen mit Erkrankungen des Immunsystems.
Die Zeit vom Kontakt des Erregers mit dem Wirt bis zum Auftreten erster klinischer Symptome wird als Inkubationszeit bezeichnet. Diese Zeitspanne kann in Abhängigkeit vom Erreger einige Stunden bis zu mehreren Jahren betragen. Innerhalb der Inkubationszeit kann der Wirt unbewusst als Infektionsherd fungieren, ohne selbst Symptome zu zeigen. Die Zeitspanne zwischen der Infektion und der Fähigkeit andere zu infizieren, ist die latente Periode.
Infektionskrankheiten, die direkt oder indirekt von Wirbeltieren auf den Menschen übertragbar sind, werden als Zoonosen bezeichnet. 60 Prozent der bekannten Infektionskrankheiten werden zu den Zoonosen gezählt, darunter die Pest, die Tollwut, Milzbrand, Borreliose und Ebola. Neben den bekannten Zoonosen besteht die Gefahr, dass bisher unbekannte Erkrankungen von tierischen Wirten auf den Menschen überspringen können. Eine tierische Population, in der ein Erreger dauerhaft vorkommt, wird als Reservoir bezeichnet. Das Auftreten von Ebola, dem Vogelgrippe-Virus H5N1 und zuletzt SARS-CoV-2 sind aktuelle Beispiele einer Virusübertragung von einem Reservoir auf den Menschen.
3.3 Auftreten biologischer Gefahrstoffe
CBRN-Einsätze mit biologischen Gefahren sind, vom Rettungsdienst abgesehen, eher die Ausnahme. Dennoch muss in zahlreichen Situationen mit biologischen Gefahrstoffen gerechnet werden, beispielsweise:
klinische Bereiche (Isolierstationen),
klinische Labore,
Bereiche mit Versuchstieren,
gentechnische Forschungseinrichtungen,
Betriebe zur Beseitigung von Tierkadavern und Schlachtabfällen,
Tierseuchenausbrüche in landwirtschaftlichen Betrieben,
Transporte von klinischen Proben, Tierkadavern etc.
Der Umgang mit biologischen Gefahrstoffen ist durch die Biostoffverordnung geregelt. Diese versteht unter Biostoffen Mikroorganismen, Zellkulturen und Endoparasiten einschließlich ihrer gentechnisch veränderten Formen sowie Prionen, die im Verdacht stehen, den Menschen durch Infektionen, übertragbare Krankheiten, Toxinbildung, sensibilisierende oder sonstige die Gesundheit schädigende Wirkungen zu gefährden. Ihnen gleichgestellt sind Ektoparasiten, die beim Menschen eigenständige Erkrankungen verursachen oder sensibilisierende oder toxische Wirkungen hervorrufen können und technisch hergestellte biologische Einheiten mit neuen Eigenschaften, die den Menschen in gleicher Weise gefährden können wie Biostoffe. Die Biostoffe sind entsprechend ihres Gefahrenpotenzials in Risikogruppen eingeteilt.
3.3.1 Gentechnisch veränderte Organismen
Das genetische Material von Mikroorganismen ist mit molekularbiologischen Methoden relativ einfach zugänglich. Durch die Veränderung an der DNA bzw. RNA ist es möglich, Mikroorganismen mit neuen Eigenschaften zu gewinnen. Gentechnisch veränderte Organismen (GVO) sind Organismen, bei denen das genetische Material mithilfe molekularbiologischer Methoden in einer Weise verändert worden ist wie es natürlicherweise z. B. durch Kreuzen nicht möglich wäre.
Molekularbiologische Methoden werden heute in vielfältiger Weise angewendet und umfassen zahlreiche Möglichkeiten, um Eigenschaften von Zellen zu modifizieren, zu verstärken, auszuschalten oder Erbmaterial zwischen Mikroorganismen auszutauschen. Zu den Anwendungsbereichen zählen die Herstellung von Arzneistoffen, die medizinische Diagnostik, die Pflanzenzucht und die industrielle Produktion von Enzymen, beispielsweise für Waschmittel. Aktuell ist die Anwendung molekularbiologischer Methoden auf menschliche Zellen gesetzlich beschränkt. Eine zukünftige Anwendung zur Bekämpfung von Erbkrankheiten wird aber diskutiert.
Tabelle 15: Zuordnung der B-Gefahrengruppen gemäß FwDV 500

Gefahren-gruppenRisikogruppe nach BiostoffverordnungSicherheitsstufe nach Gentechnikgesetz
Bei der Entwicklung von GVO und gentechnischen Arbeiten mit ihnen müssen Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden, die in Deutschland durch das Gentechnikgesetz festgelegt und durch die Gentechnik-Sicherheitsverordnung näher ausgeführt sind. So erfolgt das Arbeiten unter einer bestimmten Sicherheitsstufe (S1 bis S4). Dies betrifft den Labor- oder Produktionsbereich (beispielsweise in der Biotechnologie), aber auch Gewächshäuser und Tierhaltungsräume.
Читать дальше