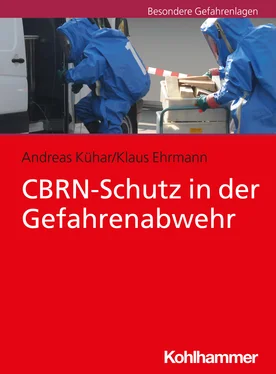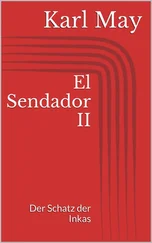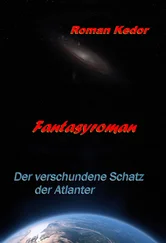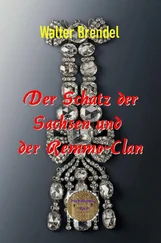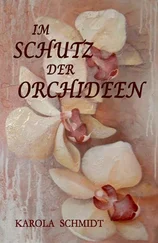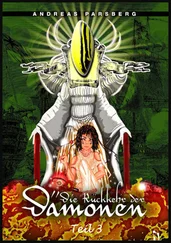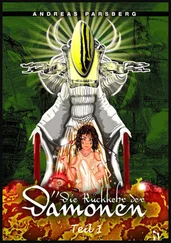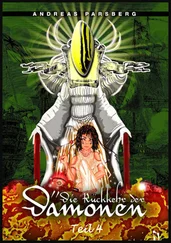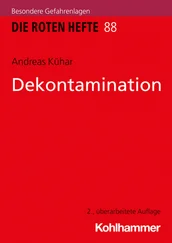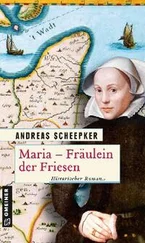Im Grunde sind Toxine chemische Substanzen, die jedoch aus historischen Gründen zu den biologischen Gefahrstoffen gezählt werden (früher war nur eine Synthese durch Lebewesen möglich).
Tiere und Pflanzen produzieren Toxine aus zwei Gründen:
zur Jagd, z. B. Spinnen, Schlangen und Skorpione,
zum Schutz vor Fressfeinden, wie bei der Honigbiene, dem Pfeilgiftfrosch (Batrachotoxin, ein Protein) und dem Kugelfisch (Tetrodotoxin, ebenfalls ein Protein). Beispiele aus dem Pflanzenreich sind der Wunderbaum (Ricin, ein Protein), und der Blaue Eisenhut (Aconitin, ein Alkaloid).
Die Toxine der Schimmelpilze werden Mykotoxine genannt. Zu den Mykotoxin-produzierenden Schimmelarten gehören Aspergillus flavus (Aflatoxin, Befall von Nüssen) und Stachybotrys chartarum (Trichothecene, Gefahr in feuchten Räumen). Die Aufnahme von Toxinen in den menschlichen Körper ist durch Einatmen über die Atemwege oder mit der Nahrung über den Magen-Darm-Trakt möglich. Eine Inkorporation über die intakte Haut ist unwahrscheinlich. Allerdings verfügen viele Gifttiere und -pflanzen über die Möglichkeit, durch Biss oder Stich diese Barriere zu überwinden und das Gift in den Körper zu injizieren. Auch können Toxine durch aufgenommene Bakterien im Körper produziert und freigesetzt werden (z. B. das Tetanustoxin durch Clostridium botulinum).
Während der Sommermonate können sich die, in stehenden Binnengewässern natürlich vorkommenden, Blaualgen (eine Bakterienart) aufgrund zunehmender Temperatur in Kombination mit ausreichenden Nährstoffen explosionsartig vermehren (Algenblüte). Die Bakterien treiben auf der Wasseroberfläche und ähneln dabei einem öligen Teppich. Beim Absterben der Algen werden Giftstoffen freigesetzt, die als Cyanotoxine bezeichnet werden. Daher wird die Wasserqualität der natürlichen Badegewässer während der Sommermonate regelmäßig überwacht.
Die bakteriellen Toxine unterscheiden sich in zwei Arten: Exotoxine und Endotoxine.
Die Exotoxine werden während des Bakterienwachstums ausgeschieden. Vertreter der Exotoxin-produzierenden Bakterien sind Clostridium botulinum (Botulinus-Toxin, oder kurz BTX), Staphylococcus aureus (Enterotoxin, SEB), Clostridium tetani (das Tetanustoxin, TeTN) und Bacillus anthracis (Milzbrandtoxin). Diese hochtoxischen Verbindungen sind allesamt Proteine oder Proteingemische.
Endotoxine sind bei verschiedenen Bakterien Teil der Zellmembran. Bei Absterben der Bakterienzelle werden die Toxine aus der Membran freigesetzt und führen zu heftigen Körperreaktionen. Beispiele für Endotoxin-produzierende Bakterien sind Escherichia coli, Salmonella typhimurium und Shigella dysenteriae. Von Ausnahmen abgesehen sind Exotoxine hitzelabil, Endotoxine dagegen hitzestabil.
Täglich werden durch den Körper zahlreiche Toxine aufgenommen. Bekannte Pflanzentoxine sind das Koffein und das Nikotin. Da deren Aufnahme dosiert erfolgt, kann der menschliche Körper die geringe Toxinmenge abbauen und ausscheiden. Eine Überdosis Koffein oder Nikotin ist dagegen tödlich. Bei Feststellung einer Toxinvergiftung ist die schnellstmögliche Ausscheidung aus dem Körper ausschlaggebend. Erfolgte die Aufnahme über den Magen-Darm-Trakt kann durch das Binden an Aktivkohle die weitere Inkorporation minimiert werden. Für einige Toxine, z. B. verschiedene Schlangengifte, existieren Antiseren.
Prionen sind eine biologische Abnormalität. Bei ihnen handelt es sich um körpereigene Eiweiße, die eine falsche dreidimensionale Struktur aufweisen. Diese Eiweiße können aufgrund der abweichenden Struktur im Körper häufig nicht mehr enzymatisch abgebaut werden. Prionen sind in der Lage, andere Eiweißverbindungen in körperfremde und häufig schädliche Strukturen umzusetzen und sich so zu vermehren. Damit ähneln sie den Viren. Besonders Nerven- und Hirnzellen sind für Schädigungen durch Prionen anfällig.
Beispiele für Prionen-induzierte Krankheiten sind die Creutzfeldt-Jacob-Krankheit beim Menschen, der Rinderwahnsinn (BSE) bei Rindern und Scrapie bei Schafen.
3.2 Medizinische Mikrobiologie
Die Vermehrung körperfremder Erreger in einem Organismus wird als Infektion bezeichnet. Diese muss nicht zwangsläufig für den Wirt schädlich sein. Von einer Krankheit spricht man, wenn der Erreger so starke Schäden verursacht, dass der Wirtsorganismus in seiner Funktion gestört wird. Krankheitsauslösende Erreger werden auch als Pathogene bezeichnet.
Ein pathogener Erreger muss in der Lage sein, von einem Reservoir (Infektionsquelle) zu seinem Wirt zu gelangen, in den Wirtsorganismus einzudringen und der Immunabwehr zu widerstehen, sodass er sich vermehren kann. Der infizierte Wirt kann dabei selbst als Infektionsquelle fungieren und den Erreger über die Atemwege (Schleimtröpfen), den Magen-Darm-Kanal (Faeces), die Harnwege, die Genitalien, die beschädigte Haut sowie über das Blut ausscheiden. Die anschließende Übertragung des Erregers von der Infektionsquelle auf einen neuen Wirt findet durch direkten oder indirekten Kontakt statt. Der so entstehende Kreislauf wird als Infektionskette bezeichnet.

Bild 8: Vereinfachte Darstellung einer Infektionskette
Eine direkte Übertragung von der Infektionsquelle auf den Wirt findet durch Tröpfcheninfektion während des Sprechens, bei Niesen und Husten, durch Hautkontakt beim Händeschütten, bei Sexualkontakten oder von der Mutter auf das ungeborene Kind statt. Bei der indirekten Übertragung ist ein Transportmittel notwendig. Dies können kontaminierte Lebensmittel und Wasser, Gegenstände, z. B. Wäsche, Toiletten, Türklinken oder Ausscheidungen (Urin und Kot, Schleimtröpfchen auf Oberflächen) von infizierten Menschen und Tieren, das Blut infizierter Lebewesen und kontaminierte Injektionsnadeln sein.
Häufig spielen Vektoren wie z. B. Insekten eine wichtige Rolle. Der Erreger wird dabei durch einen lebenden Organismus (ein Vektor) von einem infizierten Tier auf einen Menschen oder ein anderes Tier übertragen. Zu den Vektoren gehören z. B. die Steck- und Sandmücken, Zecken, Fliegen, Flöhe und Läuse. Zum Vektorübertragene Krankheiten gehören z. B. Malaria, Lyme-Borreliose, Pest, Denguefieber, West-Nil-Fieber, Leishmaniose und Trypanosomiasis. Aufgrund des Klimawandels ist zukünftig auch in Europa verstärkt mit vektorübertragenen Krankheiten zu rechnen, die bisher nur in südlichen Ländern auftraten.
Pathogene, die sehr empfindlich auf Umwelteinflüsse wie Sonnenlicht oder Trockenheit reagieren, können nur durch direkten Kontakt übertragen werden. Erreger, die längere Zeit auch außerhalb eines Wirtes überleben, können sowohl direkt als auch indirekt übertragen werden.
Nach der Übertragung muss der Erreger in den Organismus des Wirts eindringen. Die Körperoberfläche bildet dagegen eine natürliche Barriere, die auf physikalischen, chemischen und biologischen Faktoren, wie der mechanischen Barrierefunktion der intakten Haut, ihrem sauren pH-Wert und der Besiedlung der Körperoberfläche mit einer Vielzahl an Mikroorganismen basiert. Verletzungen, Insektenstiche (bei vektorübertragenen Krankheiten) oder mangelhaft desinfizierte Injektionsstellen erleichtern Erregern das Überwinden dieser Barriere. Viele Erreger benötigen spezifische Eintrittspforten, wie die Atemwege, den Magen-Darm-Trakt, die Schleimhäute, die Harnwege oder den Genitalbereich.
Читать дальше