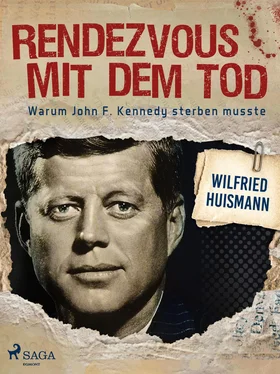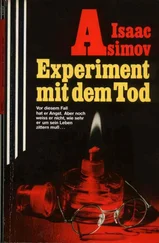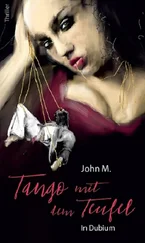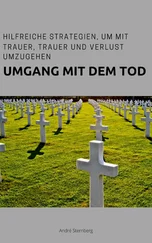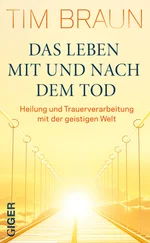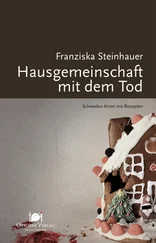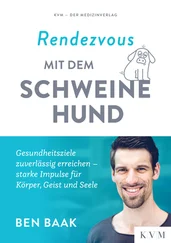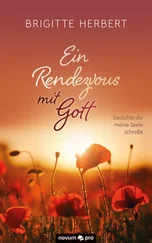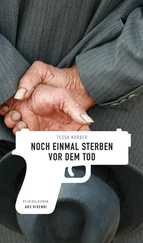»Im Mordfall Kennedy ist Mexiko die Büchse der Pandora.«
Laurence Keenan, FBI
Unten liegt Mexico City im grau-gelben Smog. Schon seit zehn Minuten überfliegen wir ein riesiges Häusermeer. Anfang und Ende der größten Stadt der Welt sind nicht zu erkennen. 26 Millionen Menschen leben in diesem Hexenkessel. Wie soll man darin die Spuren eines schmächtigen Mannes finden, der hier vor über vierzig Jahren mit einem Bus aus New Orleans ankam, um sich als »Soldat der Revolution«, wie er beim Abschied zu seiner Frau Marina gesagt hatte, zu verdingen? Genauso gut könnte man eine Nadel im Heuhaufen suchen. Denn die FBI-Ermittler haben nicht sehr viele Erkenntnisse hinterlassen. Sie bekamen heraus, mit wem Lee Harvey Oswald im Bus nach Mexico City saß, dass er im Hotel Comercio abstieg, in der kubanischen Botschaft einen Visumantrag stellte und wahrscheinlich einen Stierkampf besuchte. Ansonsten verlieren sich Oswalds Spuren im Nichts. Sechs Tage seines Lebens, verschwunden im schwarzen Loch der Zeitgeschichte.
Mexikos Stadtbild wird von grün-weißen VW Käfern beherrscht. Es sind Taxen, hierzulande liebevoll vochos genannt. Sie quälen sich zu hunderttausenden durch die Staus, unverwüstlich und zäh, so wie ihre Besitzer. Laura, eine gute mexikanische Freundin, hindert mich erfolgreich daran, eines dieser praktischen Transportmittel zu besteigen, um auf dem schnellsten Wege zu Oswalds Hotel in der Calle Sahagún zu kommen. »Viel zu gefährlich«, behauptet sie und erzählt mir Geschichten von europäischen Touristen, die von Taxifahrern verschleppt, ausgeraubt und sogar getötet worden seien. Erst als ich ihr versprochen habe, niemals so ein Teufelsgefährt zu besteigen, lädt sie mich in ihren VW-Jetta, tritt das Gaspedal bis zum Anschlag durch und steuert zielsicher einen imaginären Punkt an, während sie gleichzeitig auf mich einredet, um mir die Gefahren der Metropole einzuschärfen. Wir fahren ungefähr eine Stunde im Kreis, bis Laura beschließt, einen Straßenpolizisten zu fragen, wo denn die Calle Sahagún zu finden sei. Der verzieht missbilligend das Gesicht und sagt: »Nach rechts und dann immer geradeaus.« Laura reißt das Steuer energisch nach links und kommentiert meinen ratlosen Blick mit den Worten: »Jeder weiß doch, dass mexikanische Polizisten rechts und links nicht voneinander unterscheiden können, also mache ich genau das Gegenteil von dem, was er sagt.«
Als das Rot der Sonne mit dem Schwarz der Nacht verschmilzt, stehen wir endlich vor dem Hotel Comercio, ganz in der Nähe der Metrostation Revolución. Ein Blick auf den Stadtplan verrät mir: Mit dem Taxi wären es höchsten 10 Minuten gewesen. »Aber«, kontert Laura, »bei meiner Methode bist du immerhin am Leben geblieben.« Dagegen ist nun wirklich kein Einwand möglich. Das Viertel voller fliegender Händler, Zuhälter, Huren und Drogendealer gilt als unsicher. Selbst der kleine Getränkekiosk neben dem Hotel ist mit dicken Eisenstangen verbarrikadiert. Nachfrage bei der verstört wirkenden Empfangsdame des Hotels. Sie zuckt mit den Schultern und wirft einen ängstlichen Blick in Richtung Treppe. Sie selbst habe Oswald nicht gekannt. Nur der Besitzer des Hotels, Herr Guerrero, dürfe zu diesem Thema Auskunft geben. Der sei schon 1963 Eigentümer des Hotels gewesen. Im Moment sei er aber auf Auslandsreise und niemand wisse, wann er wiederkomme.
Im Hintergrund lärmen ein paar Huren mit ihren Freiern. Das Comercio ist heute ein schäbiges kleines Stundenhotel, am Rande der Legalität. Ein Zimmer kostet hier 6,50 Dollar, zu Oswalds Zeiten waren es nur 1,28. Filmen und Fotografieren, so belehrt mich die Empfangsdame, seien in diesem Hotel grundsätzlich verboten. Es wird fast ein Jahr Verhandlungen und eine hübsche Stange Geld kosten, bis wir endlich das Zimmer Nummer 18 betreten und auch filmen dürfen. Die spartanische Einrichtung der sechziger Jahre: Abgewetzte Möbel in rötlichem Holz mit schwarzen, von Zigaretten eingebrannten Löchern. Das Zimmer ist dunkel, mit Fenster zum Hof. Nur die Holzvertäfelung sei neu, so die Empfangsdame. Sonst ist alles so wie zu Oswalds Zeiten. Hier also hat der Mörder Kennedys gewohnt.
Am 27. September 1963 kam er am Vormittag gegen 10 Uhr im Hotel an, um sich gleich darauf in die kubanische Botschaft aufzumachen. Dort traf er auf Silvia Durán, die seinen Visumantrag für Kuba entgegennahm. Silvia Durán war eine mexikanische Kommunistin, die für die Kubaner arbeitete und das unbedingte Vertrauen des Botschafters genoss. »Revolutionär und sexy« sei sie gewesen, so der ehemalige US-Söldner Gerry Hemming, der an Fidel Castros Seite kämpfte und Silvia Durán 1962 kennen lernte.
Silvia Durán wurde für die kubanische Regierung, aber auch für die Warren-Kommission, die das Attentat untersuchte, eine Art Kronzeugin für Oswalds Aufenthalt in Mexiko. Immer wieder erzählte sie die gleiche Geschichte: Oswald verlangte ein Visum für Kuba und zwar sofort. Er gab sich als amerikanischer Kommunist mit großen Verdiensten für die kubanische Revolution aus. Sie habe ihm gesagt: Visumsanträge werden in Havanna entschieden. Er müsse warten, wie alle anderen auch. Aber da er schon einmal in der Sowjetunion gelebt habe, könnte sie ihm den Rat geben, zur nahe gelegenen Botschaft der Sowjetunion zu gehen, um dort ein Visum zu beantragen. Sollte er es bekommen, dann würde sie ihm sofort ein Transitvisum für Kuba geben. Doch die Sowjets wollten Oswald nicht wiederhaben und sagten »njet«. Was sollte sie tun: Sie habe ihn bei seinem zweiten Besuch abweisen müssen. Als er wütend wurde, habe der Konsul ihn hinausgeworfen.
Das Drama um das Oswald verwehrte Visum scheint ein Beweis dafür zu sein, dass die Kubaner nichts mit ihm zu tun haben wollten. Die Frage ist nur, ob die Geschichte wirklich so passiert ist, oder ob sie eine geheimdienstliche Fabrikation ist. Eine falsche Spur, um von den wirklichen Vorfällen in der Botschaft abzulenken? Silvia Duráns Aussage ist nie überprüft worden. Außer den Funktionären der kubanischen Botschaft gab es keine Zeugen.
Heute wohnt Silvia Durán in einer geschlossenen gutbürgerlichen Wohnanlage in der Nähe der Autonomen Universität von Mexico City, gut bewacht von einem privaten Sicherheitsdienst. Keine Chance, auch nur in die Nähe ihrer Wohnung zu kommen. Am Telefon ist sie freundlich und abweisend. Nein, ein Interview zum Thema Oswald komme nicht in Frage. Oswald sei für sie das »größte Trauma« ihres Lebens gewesen, das sie auf keinen Fall reaktivieren wolle. Die mexikanische Geheimpolizei verhaftete sie nach dem Mord an Kennedy und die ganze Familie habe sehr darunter gelitten. Sie habe damals alles gesagt, was sie wisse: Oswald sei bei seinem zweiten Besuch in der Botschaft so unverschämt und laut geworden, dass Konsul Azcue ihn schließlich hinausgeworfen hätte. Dann fügt sie von sich aus hinzu, als ob sie sich selbst vergewissern müsste: »Ich habe keinen privaten Kontakt zu ihm gehabt, nicht den geringsten. Schließlich war ich eine verheiratete Frau und mit einem Verrückten wie Oswald hätte ich mich niemals eingelassen. Ich habe ihn nie wieder gesehen.«
Soweit Silvia Duráns Geschichte. Alle beteiligten Regierungen waren mit ihrer Erklärung zufrieden: die mexikanische, die kubanische und die der USA. Auch die Warren-Kommission, die im Dezember 1963 damit begann, den Mordfall Kennedy zu untersuchen. Genauer gesagt bemerkten die ehrwürdigen Mitglieder der von Präsident Johnson eingesetzten Kommission nicht, dass sie von der CIA in die Irre geführt wurden. Denn die Belege über mögliche Kontakte Oswalds zum kubanischen Geheimdienst wurden ihr vorenthalten. Ein inzwischen freigegebenes Geheimtelegramm beweist das. Es wurde vom Direktor der CIA am 20. Dezember 1963 an die CIA-Station in Mexiko geschickt: »Unser Plan ist es, die abgehörten Telefonate aus dem Bericht für die Warren-Kommission zu entfernen. Wir werden uns stattdessen auf die Aussagen von Silvia Durán beziehen ... Das was sie und andere (kubanische) Botschaftsfunktionäre über Oswalds Besuche gesagt haben, soll als wertvolles Beweismaterial gesehen werden.« 2
Читать дальше