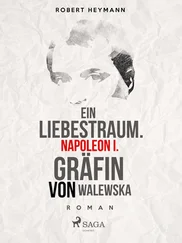„Haben Sie einen Verdacht gegen die Dame, Herr Kommissar?“
„Verdacht? Das wäre zu viel gesagt! Mir fiel lediglich auf — nur dem Lokomotivpersonal, dem Zugführer und mir ist bekannt, daß der Zug durch ein Signal angehalten wurde. Irgend jemand hatte eine weithin sichtbare improvisierte Fahne mitten zwischen die Gleise gepflanzt.“
„Ein Bubenstück?“
„Wer weiß? Das wird die Untersuchung ergeben!“
„Und Sie fahren nach Lyon, Herr Kommissar?“
„Ja. Lyon — Saint Etienne! Zur Unterstützung der dortigen Fahndungsbehörde. Wir haben zuverlässige Nachricht, daß der Sträfling gesehen wurde.“
„Kommen Sie, Herr Kommissar, ich stelle Sie der Dame, die Ihr Interesse erregt hat, als Offizier der Kolonialarmee vor. Wer weiß? Mindestens verplaudern wir angenehm ein Stündchen. Sie ist der Typ der Rajane. Haben Sie die berühmte Rajane noch gekannt?“
Marchand nimmt in dem Abteil Platz. Aber die verschiedenen Versuche, die Griechin in ein Gespräch zu verwickeln, schlagen fehl. Sie ist gegen den angeblichen Hauptmann aus Marokko ebenso zurückhaltend wie gegen Durand, und so bleibt den Beamten schließlich nichts übrig, als auf das Gespräch der Dame mit dem Arzt aus Marseille zu lauschen.
Roxane Zairis erzählt, sie wolle in Algier kurzen Aufenthalt nehmen und dann weiterreisen. Ihre Gesundheit sei angegriffen, der Arzt habe ihr geraten, den Winter in Ägypten zu verbringen. Sie erkundigt sich nach hundert Einzelheiten aus Dr. Bertons Familienleben, er seinerseits spricht in überschwenglicher Weise von seiner Gattin. Er ist verliebt, wie es scheint, und die Griechin hört ihm mit einem Lächeln zu, das auch Durand bezaubert. Denn Roxane Zairis ist schön und rätselhaft, aber trotz ihrer mädchenhaften Erscheinung ist ein Strahl mütterlicher Güte in jedem ihrer Blicke. Selbst ihr Mund scheint geschaffen, nur Worte der Zärtlichkeit und der Liebe zu sprechen.
„Sie rauchen nur Zigarren?“ fragt Durand den Kommissar, während das Gespräch der beiden Mitreisenden stockt. Dieser fühlt den leisen Druck des Fußes gegen den seinen, sieht das kaum merkliche aufmunternde Kopfnicken Durands.“
„Ja! Leider!“
„Wie schade! Ich habe Hunger nach einer Zigarette!“
Mit einer liebenswürdigen Geste greift die Griechin nach dem goldenen Etui in ihrer Handtasche.
„Bitte, mein Herr, bedienen Sie sich!“
Durand nimmt dankend eine Zigarette und beginnt zu rauchen. Die Griechin folgt seinem Beispiel.
Der Zug rattert und dröhnt, die Dame ist wieder in ihre Unterhaltung mit Dr. Berton vertieft, Durand kann also halblaut zu Marchand sagen: „Wenn ich in einigen Minuten deliriere, dann öffnen Sie bitte sofort das Fenster!“
Der Kommissar reißt groß die Augen auf, er weiß nicht, wie er diese sonderbare Bemerkung aufnehmen soll. Durand in fröhlicher Selbstvergessenheit, ein Zustand, der am besten zu seinem friedfertigen und heiteren Äußeren paßt, fährt fort:
„Haben Sie eine Ahnung, wohin ich fahre?“
„Wie sollte ich, Herr Durand?“
„Zu meiner persönlichen Hinrichtung!“
„Na, na! Da würde die Pariser Polizei einen ihrer allerbesten Beamten auf tragische Weise verlieren! Das wäre der schlimmste Justizmord seit hundert Jahren!“
„Ausnahmsweise ist die Polizei daran nicht schuld, Herr Kommissar! Reine Zufallssache! Ich heirate!“
„Wirklich? Das hätte ich nicht von Ihnen erwartet!“
„Ich — früher — auch nicht! Solche Dinge kommen plötzlich. Aber ich bin zufrieden, mehr noch, ich bin glücklich! Meine Braut ist eine reizende Pariserin, die jetzt in Marseille ein kleines Geschäft hat. Rue de Rome, dicht beim Prado. Kennen Sie die Rue de Rome? Nein? Ich sage Ihnen: dunkle, große Augen —“
„Pardon! Die Rue de Rome?“
„Aber nein! Meine Braut! Mittelgroß, zu mir passend, behende, lebhaft, gebildet — was wollen Sie mehr? Sie ist fast zu schön für mich, dafür ist sie tugendhaft, sparsam, mit einem leichten Zusatz von Energie, mit dem ich mich schon abfinden muß. — Übrigens: Was ich da sage, ist doch noch normal?“
„Ich denke doch, wenngleich — aber ich bin, wie Sie wissen, Junggeselle!“
Durand hat die Zigarette fast zu Ende geraucht. Er weiß nun nicht, woran er ist. Sollte er sich doch getäuscht haben? Diese Zigarette enthielt jedenfalls kein Opiat! Inzwischen jagt der Zug mit erhöhter Schnelligkeit durch den Abend. Das Abteil ist hell erleuchtet, vor den Fenstern liegt die Finsternis einer unbekannten, nächtlichen Gegend. Der Lokomotivführer will die erlittene Verspätung wieder einholen.
Dr. Berton studiert den Fahrplan.
In der Ferne, eingehüllt in einen blassen Nebelkranz von Lichtern tauchen Häuser-Silhouetten auf.
„Wir nähern uns einer Stadt“, sagt der Arzt. „Wissen Sie, meine Herren, welche es ist?“ Er sieht Durand fragend an. Aber sowohl der Detektiv wie der Kommissar fahren zum erstenmal diese Strecke. Sie wissen es nicht, und niemand ahnt, welch entsetzliches Ereignis in den nächsten zehn Minuten eintreten wird.
Den zwei jungen Männern, die auf der Erde liegend an der Eisenbahnweiche arbeiten, rinnt trotz der Kälte der Schweiß in kleinen Bächen über das Gesicht.
„Fertig“, sagt der eine keuchend.
Der andere springt auf. In seinem blassen, schmalen Gesicht stehen unruhige und lasterhafte Augen.
Stirn und Nacken sind fahl, die Hände schmal trotz des gedrungenen Körpers. „Alles Weitere ist Sache von Marius“, sagt er träge. Er lacht — sein Blick sucht das Bahnwärterhäuschen. Weit draußen vor der kleinen Stadt liegt es. Von dem Häuschen aus erblickt man in weiter Ferne den Bahnhof wie ein Kinderspielzeug. Und doch ist er ein Riese aus Eisen und Beton, der unausgesetzt Rußwellen von sich stößt und mit roten und grünen Augen in die Dunkelheit starrt.
Schnaubend rasen die Expreßzüge vorüber. Donnernd fegen die schweren Lokomotiven über die glänzenden Stahlschienen. Der Weichenwärter tritt langsam aus der Tür des schmucken Häuschens. Der Expreß ist bald fällig.
Da kommt ein Arbeiter vorbei, bittet François Lorient um ein Glas Wasser.
Der nächtliche Himmel ist durchwebt mit grauen Dunstschleiern, die die Sterne verhüllen. Opalfarben liegen irisierende Lichter über dem stählernen Netz der Schienen. Der Weichensteller geht zurück in die kleine Küche. Strohblumen stehen auf dem Tisch. Es ist warm, der Ofen geheizt. Vor einem halben Jahr hat François seine junge Frau aus dem Fischerdörfchen in der Bretagne, aus dem er stammt, hierhergebracht. Sie selbst ist Irländerin. Ihr Vater ist vor vielen Jahren mit seinem Kutter gestrandet und ertrunken, das Kind blieb bei den Bretagne-Fischern.
François Lorient ist aber seit seiner Verheiratung des Lebens nicht mehr recht froh geworden. Das Glück war nur von kurzer Dauer. Bald genug fing Betsey an zu klagen. Sie könne das Dasein nicht länger hier ertragen. Täglich das gleiche Einerlei der grauen Pflicht! Keine Wiesen, keine Kühe, kein Meer — nur Schienen, Schienen, Züge, Weichen! Sie sehnte sich fort. Sie sehnte sich nach dem Bretagne-Dörfchen, wo sie die Schönste war, freilich auch die Koketteste. Die Burschen waren hinter ihr her — diable! Und doch hat sie ihn erwählt: François! — Immerhin: er war Beamter. Sie hat sich das wohl ganz anders vorgestellt: das Wunder der Stadt! Sie hat von schönen Menschen geträumt, von stetem Jubel und dem Glanz des Reichtums, der wie ein Stern über allen Häusern stehen würde. Aber sie fand nur das Bahnwärterhäuschen und dieses phantastische Eisengebilde: den Bahnhof, die Schienen, die donnernden Züge. Ein paar Blumen stehen im Sommer wohl dazwischen, aber Betsey kann sich nicht über Ausnahmen freuen. Und oft ist das ganze Land rauch- und nebelverhangen, dann — erklärt Betsey — ist es eine Totenlandschaft mit zischenden, sich jagenden Gespenstern.
Читать дальше