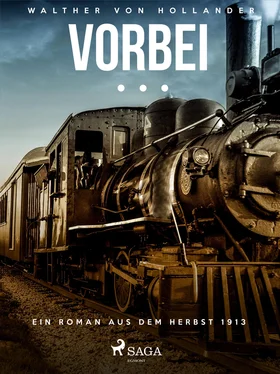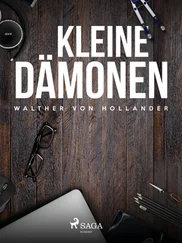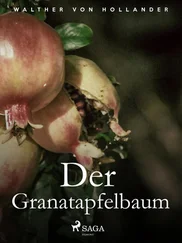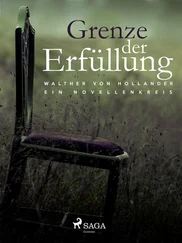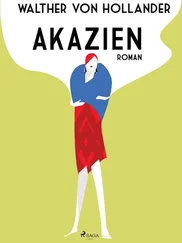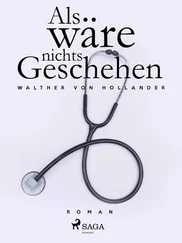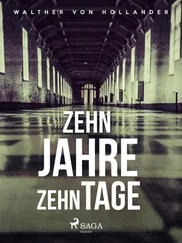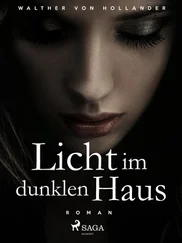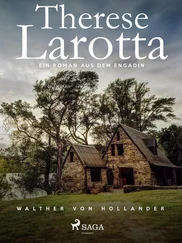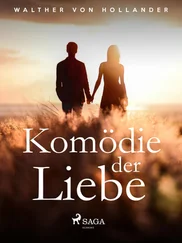Es war ein ziemlich grosses Restaurant, durch Wände in Nischen geteilt, die zumeist von Stammtischen besetzt waren. Hinten ging es zu einem Vereinszimmer, aus dem man die Glocke eines Vorsitzenden und die Rufe einer Versammlung hörte. Der einzige freie Tisch stand ziemlich in der Mitte des Restaurants, war also von fast allen Stammtischen einzusehen. Als die Garberding sich setzte, verstummte das ganze Lokal. Vierzig, fünfzig Männeraugen, sechs, acht Frauenaugen waren auf sie gerichtet. Die Garberding war es ja gewöhnt, angestarrt zu werden. Es war ihr Beruf, sie konnte eigentlich nicht leben, wenn man sie nicht anstarrte. Aber hier war es ihr unangenehm. Fast so unangenehm wie die Begegnung im Park.
Der Kellner beugte sich vertraulich über sie. Wie? Ja, natürlich, essen. Trinken? Na schön, einen Schoppen Wein. Was für einen Wein? Rotwein. Rotwein nicht da? Na schön, dann eben Weisswein. Sie holte das Zigarettenetui aus der Handtasche, steckte eine Zigarette in den Mund, nahm sie wieder heraus und legte sie still neben den Teller. Nein, hier rauchten die Frauen nicht. Hier rauchten nur die Männer, und Zigaretten konnte sie überhaupt nicht entdecken.
Der Kellner brachte ihr endlich den Wein und den Beobachter für B. und Umgegend. Sie entfaltete die Zeitung und versteckte sich.
Langsam setzte das Gespräch wieder ein. Sie hörte, dass um diese Zeit Fremde in B. sehr selten waren, dass die Damen ihre Jacke zu modern, die Herren ihre Hüften zu schmal fanden. Dann lenkte das Gespräch wieder auf die Angelegenheiten von B. Die Versammlung im Vereinszimmer war die Gründungsversammlung irgendeiner Aktiengesellschaft. Der Name Grossmann wurde fortwährend genannt. Es kamen Herren aus dem Zimmer, um Herren, die hier draussen sassen, zu informieren. Sie sprachen von einem Umtauschangebot 137 : 100, von Vorzugsaktien einer Hotelgesellschaft, von einer Gesellschaft für die Kanalisation von B., von einer Holdinggesellschaft, die beide Unternehmen zusammen mit dem Elektrizitätswerk unter einen Hut bringen sollte. Es waren aufgeregte, unverständliche Besprechungen.
Helene Garberding las dabei von Unfällen, von Ereignissen aus der Gesellschaft. Eine bevorstehende Schnitzeljagd bei den Töches in Quennfeld wurde ausführlich erwähnt. Die Garberding war froh, wenigstens einen bekannten Namen zu finden. Denn Quennfeld war der Besitz der Eltern von Klaus Töche, und Klaus Töche war ein Kamerad von Hans Adalbert von Hagendörp und ausserdem der Freund der Soubrette Techemeier. Sie las von einem Dank des Staatsministeriums an Herrn Grossmann in B. für die Schaffung des Elektrizitätswerkes. Dazwischen musste sie an den Park denken, an den Pavillon, an die von Hunden verfolgte Nymphe und dass sie beinahe von der Wolfshündin aufgefressen worden war; musste sie grübeln, was denn nun weiter werden sollte und was sie erreichen wollte. Denn damit, dass sie hier im Schwarzen Lamm sass und Eierkuchen ass, damit, dass sie allein durch ihr Dasein die Frauen von B. ärgerte und die Männer erregte, damit war nichts geschafft.
Während sie noch sass, trat wieder das eisige Schweigen ein. Aber diesmal galt es einem breiten, spitzbärtigen Herrn in einem grauen Cutaway mit schwarzer Plastronkrawatte, der, einen grauen, steifen Hut in der Hand schwingend, eintrat, nach allen Seiten freundlich grüsste und im Versammlungszimmer verschwand. Es war natürlich der vielerwähnte Herr Grossmann, und die durchdringende, helle Stimme, die sich jetzt im Nebenzimmer erhob, war Grossmanns Rednerstimme. Da niemand im Restaurant mehr sprach, konnte man ihn gut verstehen. Er riet den versammelten Herren von der geplanten Gründung ab. Die Sicherheiten genügten ihm nicht. Die Aussichten bezeichnete er als unzureichend. Man könne bestimmt mehr herausholen. Er taxiere 110 : 100. Also Hotelaktien plus zehn Prozent Zuzahlung gleich Industrie-Aktien.
Bald nach Grossmanns Rede schien sich die Versammlung aufzulösen. Erst kamen einige Opponenten, Assessor Pluhm, wie die Garberding erfuhr, und Rittmeister von Schwiering, danach Grossmann mit drei Herren, die eifrig auf ihn einredeten. Zu viel Vorsicht sei nicht am Platze. Man solle mit Berlin telefonieren und möglichst bald zum Abschluss kommen. Grossmann lud die Herren ein, mit in seine Villa zu kommen.
Helene fand diesen Herrn Grossmann merkwürdig. Er war bestimmt rücksichtslos. Aber seine Augen waren liebenswert, ja ein bisschen schwärmerisch. Seine Haltung war freier und selbstverständlicher als die der anderen Männer, die eine Würde zur Schau trugen, die sie gar nicht besassen. Die Herren verliessen übrigens bald das Lokal.
Man hörte gleich darauf eine Trompete schmettern.
Fräulein Garberding zahlte. Sie ging schnell durch das Städtchen, das ganz still geworden war. Ein junger Mann mit steifem Hut und langer Nase liess sie vorübergehen, kehrte kurz um und ging hinter ihr her. Er überholte sie zweimal, um sie immer wieder an einem Schaufenster zu erwarten, einmal an einem Delikatessengeschäft, einmal an einem Handarbeitsladen, der in einem Plakat mahnte, jetzt die Weihnachtsarbeiten für die Lieben sofort anzufangen. Dieses Plakat starrte Helene sehr traurig an. Um Gottes willen, in drei Monaten war Weihnachten schon vorüber, und ein neues Jahr begann. Das gute alte Jahr war dann vorbei, in dem sie mit Ali Hagendörp zusammengekommen war. Wie, wenn ihre Liebe genau so spurlos verschwand, so unwiederbringlich wie dieses Jahr?
Langsam ging sie in ihre Pension zurück.
In der Nacht träumte sie, dass sie eine Marmorgöttin geworden sei. Mit kühler, glatter Haut. Die Hunde verfolgten sie, und sie schrie: „Ali, Ali!“ Aber er hörte sie nicht. Sie wachte auf, lag lange im Dunkeln und grübelte. Wo war Ali? Wie kam sie zu Ali? Was sollte sie ihm sagen, wenn sie zu ihm kam?
Was sollte werden?
Die Villa Grossmanns am anderen Ende der Stadt war die grösste und schönste Villa in B. Sie hatte jahrelang leer gestanden, einmal weil niemand fünfzehn Zimmer brauchte, niemand den riesigen Stall hinten im Garten, niemand den grossen, verwilderten Garten, der am Stadtwald lag und mit Buchen und Akazien in ihn einmündete. Dann aber vor allem, weil die Villa ein Unglückshaus war. Sie hatte früher dem Fürsten L. gehört, einem Schwager des alten Barons Hagendörp, der als schwer nervenkranker Mann nach B. zog und immer seltsamer und schrulliger wurde, so dass man es als Glück bezeichnen konnte, dass er heimlich nach Afrika ausrückte und im Burenkriege, als Freiwilliger auf der Seite der Buren kämpfend, fiel. Von seiner Frau, der Fürstin Clementine L., hatte es der Fabrikant Eggeling mit allen Möbeln und vielen Erinnerungsstücken gekauft. Ein Jahr danach brannte das Dachgeschoss aus, wobei die Frau des Fabrikanten in den Flammen umkam. Eggeling starb wenige Monate später an den Folgen des Nervenschocks. Sein Sohn, der Leutnant Eggeling, wurde noch im gleichen Jahre von einem Pferde abgeworfen und so verletzt, dass er jahrelang gelähmt blieb und schliesslich starb. Noch nicht genug: eine Tochter, die das Haus bewohnte, wurde tuberkulös und starb ganz schnell. Die zweite Tochter floh nach Italien. Sie wollte nichts mehr von diesem Haus wissen, nichts von B.
So stand es leer, bis in diesem Frühjahr Herr Grossmann erschien, als ein schwerreicher Mann, der B. zu seinem Sommersitz ernannte und, da er beschlossen hatte, seine Vaterstadt in den Kreis der aufblühenden Städte Deutschlands hineinzuziehen, einen Teil seiner Geschäfte hierher verlegte. Die Villa war die teuerste, die man in B. kaufen konnte, und wäre nicht unten am Böttchermarkt, an der Grenze zum Arbeiterviertel, das Ladengeschäft des verstorbenen Herrn Grossmann gewesen (A. Grossmann Nachf. genannt), so hätte Grossmann sicher in vielen alten Familien von B. Zutritt gehabt. Aber so nahmen die alten Familien keine Notiz von ihm.
In dieser Nacht war bei Grossmann noch lange Licht. Oben im Büro arbeitete der Privatsekretär Dr. Boose mit der Berliner Sekretärin Fräulein Fley. Man hörte ihn, durch das offene Fenster, diktieren. Es war von einer Belebung der Handwerksbetriebe in B. die Rede, von tausend Anschlüssen der Kanalisationsbranche, von einigen Kilometern Röhren. Unten sass der Bürgermeister Koste, ein langnasiger Mann mit Brille und Glatze, ein schüchterner Mensch, der alles, was ihm vorgetragen wurde, zunächst ablehnte. Ferner der Bankdirektor Wiedenbein, ein freundlicher Mann mit Specknacken, Eisenbahndirektor Schwarz, der eine optimistische weiche Bürste auf dem Kopf trug und auch sonst ein humorvoller und aufrechter Mann zu sein glaubte. Es war Rechtsanwalt Klusemann erschienen, einen schwarzen Schnurrbart zu beiden Seiten des Mundes, einen hohen Kragen um den Hals, eine Schmetterlingsschleife davor, ein Junggeselle, wie er im Buche stand, Tennisspieler, Kartenschläger, Vortänzer auf dem Bürgerball, Vorsitzender im Ruderklub Fortuna 06, und natürlich fehlte auch Leutnant a. D. von Wüstefeld nicht, zwei Zentner netto, Besitzer der Kalkwerke zu B., Kassenwart im Gustav-Adolf-Verein, Vorsitzender im Klub der Hagenbergfreunde (der die Wegweiser und Aussichtsbänke in den Hagenbergen zu pflanzen hatte), und nach Grossmann der bedeutendste Steuerzahler.
Читать дальше