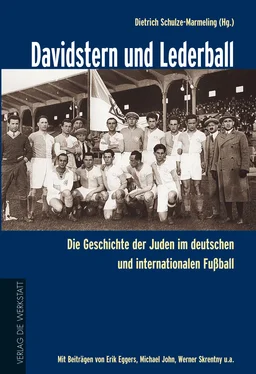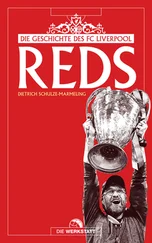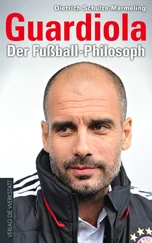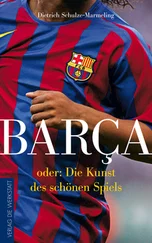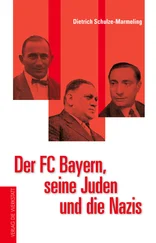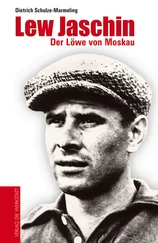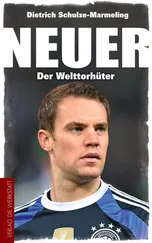Dietrich Schulze-Marmeling - Davidstern und Lederball
Здесь есть возможность читать онлайн «Dietrich Schulze-Marmeling - Davidstern und Lederball» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Davidstern und Lederball
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Davidstern und Lederball: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Davidstern und Lederball»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Davidstern und Lederball — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Davidstern und Lederball», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Die Vertreibung
Wenige Monate vor der nationalsozialistischen Machtübernahme stellte sich Bensemanns Situation merkwürdig zwiespältig dar. Auf internationalem Parkett zeigte ihn der FIFA-Kongress 1932 in Stockholm auf dem Höhepunkt seines Ansehens. Unter den FIFA-Granden wandelte er inter pares, Gastgeber Johanson, der schwedische Verbandspräsident, pries den »Kicker« öffentlich als »das beste Sportblatt des Kontinents«, 39 und zwei seiner engsten deutschen Freunde wurden in hohe FIFA-Ämter gewählt: Jugendfreund Ivo Schricker wurde FIFA-Generalsekretär, der renommierte Kölner Schiedsrichter Peco Bauwens gelangte in den Exekutiv-Vorstand.
In scharfem Kontrast dazu stand Bensemanns Situation in Deutschland. Im Streit um eine internationalistische Ausrichtung des Sports war er immer stärker in die Defensive geraten. Seine Gesundheit war stark angeschlagen und seine finanzielle Situation denkbar schlecht. Nicht zuletzt der Eklat um den »Club«-Trainer Jenö Konrad dürfte ihm klar gemacht haben, welche Zukunft jüdische Bürger in einem nationalsozialistisch regierten Deutschland zu erwarten hatten.
Zudem hatte der »Kicker« inzwischen seine Selbstständigkeit verloren. Offensichtlich hatte selbst die enge Anlehnung an den Süddeutschen Fußballverband die ökonomische Situation des Blattes nicht gefestigt. Mit dem Nürnberger Verleger Max Willmy kam ein Partner ins Boot, der Bensemanns autokratische Position im »Kicker« bald infrage stellte und offenbar auch dessen persönlichen Reiseetat zusammenstrich. 40 In einem letzten Akt des Trotzes und persönlicher Eitelkeit ließ Bensemann sich anlässlich seines 60. Geburtstags über mehrere Seiten im »Kicker« als verdienstvollen Pionier feiern. Danach resignierte er offenbar. Zwar enthielt sich der »Kicker« unter seiner Regie jeglichen positiven Kommentars zu Hitlers frischer Kanzlerschaft – aber auch jeglicher direkten Kritik.
Anfang April 1933 reiste Bensemann in die Schweiz, aus der er nicht mehr zurückkehren sollte. 1934 weilte er – von der Krankheit gezeichnet – noch als Gast bei der Fußballweltmeisterschaft in Italien, wo ihn deutsche Journalisten als Mahner vor der faschistischen Gefahr in Erinnerung behielten. 41 Auch in Briefen an deutsche Freunde bekundete er seine Ablehnung des Hitler-Regimes. Doch öffentliche Äußerungen von ihm sind nicht mehr bekannt. Bensemann starb am 12. November 1934 in Montreux, wo er zuletzt im Hause seines Freundes Albert Mayer gewohnt hatte.
Es war ihm nicht erspart geblieben, die Anfänge der nationalsozialistischen Herrschaft mitzuerleben – und die fatale Anpassung von Leuten, die einst seine Weggefährten waren. Hans-Jakob Müllenbach, sein journalistischer Schüler seit 1920 und Nachfolger im »Kicker«, ließ in dem Blatt über »Asphaltliteraten« herziehen, die »das deutsche Wesen so verunglimpft« und »teilweise allerdings nun die Flucht ergriffen« hätten. 42 Bereits einige Tage zuvor, am 9. April 1933, hatten die großen süddeutschen Fußballvereine, mit denen Bensemann über lange Zeit enge Beziehungen gepflegt hatte, in einer gemeinsamen Erklärung versichert, sie würden die Maßnahmen der NS-Regierung »mit allen Kräften« mittragen, »insbesondere in der Frage der Entfernung der Juden aus den Sportvereinen«. 43 Zu den unterzeichnenden Klubs gehörten der Karlsruher FV, den Bensemann gegründet hatte, der 1. FC Nürnberg, zu dem er bis 1933 besonders freundschaftliche Kontakte unterhalten hatte, sowie Eintracht Frankfurt und der FC Bayern, deren Vorläufervereine er mitgegründet hatte. Kurze Zeit später proklamierte auch der DFB, an dessen Spitze seit einigen Jahren Felix Linnemann stand, er halte »Angehörige der jüdischen Rasse … in führenden Stellungen der Landesverbände und Vereine nicht für tragbar«.
Einen bemerkenswerten Nachtritt leistete sich Otto Nerz gegenüber Walther Bensemann. Der aus Süddeutschland stammende Nerz war in den zwanziger Jahren häufiger Kolumnist des »Kicker« gewesen und genoss als Reichstrainer zwischen 1926 und 1933 die uneingeschränkte publizistische Unterstützung des »Kicker«-Herausgebers. Am 4. Juni 1943 schrieb Nerz im Berliner »12 Uhr Blatt« über die Sportjournalisten der Weimarer Zeit: »Die besten Stellen bei den großen Zeitungsverlagen waren in jüdischen Händen. Die Journalisten trieben von ihrem Schreibtisch eine rein jüdische Politik. Sie unterstützten die zersetzende Arbeit ihrer Rassengenossen in den Verbänden und Vereinen und setzten die Sportführung unter Druck, wenn sie ihnen nicht zu Willen war.« 44
Ivo Schricker, der für die Nazis unangreifbar in der FIFA-Zentrale saß, sowie dem Schweizer Albert Mayer blieb es vorbehalten, Bensemanns Andenken zu wahren. Am Abend nach dessen Beerdigung in Montreux beschlossen sie gemeinsam mit anderen Freunden, ein internationales Fußballjugendturnier ins Leben zu rufen und dem Pionier zu widmen. 45 1937 fand in Genf das erste »Tournoi international de Football-Juniors pro memoria Walter Bensemann« statt, mit Beteiligung namhafter Vereine aus der Schweiz, der Tschechoslowakei, aus Frankreich und Italien. Weitere Turniere folgten 1938 und 1939 in Straßburg und Zürich, bis der Weltkrieg dieser Idee ein vorläufiges Ende setzte. 1946 wurde das Turnier dann wieder ausgetragen, 1951 erstmals auch in Deutschland (Karlsruhe). Die UEFA unterstützte das Projekt, das nach 1962, dem Todesjahr Schrickers, zum »Internationalen Turnier p.m. Walter Bensemann – Dr. Ivo Schricker« umbenannt wurde. Vorsitzende des Organisationskomitees waren bis 1961 Ivo Schricker als FIFA-Generalsekretär, danach IOC-Mitglied Albert Mayer, DFB-Präsident Peco Bauwens sowie FIFA-Präsident Sir Stanley Rous. Das letzte Turnier wurde 1991 vom Karlsruher FV durchgeführt, danach löste das Komitee sich auf, weil die UEFA ihre finanzielle Bürgschaft zurückgezogen hatte.
Größere Jugendturniere in Deutschland heißen heutzutage Nokia- oder McDonalds-Cup und stehen eher im Zeichen der Globalisierung als des Internationalismus.
Anmerkungen
| 1 | In der Literatur finden sich zu Bensemanns familiärem Hintergrund eher unklare Äußerungen. Sein Vater wird in der Geburtsurkunde als »Banquier« bezeichnet, der »zur Religionsgemeinschaft der Juden gehörig« sei. Ob die Mutter, wie später von Weggenossen Bensemanns beschrieben, die »Tochter eines reichen Fabrikbesitzers aus Breslau« gewesen war, konnte nicht verifiziert werden. Über seine verwandtschaftlichen Kontakte nach Schottland (über einen Vetter Bob Davy bzw. einen Neffen Walter Davy) berichtete Bensemann selbst zuweilen im »Kicker«. Die im Weiteren zitierte Aussage, die Familie Bensemanns gehöre zu denjenigen jüdischen Bürgern, die eher kosmopolitisch und kulturell interessiert eingestellt seien sowie den jüdischen Glauben nicht oder nur verhalten praktizierten, stammt von Dr. Fritz Weilenmann, den der Autor 1998 befragen konnte. Er hatte noch als Kind Walther Bensemann kennen gelernt, arbeitete nach dem Zweiten Weltkrieg in der Redaktion des »Kicker« und zählte zu seinem Bekanntenkreis einige Persönlichkeiten, die Bensemann gut gekannt hatten (z.B. Dr. Peco Bauwens, Dr. Friedebert Becker oder Dr. Georg Xandry). Weilenmann berichtete auch von den kulturellen »Salon-Aktivitäten« der Mutter Bensemanns. |
| 2 | Ruth Gay: Geschichte der Juden in Deutschland, München 1993, S. 178 |
| 3 | »Der Kicker«, Nr. 27/1929. Weitere Angaben zu jener Zeit finden sich u.a. in den Heften 43/1931 und 12/1922. |
| 4 | »Spiel und Sport« vom 20. Januar 1900, S. 39 |
| 5 | »Spiel und Sport« vom 13. Januar 1900, S. 24 |
| 6 | Die später so genannten »Ur-Länderspiele« waren: am 23.11.1899 in Berlin (2:3, 1.500 Zuschauer), am 24.11.1899 wiederum in Berlin (2:10, 500 Zuschauer), am 25.11.1899 in Prag (0:8, 4.500 Zuschauer) sowie am 28.11.1899 in Karlsruhe (0:7, 2.000 Zuschauer). Den vereinbarten Rückspielen gingen wiederum längere Querelen zwischen Bensemann und dem Süddeutschen Verband voraus, die erst beigelegt wurden, nachdem Bensemann den Vorsitz im Organisationskomitee niedergelegt und der englische F.A.-Sekretär Frederick Wall den DFB-Bundesvorsitzenden Hueppe kontaktiert hatte. Die Spiele in England waren: am 21.9.1901 in London (12:0-Sieg einer englischen Amateurauswahl) sowie am 25.9.1901 in Manchester (10:0-Sieg einer englischen Profiaus wahl). |
| Über den Stellenwert dieser »Ur-Länderspiele« hieß es 1914 rückschauend in einer Festschrift des Torball- und Fußball-Club Viktoria Berlin: Es war »die größte Sensation des alten Jahrhunderts: das Erscheinen der ersten repräsentativen englischen Mannschaft in Berlin mit den glanzvollsten Namen englischer Fußballgeschichte. (…) Sie offenbarte uns eine ganz neue Kunst, das genaue flache Zuspiel, das Zuspiel an den Hintermann, das exakte Stoppen des Balles usw., Eigenschaften, die man damals bei dem guten hohen alldeutschen Spiel absolut nicht kannte.« | |
| 7 | »Der Kicker«, Nr. 11/1920 |
| 8 | Ebenda |
| 9 | »Der Kicker«, Nr. 34/1930 |
| 10 | »Der Kicker«, Nr. 52/1921 |
| 11 | »Der Kicker«, Nr. 9/1925 |
| 12 | »Der Kicker«, Nr. 25/1920 |
| 13 | Phil Wolf: Neue Ausgrabungen aus der Steinzeit des Frankfurter Fußballs, Frankfurt / M. 1930, S. 12 |
| 14 | Zit. nach Peter Seifert: Walther Bensemann als Sportpublizist (Diplomarbeit), Köln 1973 |
| 15 | Richard Kirn: Große Namen der deutschen Sportjournalistik, in: Internationale Sport-Korrespondenz, Lechfelden-Echterdingen, Juli 1977 |
| 16 | »Der Kicker«, Nr. 3/1920; vgl. beispielsweise auch Nr. 4/1921 |
| 17 | »Der Kicker«, Nr. 5/1921 |
| 18 | »Der Kicker«, Nr. 6/1921 |
| 19 | »Der Kicker«, Nr. 7/1921 |
| 20 | »Der Kicker«, Nr. 16/1923 |
| 21 | »Der Kicker«, Nr. 5/1922 |
| 22 | »Der Kicker«, Nr. 13/1921 |
| 23 | Boas und Mayer halfen dem »Kicker« 1922 auch finanziell, als die Zeitung während der Inflation in wirtschaftliche Probleme geriet. Dies trug Bensemann den Vorwurf ein, sein Blatt werde von ausländischem Kapital finanziert und betreibe »systematische Auslandspropaganda« (vgl. Nr. 4/1923). |
| 24 | »Der Kicker«, Nr. 22/1931 |
| 25 | »Der Kicker«, Nr. 9/1925 |
| 26 | »Der Kicker«, Nr. 5/1925 |
| 27 | »Der Kicker«, Nr. 42/1924 |
| 28 | »Der Kicker«, Nr. 43/1921 |
| 29 | Vgl. dazu Ruth Gay, a.a.O., S. 230f |
| 30 | »Der Kicker«, Nr. 49/1923 |
| 31 | »Der Kicker«, Nr. 4/1925. Bensemann erhebt m.W. im »Kicker« nur einmal den Vorwurf des Antisemitismus, und zwar gegenüber einem Straßburger (also französischen) Leserbriefschreiber, der sich als »ehrlicher Arbeiter« bezeichnet und bestimmten Fußballerkreisen »Krämergeist« vorwirft. Bensemann antwortet in Heft 2/1924: »Ihr Brief bekundet einen offensichtlichen Antisemitismus, den man in Arbeiterkreisen eigentlich nicht erwartet. Lassalle, Marx und Rosa Luxemburg haben doch stets bei der werktätigen Schicht die allergrößte Verehrung genossen.« |
| 32 | »Der Kicker«, Nr. 39/1931 |
| 33 | Vgl. dazu Bausenwein / Kaiser / Siegler: 1. FC Nürnberg – Die Legende des Club, Göttingen 1996, S. 75ff |
| 34 | Dr. Klein, der im Mai 1933 zum neuen »Führer« des WSV gewählt werden sollte, saß zwischen 1932 und 1936 für die NSDAP im Reichstag. Später geriet er in Widerspruch zum nationalsozialistischen System, insbesondere zu dessen zentralistischen Tendenzen. 1942 wurde er verhaftet und für sechs Monate in einem KZ inhaftiert. Er starb 1952. Vgl. dazu auch: Arthur Heinrich: Der deutsche Fußballbund. Eine politische Geschichte, Köln 2000, Erik Eggers: Fußball in der Weimarer Republik, Kassel 2001; schließlich: Westdeutscher Fußballverband e.V. (Hg.): 100 Jahre Fußball im Westen, Kassel 1998 |
| 35 | »Fußball und Leichtathletik«, Nr. 27/1925 |
| 36 | Zit. nach »Der Kicker«, Nr. 14/1928. Dass Bensemann die Verwendung solcher Begrifflichkeiten mit Antisemitismus gleichsetzen musste, beweist seine in Fußnote 31 geschilderte Reaktion. |
| 37 | »Der Kicker«, Nr. 47/1928 |
| 38 | Vgl. dazu: Hajo Bernett: Guido von Mengden – »Generalstabschef« des deutschen Sports, Berlin/München/Frankfurt/M. 1976 |
| 39 | »Der Kicker«, Nr. 22/1932 |
| 40 | Dr. Max Willmy war Besitzer einer Großdruckerei sowie eines Zeitungsverlages in Nürnberg. Seine Eingriffe in den »Kicker« waren möglicherweise nicht nur dadurch motiviert, Ordnung in ein Unternehmen zu bringen, an dem er finanziell beteiligt war.Willmy arrangierte sich ab 1933 verdächtig schnell mit den Nazis und druckte einige ihrer Blätter, ab 1934 auch den »Stürmer«, der bald eine wöchentliche Auflage von 2,5 Millionen erreichte. Es ist zu vermuten, dass Willmy frühzeitig ein Interesse daran hatte,den »Kicker« politisch in ein neues Fahrwasser zu lotsen und den starrsinnigen (zudemj üdischen) Herausgeber loszuwerden. 1948 wurde Willmy wegen seiner Beziehungen zu dem Nazi-Regime zu zwei Jahren Sonderarbeit verurteilt, sein Vermögen wurde zu 50% eingezogen. Auf fünf Jahre wurde ihm das Wahlrecht entzogen sowie die Berufsausübung als Verleger verboten. |
| 41 | Vgl. beispielsweise: Friedebert Becker: Walter Bensemann, Porträt eines Idealisten, in: DFB-Jahrbuch, Frankfurt 1953; Richard Kirn: Aus der Freiheit des Herzens, in: »Der Kicker« vom 7.12.1953; schließlich: Paul Laven: Fußball-Melodie, Erlebtes und Erlauschtes, Bad Kreuznach 1953 |
| 42 | »Der Kicker«, Nr. 16/1933. Er erschien am 11. April, also etwa zehn Tage nach Bense manns Ausreise. |
| 43 | Vgl. »Der Kicker«, Nr. 15/1933 |
| 44 | Zit. nach Jürgen Leinemann: Sepp Herberger, ein Leben, eine Legende, Hamburg 1998 (S. 266) |
| 45 | Vgl. zu Entstehung und Geschichte des Turniers: Karlsruher Fußballverein (Hg.): 90 Jahre Karlsruher Fußballverein, Karlsruhe 1981; sowie derselbe (Hg.): 100 Jahre Karlsruher Fußballverein, Karlsruhe 1991. |
Werner Skrentny
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Davidstern und Lederball»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Davidstern und Lederball» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Davidstern und Lederball» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.