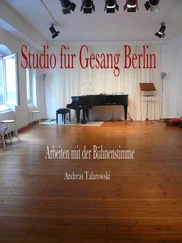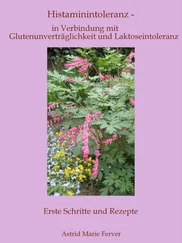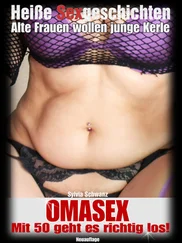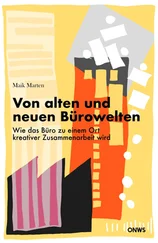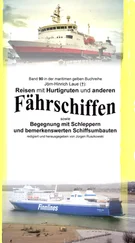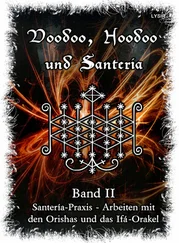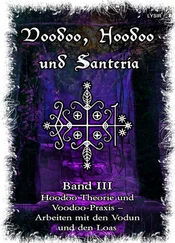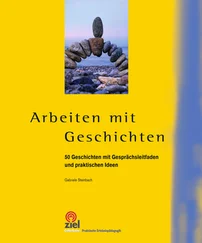An diesem Fallbeispiel zeigt sich exemplarisch etwas, was in der Konsequenz für die psychotherapeutische Diagnostik und Therapie ausgesprochen bedeutsam ist – nämlich, dass die psychische Situation im hohen und besonders im höheren Lebensalter mehr als in allen anderen Altersphasen zuvor in zunehmendem Maße als eine Konfiguration eines hoch komplexen und dynamischen Entwicklungsprozesses zu verstehen ist (Kessler et al. 2014). Dies bedeutet auch, dass psychische Erkrankungen alter und vor allem sehr alter Menschen eine Multiplikation kognitiver, emotionaler, motivationaler wie auch sozialer und räumlich-technologischer Defizite (und Ressourcen) darstellen, die sich über das ganze bisherige Leben hinweg akkumuliert haben. Dies drückt sich folglich in einer beträchtlichen intrapsychischen Komplexität und Variabilität der psychischen Situation aus.
Legt man eine solche Konzeptionalisierung psychischer Erkrankungen im Alter zugrunde, tritt damit die Frage nach der Altersspezifität psychischer Erkrankungen (etwa die Behauptung, dass sich Depression im Alter somatisch ausdrücken würde) zugunsten der Feststellung enormer Einzigartigkeit der psychischen Situation in den Hintergrund. So war die depressive Symptomatik bei Frau O. eine komplexe und letztlich nicht zu entwirrende Interaktion aus lerngeschichtlichen Erfahrungen des Verlassenwerdens und deren Aktualisierung durch den Kontaktabbruch der Tochter, pathologischen neurobiologischen Veränderungen bei Vorliegen multipler Erkrankungen, zunehmender Unselbstständigkeit durch eingeschränkte Mobilität und sensorischer Beeinträchtigung, aber auch dem Einzug ins Pflegeheim und mangelnder sozialer Einbindung vor Ort.
Insgesamt leitet sich aus den Ausführungen ein therapeutischer Ansatz ab, wonach psychotherapeutisches Arbeiten mit älteren Menschen immer einen Balanceakt erfordert, der darin besteht, den älteren Patienten einerseits vor dem Hintergrund seiner biografisch begründeten Individualität einschließlich persönlicher Stärken, Präferenzen und Bedürfnisse und andererseits in Bezug auf normative und alterstypische Entwicklungsverläufe zu betrachten (vgl. Laidlaw et al. 2004). Oder vereinfacht formuliert, den Patienten so zu sehen, wie man jede andere Patientin sehen würde, und ihn gleichzeitig vor dem Hintergrund seines hohen bzw. sehr hohen Alters zu sehen. Dies impliziert auch, dass das hohe Lebensalter von Patienten nur einer von vielen, in der Psychotherapie zu berücksichtigen Faktoren ist, dass es aber dennoch einen groben heuristischen Wert besitzt. Ein alterssensibles therapeutisches Vorgehen kann demnach im Einzelfall Folgendes bedeuten:
• Bei der Therapieplanung für ältere Patientinnen innerhalb eines Pools von existierenden verfahrensspezifischen Methoden diejenigen bevorzugt auszuwählen, die der altersspezifischen Entwicklungsdynamik besonders gerecht werden. So wird beispielsweise in der psychodynamisch orientierten Literatur argumentiert, dass strukturbezogene Psychotherapie ein besonderes Potenzial für die Arbeit mit der Patientengruppe besitze, während konfliktbezogene Methoden tendenziell als weniger förderlich betrachtet werden (  Kap. 2.4). Ebenso wird die Interpersonelle Psychotherapie (
Kap. 2.4). Ebenso wird die Interpersonelle Psychotherapie (  Kap. 8.8) durch ihren Fokus auf interpersonelle Probleme durch Verluste und Übergänge als geeignet für ältere Patienten beschrieben.
Kap. 8.8) durch ihren Fokus auf interpersonelle Probleme durch Verluste und Übergänge als geeignet für ältere Patienten beschrieben.
• Existierende Therapietechniken an die Ressourcenlage im hohen und sehr hohen Alter zu adaptieren. In der verhaltenstherapeutischen Literatur (  Kap. 8.3) werden beispielsweise folgende Modifikationen genannt: Gesprächsfokussierung; langsameres, vereinfachtes Vorgehen; multimodale Instruktionen und Gedächtnishilfen; Pausen und verkürzte Sitzungen (Forstmeier und Maercker 2009).
Kap. 8.3) werden beispielsweise folgende Modifikationen genannt: Gesprächsfokussierung; langsameres, vereinfachtes Vorgehen; multimodale Instruktionen und Gedächtnishilfen; Pausen und verkürzte Sitzungen (Forstmeier und Maercker 2009).
• Das therapeutische Vorgehen um Ansätze zu erweitern, die in der Vergangenheit speziell für das höhere Lebensalter entwickelt wurden. Dazu gehört insbesondere die Lebensrückblicktherapie (  Kap. 8.6), die als eigenständiger Ansatz aus der Entwicklungspsychologie und gerontologischen Praxis (und nicht aus einem Psychotherapieverfahren) heraus entwickelt wurde. Außerdem gibt es alterssensible Erweiterungen von Psychotherapie, etwa wenn es um den Einbezug des sozialen Umfeldes (
Kap. 8.6), die als eigenständiger Ansatz aus der Entwicklungspsychologie und gerontologischen Praxis (und nicht aus einem Psychotherapieverfahren) heraus entwickelt wurde. Außerdem gibt es alterssensible Erweiterungen von Psychotherapie, etwa wenn es um den Einbezug des sozialen Umfeldes (  Kap. 8.10) oder Techniken im Umgang mit alterstypischen Erkrankungen wie Parkinson geht.
Kap. 8.10) oder Techniken im Umgang mit alterstypischen Erkrankungen wie Parkinson geht.
Insgesamt besteht damit die Anforderung an Psychotherapeuten, in Anbetracht der Komplexität der psychischen Symptomatik und der gesamten Lebenssituation von Patientinnen über eine große Palette von therapeutischen Vorgehensweisen zu verfügen (vgl. Knight 2003).
3.3 Sind alte Patienten »schwierige Patienten« – wie attraktiv ist es, mit alten und sehr alten Patienten psychotherapeutisch zu arbeiten?
Die bisherigen Ausführungen scheinen den Eindruck nahezulegen, dass es sich beim psychotherapeutischen Arbeiten mit alten und sehr alten Menschen um ein interessantes und abwechslungsreiches Forschungs- und Praxisfeld handelt. Tatsächlich jedoch betrachten viele Psychotherapeutinnen diese in ihrer Arbeit als eine eher schwierige, unattraktive, ja sogar »dubiose« Patientinnengruppe (vgl. Bodner et al. 2018). Ihrer gegenüber jüngeren Personen geringer ausfallenden Behandlungsbereitschaft liegt wahrscheinlich ein Zusammenspiel verschiedener Ursachen zugrunde:
• Kulturell internalisierte, einseitig negative Vorstellungen über das Alter (geistiger Abbau, Unselbstständigkeit, Rigidität…) gehen bei Psychotherapeuten mit negativen Erwartungen und der Antizipation, geringere Therapieerfolge zu erzielen, einher (  Kap. 1)
Kap. 1)
• Die meisten Psychotherapeutinnen verfügen über eine geringe oder sogar sehr geringe gerontopsychologische Qualifikation in der psychotherapeutischen Aus- und Weiterbildung. Dies führt zu mangelndem Zutrauen in die eigene Behandlungskompetenz der Patientengruppe (  Kap. 5.1).
Kap. 5.1).
• Aufgrund fehlender gesellschaftlicher Opportunitätsstrukturen in den Bereichen Arbeit, Bildung und Freizeit haben jüngere Menschen wenig oder keine intergenerationellen Kontakte zu älteren Menschen außerhalb der eigenen Familie (Riley und Riley 1994). Daher haben Therapeuten in der Regel vergleichsweise wenig soziale Erfahrungen mit älteren Menschen. Damit geht eine größere soziale Kontakthemmung und stärkere Orientierung an intergenerationellen Beziehungsnormen einher (  Kap. 6.4).
Kap. 6.4).
• Damit verbunden ist häufig ein Unbehagen oder mangelndes Verständnis in Bezug auf unterschiedliche Sozialisationserfahrungen und unterschiedliche Entwicklungsphasen älterer Menschen (  Kap. 6.5).
Kap. 6.5).
• Alter löst nach der Mortalitäts-Salienz-Theorie (Martens et al. 2005) aufgrund seiner Assoziation mit Tod und Vergänglichkeit schnell Ängste vor dem eigenen Altern und dem von nahestehenden Menschen aus.
Читать дальше
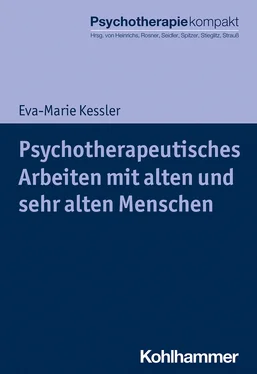
 Kap. 2.4). Ebenso wird die Interpersonelle Psychotherapie (
Kap. 2.4). Ebenso wird die Interpersonelle Psychotherapie (