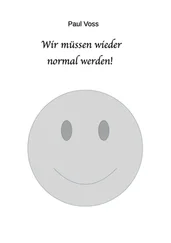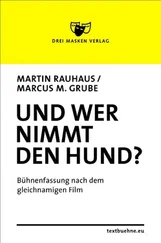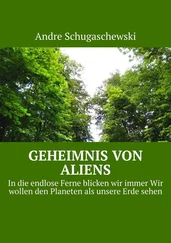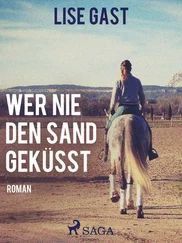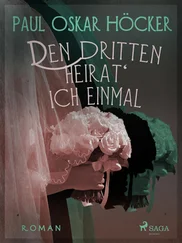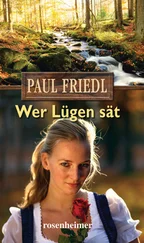Hat schon einmal eine Frau ein männliches Profiteam trainiert?
Hat schon einmal eine Frau ein männliches Profiteam trainiert?
Am 7. Mai 2014 druckten zahlreiche Zeitungen eine Meldung der Deutschen Presse-Agentur (dpa) unter der Überschrift „Erste Trainerin im Männerfußball“ ab. Es ging darin um die Portugiesin Helena Margarida dos Santos Costa, die als neue Trainerin des französischen Zweitligisten Clermont Foot verpflichtet worden war. Vieles an dieser Personalentscheidung war ungewöhnlich, etwa dass Costa nie selbst auf hohem Level gespielt hatte (sie musste ihre aktive Karriere schon mit 21 Jahren wegen einer Verletzung beenden). Oder dass sie zuletzt an etwas exotischen Orten wie Katar und dem Iran gearbeitet hatte. Doch natürlich war das Erstaunlichste an der Verpflichtung, dass Costa eine Frau war. Sogar die New York Times horchte auf. „Dies ist ein historischer Tag“, sagte die 36-Jährige der amerikanischen Zeitung in einem Telefoninterview. „Ich denke, es geht um mehr als nur die Fußballtrainerin Helena Costa. Es ist für alle Frauen im Sport gut, vor allem natürlich im Fußball.“
Die New York Times wies in ihrem Artikel darauf hin, dass selbst in den USA, wo der Frauenfußball größer und erfolgreicher ist als das Spiel der Männer, es noch keinen weiblichen Coach einer Profimannschaft der Herren gegeben hatte. „Sie wird die erste Trainerin sein“, konnte man lesen, „die in einer der beiden höchsten Klassen in einer der fünf großen Ligen Europas arbeitet.“ An all diesen Einschränkungen ließ sich schon erahnen, dass Costa zwar sicher einen bedeutenden Schritt getan hatte, aber mitnichten die erste Frau war, die Berufsfußballer trainierte.
Schon zwei Jahre zuvor, Anfang Mai 2012, hatte der peruanische Verein Club Deportivo Auxilios Mutuos Hijos de Acosvinchos (zum Glück nennen ihn selbst Einheimische nur „Hijos de Acosvinchos“) eine 43-jährige Bolivianerin namens Nelfi Ibañez Guerra als Trainerin verpflichtet. Der Klub spielte zu diesem Zeitpunkt in der 2. Liga Perus. Das Niveau dieser Spielklasse lässt sich nicht mit der 2. Liga in Frankreich vergleichen und die meisten Spieler von Hijos de Acosvinchos waren auch nur Halbprofis, dennoch machte die Verpflichtung Schlagzeilen. „Ich hätte gerne ein paar weibliche Kollegen“, sagte Nelfi Ibañez der französischen Nachrichtenagentur AFP. „Denken Sie nicht auch, dass ich wohl die Einzige auf der Welt bin? In allen Ländern, in denen ich war, scheine ich die einzige Frau zu sein, die Männer trainiert.“
Zu diesem Zeitpunkt war sie vielleicht die einzige – aber nicht die erste. Schon lange, lange vor ihr hatte eine der bekanntesten Spielerinnen der Welt – und zudem in einer wirklich bedeutenden Fußballnation – diese Vorreiterrolle übernommen. Ende Juni 1999 verpflichtete AS Viterbese Calcio, ein Klub aus der drittklassigen italienischen Serie C, niemand Geringeren als Carolina Morace. Die damals 35-jährige Venezianerin war als Spielerin Vizeeuropameisterin, mehrfache italienische Meisterin und lange Zeit Rekordnationalspielerin (nicht nur ihres Landes, sondern europaweit). Ausgebildete Rechtsanwältin und langjährige Trainerin der Frauen-Nationalelf war sie auch noch. Trotzdem hatte sie nicht damit gerechnet, ein solches Medienecho auszulösen. „Ich wusste, dass man mich genau beobachten würde“, sagte Morace vor Saisonbeginn, „aber nicht, dass man das mit gezogener Waffe tun würde. Es macht mich wütend, dass man ein Urteil über mich fällt, noch bevor ich begonnen habe. Vielleicht scheitere ich, aber das hat dann nichts mit meinem Geschlecht zu tun.“
Mitte September, nach nur zwei Spielen, trat Morace von ihrem Amt zurück. Als Grund gab sie aber nicht etwa die Berichterstattung der Medien an, sondern den Mann, der sie überhaupt erst zum Klub geholt hatte. Das war der umtriebige Luciano Gaucci, der Besitzer des Serie-A-Teams Perugia, der zwei Jahre zuvor auch Viterbese gekauft hatte. (Siehe: „Welcher Spielertransfer war der eigenartigste?“) Nach einer 2:5-Niederlage gegen Crotone, so Morace, habe Gaucci angekündigt, ihre Co-Trainerin Betty Bavagnoli zu entlassen. „Wenn dies das Klima hier ist, dann bin ich nicht die Richtige dafür“, sagte sie. Der Klub hingegen bestritt, dass Bavagnoli gefeuert werden sollte, und bezeichnete Moraces Rücktritt als „völlig unerwartet“.
Auch Helena Costa blieb nicht lange auf ihrem Posten. Oder besser: Sie trat ihn erst gar nicht an. Mitte Juni 2014, noch vor dem Start in die Saison, löste sie ihren Vertrag auf. „Diese Entscheidung kam plötzlich und überraschend“, sagte Claude Michy, der Präsident von Clermont Foot. „Ich bedaure dies zutiefst.“ Die Trauerarbeit war kurz. Schon zwei Tage später präsentierte Michy Ersatz für Costa, nämlich Corinne Diacre. Ebenfalls eine Frau.
 Wer hat für die meisten Nationalmannschaften gespielt?
Wer hat für die meisten Nationalmannschaften gespielt?
Sieht man einmal von der recht großen Gruppe von Fußballern ab, die in einem bestimmten Land Nationalspieler wurden und dann später noch ein zweites vertraten, nachdem das erste aufgelöst wurde (zum Beispiel im Zuge des Zerfalls der UdSSR), dann stechen vor allem zwei Spieler hervor. Sie wurden in zwei Ländern geboren, die 12.000 Kilometer voneinander entfernt sind, und fanden sich doch eines Tages in derselben Nationalmannschaft wieder – und zwar in der eines dritten Landes. Beide wurden von der FIFA gesperrt, gehörten zu den besten Spielern der Welt und nahmen trotzdem nie an einer WM-Endrunde teil.
Da wäre zunächst der legendäre Alfredo di Stéfano. Er gab sein internationales Debüt für sein Geburtsland Argentinien. Bei der Südamerikameisterschaft 1947 erzielte er in sechs Spielen ebenso viele Tore. Ein Jahr später legten Spielerstreiks die argentinische Liga auf Eis und viele Fußballer gingen nach Kolumbien, um dort Geld zu verdienen. So auch di Stéfano. Er schloss sich dem Klub Los Millonarios aus Bogotá an und bestritt 1949 auch vier Länderspiele für Kolumbien. Diese Partien werden allerdings von der FIFA nicht gewertet, weil der Weltverband in jenen Jahren die Liga und die Nationalmannschaft des Landes nicht anerkannte. Darum stand di Stéfano auch auf einer schwarzen Liste der FIFA, was seinen Wechsel zu Real Madrid 1953 zu einer komplizierten Posse werden ließ. Etwas später, 1956, bekam di Stéfano die spanische Staatsbürgerschaft und bestritt 31 Partien für seine neue Heimat. Er spielte also offiziell für zwei, inoffiziell für drei Nationen.
Vielleicht ist er bis heute der beste Spieler, der nie bei einer WM auflief. Argentinien nahm 1950 wegen eines Streits mit dem brasilianischen Verband, der damals Ausrichter war, nicht an der WM teil. Acht Jahre später scheiterte Spanien in der Qualifikation an Schottland, 1962 konnte di Stéfano wegen einer Verletzung nicht zur WM nach Chile reisen. So bleibt die Frage „Was wäre gewesen?“ – und die stellt sich in gewisser Weise auch in Bezug auf die Vereinskarriere di Stéfanos. Sein Name ist heute sehr eng mit Real Madrid verbunden, aber um ein Haar wäre er beim FC Barcelona gelandet. Und hätte dort vielleicht mit einem anderen rastlosen Könner zusammenspielen können – Ladislao Kubala.

Alfredo di Stéfano als Stürmerstar des kolumbianischen Klubs Los Millonarios. Unsterblich wurde er anschließend bei Real Madrid.
Der verschlungene Karriereweg von Kubala macht deutlich, durch wie viele Tragödien seine Generation gehen musste und wie sehr Kriege oder Revolutionen das Leben vieler Menschen im 20. Jahrhundert bestimmten. Er wurde 1927 geboren, ein Jahr nach di Stéfano, und zwar in Budapest als Sohn slowakischer Eltern. Auch wegen dieser Abstammung bestritt er sein erstes Länderspiel für die Tschechoslowakei, denn nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs siedelte Kubala (angeblich, um dem Wehrdienst in Ungarn zu entgehen) nach Bratislava über. Im Oktober 1946 lief er zum ersten von sechs Länderspielen für das Land seiner Vorfahren auf.
Читать дальше
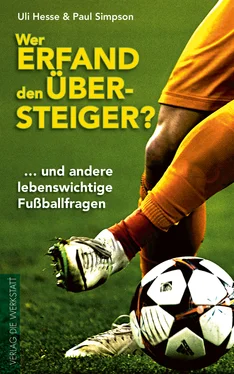
 Hat schon einmal eine Frau ein männliches Profiteam trainiert?
Hat schon einmal eine Frau ein männliches Profiteam trainiert?