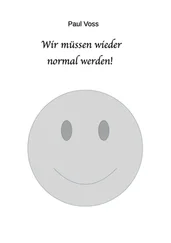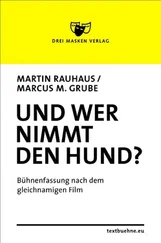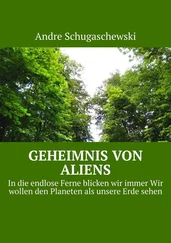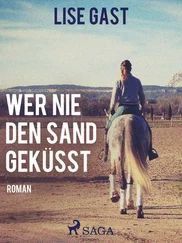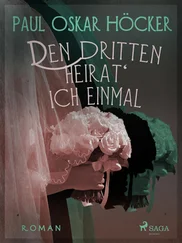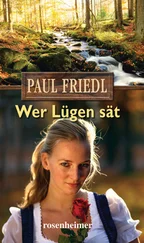Die große Ausnahme machte wieder einmal Superstar Johan Cruyff. Nach jenem neuen System hätte er eigentlich die „1“ bekommen müssen, doch „König Johan“ bestand auf seiner glücksbringenden „14“ und durfte sie natürlich behalten. So wurde das Trikot mit der „1“ dem Spieler gegeben, der in der alphabetischen Liste der Nachnamen auf Cruyff folgte – Geertruida Maria „Ruud“ Geels. Doch Michels setzte ihn nicht ein. Das auf Kurzpässen und Positionstausch basierende System des „totalen Fußballs“ hatte nur bedingt Verwendung für einen klassischen Torjäger, der ein toller Kopfballspieler war und Flanken brauchte. So wurde den deutschen Fußballfans das Erlebnis verwehrt, einen Feldspieler mit der Nummer „1“ zu sehen. Als Geels beim nächsten Turnier, der EM 1976, tatsächlich eingesetzt wurde, hatten die Holländer ihr eigentümliches System der Nummerierung bereits wieder aufgegeben und der Spieler lief mit der „13“ auf.
Allerdings waren die Holländer nicht die Einzigen, die 1974 die Sache mit den festen Rückennummern etwas exzentrisch angingen. Auch Argentinien nummerierte alphabetisch – machte dabei aber eine Ausnahme für seine drei Torhüter, denn für die wurden die Nummern „1“, „12“ und „21“ reserviert. Vier Jahre später jedoch, als sie selbst Ausrichter der WM waren, ließen die Argentinier auch diese Einschränkung fallen und nummerierten die Trikots stringent nach dem Alphabet durch: Norberto „Beto“ Alonso bekam die Nummer „1“, Osvaldo Ardiles die „2“, Ersatztorwart Hector Baley die „3“ und so fort.
Nationaltrainer Cesar Luis Menotti war kein ausgesprochener Fan von Alonso (und berief ihn vielleicht sogar nur deshalb in den WM-Kader, weil die herrschende Militärjunta ihn dazu drängte), dennoch wechselte er ihn 15 Minuten vor dem Ende des ersten Gruppenspiels gegen Ungarn ein. In diesem Moment betrat ein offensiver Mittelfeldspieler mit der Rückennummer „1“ den Rasen. (Bei seinem Klub River Plate trug Alonso die klassische Nummer des Spielmachers, die „10“, und war stolz darauf.)
Auch bei den beiden folgenden Weltmeisterschaften, 1982 in Spanien und 1986 in Mexiko, hielten es die Südamerikaner so. Sie machten zwar, wie einst Holland für Cruyff, ein paar Ausnahmen, wenn es um Stars wie Diego Maradona, Daniel Passarella und Jorge Valdano ging, doch auch einem verdienten und bekannten Spieler wie Ardiles machte es nichts aus, 1982 die Rückennummer „1“ zu tragen.
Obwohl die Rückennummern heute nur noch wenig mit der Position eines Spielers zu tun haben, ist es noch immer ungewöhnlich, einen Feldspieler zu sehen, der die „1“ trägt. Noch seltsamer ist wohl nur noch die Nummer, die der leider viel zu früh verstorbene Marokkaner Hicham Zerouali im Jahre 2000 wählte. Er spielte damals für den FC Aberdeen in Schottland, dessen Fans ihn wegen seines Nachnamens „Zero“ nannten. Und so suchte er sich als Rückennummer die „0“ aus. Dem schottischen Verband gefiel das gar nicht, und am Ende der Saison wurde das Tragen dieser Nummer verboten. (Allerdings nur in Schottland. In der Saison 2006 hatte Torwart Steve Cronin bei seinem Klub Los Angeles Galaxy in der Major League Soccer ebenfalls die „0“.)
Die Schotten waren nicht die ersten Bürokraten, die die Wahlfreiheit eines Fußballers beschränkten. In den 1990er Jahren bevorzugte der finnische Mittelfeldspieler Mika Lehkosuo die „96.2“ auf seinem Trikot – weil das die UKW-Frequenz einer lokalen Radiostation war. Als sich sein Verein HJK Helsinki 1997 für die Champions League qualifizierte, musste Lehkosuo sich eine neue Rückennummer suchen, da die UEFA für ihre Wettbewerbe nur natürliche Zahlen von 1 bis 99 akzeptierte. (Er wählte die „96“.)
Ein anderer Kontinentalverband, der asiatische, ist liberaler, was die Anzahl der erlaubten Rückennummern angeht. Er muss das aber auch sein, denn in Asien gilt die Regel, dass ein Spieler die Nummer, die er zu Beginn einer Qualifikationsrunde trägt, den ganzen Wettbewerb hindurch behalten muss. Das bedeutet, dass unter einem Trainer, der zum Beispiel gerne experimentiert oder vielen Spielern eine Chance geben will, der allgemein als normal angesehene Zahlenraum bald nicht mehr ausreicht. Als der australische Linksaußen Tommy Oar am 3. März 2010 im letzten Qualifikationsspiel seines Landes für den AFC Asian Cup (die Asienmeisterschaft) sein Länderspieldebüt gab, trug er die Rückennummer „121“.
 Welcher Profi hatte das komplizierteste Ritual vor einem Spiel?
Welcher Profi hatte das komplizierteste Ritual vor einem Spiel?
Ob er es nun zugibt oder nicht, nahezu jeder Fußballer ist abergläubisch und folgt vor Spielen einem bestimmten Ritual. Dabei kann es sich um eine Kleinigkeit handeln wie eine bestimmte Reihenfolge beim Anlegen der Spielkleidung (der englische Nationalspieler Paul Ince zog stets das Hemd zuletzt an). Oft geht es ums Betreten oder Verlassen des Rasens (Dortmunds Kevin Großkreutz geht nach dem Aufwärmen als Letzter vom Feld, während der ivorische Verteidiger Kolo Touré äußersten Wert darauf legt, dass beim Einlaufen niemand hinter ihm ist). Manche Macken sind amüsant – so hielt der spanische Torwart Pepe Reina während seiner Zeit in Liverpool vor jedem Spiel an derselben Tankstelle und füllte den Wagen auf, ob es nun nötig war oder nicht.
Einige Eigenheiten können für Unannehmlichkeiten sorgen, sind aber immer noch harmlos. In diese Kategorie fällt wohl Krassimir Balakovs Angst vor der Rückwärtsbewegung. Über den Bulgaren, der acht Jahre für den VfB Stuttgart spielte und dann dort Co-Trainer wurde, schrieb die Gmünder Tagespost 2004: „Als [Busfahrer] Rolf Geissler den Rückwärtsgang einlegen wollte, funkte Krassimir Balakov dazwischen. Der Bulgare verhinderte, dass der VfB-Bus rückwärts den engen Parkplatz vor der AWD-Arena ansteuerte. Der Co-Trainer ist abergläubisch und möchte sich immer nur vorwärts bewegen. Die Profis mussten zu Fuß den Weg bis zur Kabine zurücklegen. Danach manövrierte Geissler den Dreiachser durch das Gittertor – rückwärts.“
Andere Spieler haben viel ausgeklügeltere Rituale, denken wir nur an Cristiano Ronaldo von Real Madrid: Er stellt nicht nur an einem Spieltag kurz die Fußballschuhe unter die Büste seines früh verstorbenen Vaters, sondern braucht auch bei der Anreise einen ganz speziellen Sitzplatz (im Bus in der letzten, im Flugzeug in der ersten Reihe), bevor er das Spielfeld dann zuerst mit dem rechten Fuß betritt und kurz vor den Anpfiff einmal in die Luft springt. Doch so ausgefeilt all das auch sein mag, im Vergleich zu John Tudor, der in den 1970ern für Newcastle United spielte, ist Ronaldo praktisch neurosenfrei.
Das Buch The Rough Guide 11s – Newcastle United beschreibt, wie Tudor sich am Tag eines Spiels vor Pech und Unheil zu schützen suchte: „Der Stürmer aß immer um 12 Uhr zu Mittag. Und zwar stets die gleiche Mahlzeit: Bohnen auf Toast mit ein wenig Reispudding. Im Bus musste ihm dann Alec Mutch, der Mannschaftsarzt, persönlich ein nicht mehr in Papier eingewickeltes Kaugummi mit Pfefferminz-Geschmack reichen. Dieses Kaugummi behielt Tudor das ganze Spiel über im Mund und nahm es erst nach dem Abpfiff heraus. Nach dem Verlassen des Busses und kurz vor Erreichen der Umkleidekabine musste er einen Schluck Whisky trinken. Auch der wurde ihm von Mutch gereicht. Dann öffnete er zusammen mit seinem Sturmpartner Malcolm Macdonald eine Dose – keinen Karton – mit Hansaplast und klebte die Heftpflaster straff um seine Knöchel. Anschließend nahm Macdonald die nun leere Dose, füllte sie mit Wasser, nahm seine vier falschen Schneidezähne heraus, legte sie in die Dose, schloss den Deckel und verstaute das Ganze.“ Dann, und erst dann, fühlte sich John Tudor bereit für ein Fußballspiel.
Читать дальше
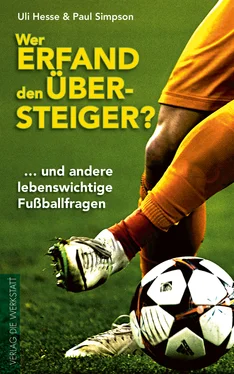
 Welcher Profi hatte das komplizierteste Ritual vor einem Spiel?
Welcher Profi hatte das komplizierteste Ritual vor einem Spiel?