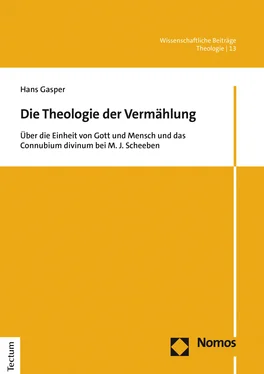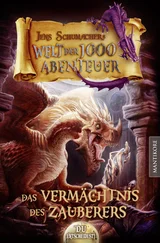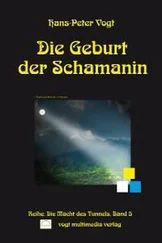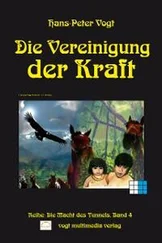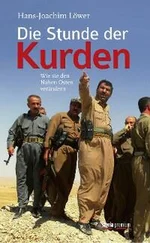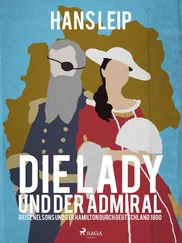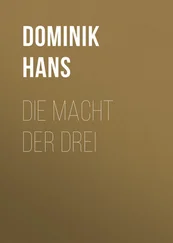351Scheeben spricht selbst von »wechselseitiger Priorität« und verweist vorher auf das »echt thomistische(n) Prinzip, quod causae diversae rationis suntsibi invicem cauae«, in. »C.v. Schäzlers ›Neue Untersuchungen‹«, GS VIII 91–134, hier118. Es ist dies eine Variante des scholastisch wohlbekannten »per modum unius«. Pierre Rousselot spricht von »reziproker Priorität«, was das Gleiche meint, in »Die Augen des Glaubens«, Einsiedeln 1963, 29–33.
352Zum Dombau D I n 1050 mit Anm. 4, wo Scheeben gotischen Dombau und scholastische Summen vergleicht.
353M. Grabmann, in GS 1, XXIX.
354H. U. von Balthasar, Herrlichkeit I, 98.
355M² 300 u. 340 für die Christologie, 333 für die gesamte in Christus erlöste Schöpfung, für die Pneumatologie M² 49, Anm. 3.
356Davon hat ihn sein Freund Benjamin Herder abgehalten, der die Dogmatik vollendet sehen wollte. S. dazu J. Dorneich, Briefwechsel, 1861–1888, in: ThQ 117 (1936), 27–68, hier 59–63. S. zum Ganzen 2.1 u. 5.3.
357S. bes. D II §§ 84–86 u. 104.
358Gesamtbeweis, Beleg D II n 32.
359Kontroverse, 174.
360Vgl. M² 6.
361Zur damit verbundenenen Frage angesichts der von Dorneich genannten Praxis Scheebens, Texte mehrfach umzuarbeiten s. 2.1.
362Vgl. D III bis § 146–157.
363Vgl. Gotteslehre §71–105.
364Vgl. D III § 166–168.
365D III § 168–169.
366Vgl. D III § 174.
367Ein Musterbeispiel ist Scheebens Glaubensanalyse, die man besser Glaubenssynthese nennen könnte. Das Ganze der Entwicklung ist im Grundbegriff »Autoritätsglaube« enthalten, s. dazu 6.1.
368Ein weiteres Musterbeispiel ist das Verhältnis des die Gnadenlehre der Dogmatik abschließenden D III § 174 zum die Christologie rekapitulierenden D V § 267, s. dazu 11.
369Zum Nexus mysteriorum, bei Scheeben D I n 879, vgl. dazu den ganzen Abschnitt D I § 47.
370Zu diesem »Mitteilungs- und Vermittlungsgedanken« N. Hoffmann, Natur und Gnade, 311 f.
371Was Kleutgen ziemlich genervt hat, vgl. ÜN 30, Anm. 21. Scheeben hat diesen Begriff später nicht mehr verwandt.
372Vgl. ÜN 21.
373S. dazu 4.
374Vgl. dazu M. Schmaus, Die psychologische Trinitätslehre des hl. Augustinus, Münster 1927. Dass es andere Ansätze gibt, zeigt z.B. gleich der Hinweis auf Bonaventura.
375Zu Thomas STh q27, bes. a 3.
376Zitate vollständig 4.1.1.
377F. J. Bode hat die Stufen der Fruchtbarkeit vom Keim bis zur Blüte und Frucht in Scheeben sehr entsprechender Weise zum Strukturprinzip eines ganzen Kapitels seiner Arbeit gemacht: Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, Kap. 2, 48–234.
378Vgl. dazu Julian Kaup (Hrsg. u. Übers), Bonaventura, Itinerarium mentis in Deum. De Reductione artium ad theologiam, München 1961, 136–146.
379Vgl. M² 652 u. D § 51.
380Vgl. dazu von H. U.von Balthasar, Herrlichkeit II,1, Einsiedeln 1962, 267–361, bes. 269 und die folgenden Seiten bis etwa 296.
381Ebd. 290.
382Vgl. K.-H. Minz, Pleroma Trinitatis, 90 u. zugehörige Anmerkungen: »Sie (die Fruchtbarkeit, H.G.) kann auch als der Kern der Theologie angesehen werden. Denn das ›bonum est diffusivum sui‹, i.e. die göttliche Fruchtbarkeit, ist der Quellgrund aller anderen übernatürlichen Wahrheiten, principium und finis aller Wirklichkeit.«
383Zur Trinitätslehre von Bonaventura immer noch wichtig die Arbeit des späteren Bischofs von Mainz: Albert Stohr, Die Trinitätslehre des heiligen Bonaventura, Teil 1, Die wissenschaftliche Trinitätslehre, Münster 1923, zu »fecunditas« und dem Bezug zum Vater: J. A. Wayne Hellmann, Ordo. Untersuchung eines Grundgedankens in der Theologie Bonaventuras, München – Paderborn – Wien 1974, 69–71.
384S. dazu. 2.2.6. u. 4.2.
385D II n 349, auch dort stellt Scheeben die Verknüpfung zum Glaubensbekenntnis her, das mit dem Glauben »in Deum Patrem omnipotentem« beginnt und mit »in vitam aeternam. Amen« schließt (ebd.).
386Vgl.7.7.4–7.7.7. Hans Urs von Balthasar schreibt, Scheeben weigere sich »auf den theologisch zumeist unfruchtbaren Gegensatz von ›physisch‹ und ›moralisch‹ (etwa zwischen Banezianern und Molinisten) überhaupt einzugehen, weil er aus der Glaubensschau heraus sich vor der Fragestellung hat warnen lassen.« In: Herrlichkeit 1, 103 f. Das trifft generell so vielleicht nicht zu, sicher aber für den letzten Band der Dogmatik.
387Vgl. N. Hoffmann, »Vergöttlichtes Sein: In Christus durch den Geist«, Natur und Gnade 261–353.
388Vgl. zu den Grenzen der Unterscheidung von physisch und moralisch bei Scheeben und zur primordialen Einheit E. Paul, Denkweg, 37, 47 ff., 141, 152 u.192.
389Vgl. E. Paul, Denkweg, 49, s. dazu 3.2.8.
390Vgl. D VI n 140.
391D VI, § 284 und 285. Vgl. bes. n 27, 50, 56 u. 57, 60; s. dazu wiederum 7.7.4–7.7.7.
392Vgl. ähnlich im Kontext der Gnadenlehre D VI n 108.
393So schon 1878 Hurter in der Zeitschrift für katholische Theologie 2, (1878), 572–579. Der Hauptherausgeber der GS und der »Mysterien« J. Höfer stellt zu den Ausführungen über die Sendungen der göttlichen Personen fest: »Scheeben drängt vom Bild zum Begriffswort, ohne zum Ziel zu gelangen.« (M² 131, Anm.1), H. Mühlen spricht von den »oft unreflexen und in bildhafter Anschauung verweilenden Aussagen Scheebens«, in: Una Mystica Persona, München u.a. ³1968, 447. Dagegen äußert sich Balthasar indirekt positiv, wenn er konstatiert, Scheeben könne »seine Kritiker abfertigen, die ihm ein zu bildhaftes Denken vorwerfen«, Herrlichkeit 1, 104.
394S. die beiden letzten Sätze von D VI n 61: Der mitgeteilte »Geist« oder »Trieb« wirkt »energetisch-gennetisch, wurzel- und quellenhaft, drastisch und elastisch«. Eine verständnisvolle Wahrnehmung der Bilder bei Scheeben, die Etymologie eingeschlossen, findet sich bei Julius Tyciak, Der dogmatische Schriftbeweis bei M. J. Scheeben, Bedeutung und Methoden, Dülmen 1948, z.B. 46–49.
395Zum Bild des Lammes Gottes sagt Scheeben ähnlich, er habe »in der Theologie des heiligen Johannes eine ganz analoge Stellung … wie der Name Sproß bei den Propheten.« Und fügt hinzu: »Und wie so oft die bildlichen Namen in der Hl. Schrift eine weitaus größere Tragweite haben als die nicht bildlichen Namen, wofür sie substituiert werden, so dürfte auch hier der Name Lamm Gottes ein weit reicheres und lebendigeres Bild von dem Verhältnisse des Menschen Christus zu Gott geben als der Name Kind oder Knabe Gottes.« (DV n 828) Zum Namen Christus s.u. in den Ausführungen zur Christologie, vor allem 8.7.
396S. dazu 6.6.
397M² 298.
398Auch hier folgt Scheeben Bonaventura, vgl. dazu von Balthasar, Herrlichkeit II, 1, 297: Es ist »der Sohn Urbild, Idee, Exemplar aller Dinge außer Gott.«
399Vgl. zu diesem für Scheebens Anthropologie, seine »Anthropozentrik«, zentralen Text 5.4.2.
400S. dazu. 8.
401D V § 267, n 1369, s.u. 10.2.
402Zur Adam-Christus-Parallele bei Scheeben Lengsfeld, Adam und Christus.
403Herrlichkeit 1, 98.
404Ebd. 103.
405Balthasar Herrlichkeit 1 I, 103.
406Ebd. 108.
407In D III § 172 spricht Scheeben vom physisch-ethischen Doppelcharakter.
408S. dazu 9.2.
409Vgl. dazu NG 195 f. und die »analytische Übersicht in NG IV,3, 213.
410Vgl. dazu Herrlichkeiten ²1864, 83 f.
411Vgl. dazu Herrlichkeiten 61897, 92: »… dem Geiste nach in sich wiedergebären, indem sie das Wort Gottes gläubig annimmt und gehorsam dem Willen des Vaters nachkommt, der ihr seine Gnade schenken will.« Vgl. ferner. 11./12. Aufl. 1912/1919,115.
412Scheeben stellt dann auch eine Beziehung her zwischen Maria, die den Sohn Gottes »neun Monate unter ihrem mütterlichen Herzen getragen hat« und der Eucharistie, worin ähnlich »der Sohn Gottes« »dem Fleische nach« in uns kommt, »um auch im Fleische eins mit uns zu sein, wie er es mit seiner Mutter ist.« (H 52) Den Hinweis auf die Einheit »dem Fleisch nach« hat Weiss durch »Gnade« ersetzt (ebd.)
Читать дальше