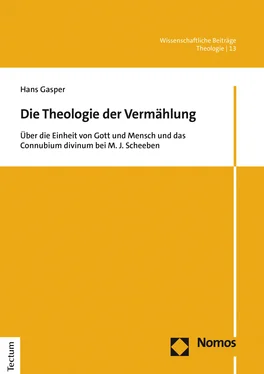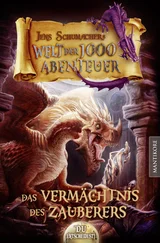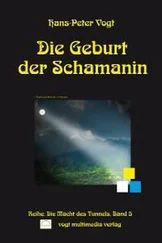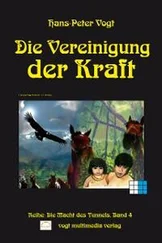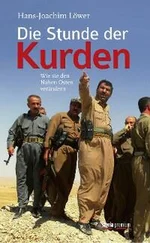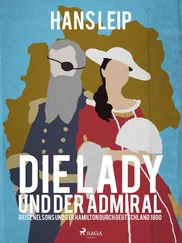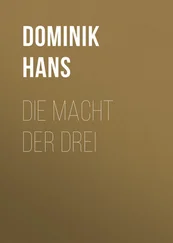Nur in »Abhängigkeit von der Wirksamkeit Christi« ist die Wirksamkeit Marias zu sehen, gleichwohl liege es
»in der katholischen Idee Marias als der neuen Eva, der Braut des himmlischen Adam und des Organ des Heiligen Geistes (kursiv H.G.), daß sie wirklich dazu befähigt und berufen ist, an der Tätigkeit und Wirksamkeit Christi innigster und umfangreichster Weise teilzunehmen …« (D V n 1768)
Natürliches Analogon ist das »Zusammen- und Ineinanderwirken von Haupt und Herz«. Das
»zwischen Haupt und Herz bestehende dynamische Wechselverhältnis des Tuns und Leidens findet hier in dem dynamischen Verhältnisse zweier Personen seine denkbar vollkommene Verwirklichung.« (ebd.)
Das Bild der »Taube« bzw. der »columba« verweist einerseits auf die im Heiligen Geist vorgebildete Jungfräulichkeit der Kirche und der »geweihten Jungfrauen«, aber auch dieses Bild wird bei Scheeben mehrwertig. Es bezeichnet auch die »Mütterlichkeit« des Heiligen Geistes in Bezug auf die Kirche und die Gnade. Mit dem aus der Mose-Tradition stammenden Bild der »Adlermutter« spricht Scheeben von der »maternitas gratiae« und der »gratia mater« und verbindet die Motivstränge »Eva«, »Mutter« und »Leben« bzw. »Lebensmitteilung«. 456Scheeben stellt auch einen Bezug her zwischen dem Bild der »Adlermutter« und der Sonne. Wie der Adler »sein Nest aufweckt … d.h. durch Bebrüten den Inhalt desselben lebendig macht«, »hegend über seinen Jungen ruht«, und dann diese auf sich nimmt und trägt«, so wirkt der Heilige Geist auf das übernatürliche Leben der Seele:
»In der Sprache der Heiligen Schrift aber steht hinwiederum das Bild des mütterlichen Vogels in engster Wechselbeziehung zu dem Bilde des Einflusses der Sonne auf das Wachstum der Pflanzen … Die Strahlen der Sonne werden nämlich im Hebräischen … wie als aufgehende Blüten so auch als Federn und Fittiche betrachtet, welche die Sonne aus sich hervorschießt und über das ihr unterstellte Gebiet ausbreitet, mit welchen sie insbesondere die Pflanzenwelt auf Erden gleichsam brütend bedeckt und hegt und die aufstrebende Entfaltung ihres Lebens fördert.« (D VI n 30) 457
An anderer Stelle spricht er vom Getragensein durch die Gnade wie im Schoß. 458In diesen Begriffen und Bildern sind die ungeschaffene Gnade, also der Heilige Geist, der zugleich als Geist des Sohnes und des Vaters gesehen wird, und die geschaffene Gnade umfasst.
Das Motiv »Mütterlichkeit« des Heiligen Geistes und der Gnade führt zur Mariologie und zur Ekklesiologie, in welcher die »Mütterlichkeit« eine zentrale Rolle spielt, bis hin, in den »Mysterien«, zur »Mütterlichkeit« des Priestertums. 459
»Diese übernatürliche Mutterschaft ist das Zentralmysterium der Kirche als einer organisch gebildeten Gemeinschaft.« (M² 45)
Ein weiteres Bild der Pneumatologie ist das »Blut«, Bild der Liebe und, wie Scheeben auch sagt, »Vehikel« des Lebens. Scheeben verbindet dies ebenfalls mit dem »Herzen«, dem Herzen Christi und der Eucharistie. Dabei greift er auf Traditionen der Hohelied-Auslegung zurück:
»In dem von ihm erfüllten Leibe des Logos saugen wir den Heiligen Geist gleichsam aus der Brust, aus dem Herzen des Logos, aus dem er entspringt, und er ergießt sich wie das Blut aus dem Herzen in die übrigen Glieder, aus dem realen Leib des Logos in die mit ihm substantiell verbundenen Glieder seines mystischen Leibes. Er verbindet sich mit uns und ergießt sich … sowohl als der Odem des göttlichen Lebens, der heiligen Liebe, die hier, wo wir durch die realste Einheit mit dem Sohne so innig mit seinem himmlischen Vater verbunden sind, ihren höchsten Gipfel erreichen soll … « (M² 436)
Das »Blut«, der konsekrierte Wein, erhält damit einen besonderen, vermählungstheologischen Bezug zum Heiligen Geist:
»Die Gestalt des Weines, als Symbol des Blutes, mit ihrer Flüssigkeit, ihrer feurigen Glut, ihrem zugleich kräftigen und lieblichen Duft, ihrer erquickenden, belebenden Kraft, stellt uns nämlich den Heiligen Geist vor, dessen Ausgang aus dem Herzen des Vaters und des Sohnes, dessen Sendung eine Ausgießung, der in sich selbst der Strom und Duft des göttlichen Lebens ist; sie stellt uns ihn hervor als den aus dem Logos als einer göttlichen Traube quellenden Wein der glühenden Liebe, der Erquickung des Lebens, der berauschenden Seligkeit, welche in dem heiligen Blut, das aus dem menschlichen Herzen durch die Gewalt seiner Liebe hervorgepresst worden, über die Welt ausgegossen wurde und uns nun in diesem Blute eingegossen wird.« (ebd.)
Pneumatologisch gibt es also vermählungstheologisch ein ganzes Ensemble von Begriffen und Bildern, das sich zentral dem Bildbegriff »Herz« als Ursprung zuordnen lässt.
3.6 Die Einheit von Seele und Leib als Grundmodell
Man kann über Scheebens Vermählungstheologie nicht sprechen, ohne das Paradigma der Einheit von Geist-Seele und Leib zu behandeln. Es kam bereits mehrfach zur Sprache im Zusammenhang der trinitarisch-christologisch und vermählungstheologisch zentralen Achse von Zeugung und Information, und es wird im Kontext von Schöpfungslehre und Anthropologie ausführlicher behandelt. 460Eine wichtige Rolle spielt es dann in der Christologie und im Zusammenhang der universalen Gesamtschau beim Abschluss von Gnadenlehre und Christologie. 461Diese Linie durchzieht alle Teile von Scheebens Theologie, von der Schöpfungslehre bis zur Christologie und Trinitätslehre. Sie hat große Bedeutung für Scheebens Verständnis von Theologie und für seine theologische Ästhetik. Motive wie »organisches Ganzes«, »Gesamtbegriff« und »Gesamtbild« haben hier ihren Platz. Gleichwohl steht hier ein eigener Blick auf diesen wichtigen Aspekt von Scheebens Vermählungstheologie noch aus. Er ist bisher gewissermaßen mitgelaufen, aber noch nicht ausdrücklich gemacht worden. Die Einheit von Seele und Leib hat nicht bloß die gleiche Bedeutung wie das Vermählungsparadigma in Scheebens Theologie, es ist diesem engstens verbunden, ja ein Teil davon. Die Vermählungseinheit und die Einheit im Leib, mit dem Leib, als Teil des Leibes, vor allem des Leibes Christi, sind komplementäre Größen. Vermählungseinheit ist immer auch analoge Seele-Leib-Einheit. Manchmal mag es sogar scheinen, als sei sie das eigentliche Leitbild, dem die Vermählung untergeordnet ist. 462Das scheint zunächst etwa der Fall zu sein, wenn Scheeben von der Einheit von Mann und Frau spricht, von Christus und Maria, d.h. vom »Connubium divinum« im engeren Sinn, von der Einheit von Christus und er ihm verbundenen Menschheit, von der Scheeben sagt, sie sei mit Christus »ein Christus«. 463Hier liegt jedenfalls der »moralischen« Wechselseitigkeit in der Beziehung formell vorauf eine »physisch-substanzielle« Einheit, eine »organische Einheit«, die der Seele-Leib-Einheit nachgebildet ist. 464
In »Natur und Gnade« spricht Scheeben m. W. zum ersten Mal in seinem theologischen Werk von jenem Bild der Einheit von Leib und Seele. Er sieht den Zusammenhang des durch Zeugung mitgeteilten göttlichen Lebens »vor allem wunderbar ausgedrückt in dem herrlichen Gleichnisse vom Weinstock, wo der Sohn Gottes sich selbst als den Stamm angibt, aus dem das Leben in alle Zweige des Weinstocks einströmt und sich verbreitet.« (NG 77 f.) Er findet die hier liegende Wahrheit sodann
»in jenem so oft wiederkehrenden Bilde, welches so tief und wahr unser Verhältnis zum Sohne Gottes bezeichnet, daß man es kaum ein Bild nennen kann. Ich meine das Gleichnis des menschlichen Körpers, wo wir verglichen werden mit den Gliedern und der Sohn Gottes mit dem Haupte, das alle Lebenskräfte des Körpers in sich konzentriert und von sich ausgehen lässt. Wie das Leben des Hauptes und der Glieder ganz von derselben Art ist, muss auch das Leben, das der Sohn uns mittelt, dem seinigen ähnlich und so viel als möglich von derselben Art sein.« (NG 78)
Читать дальше