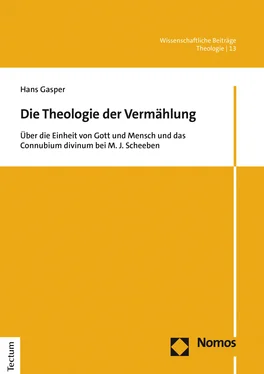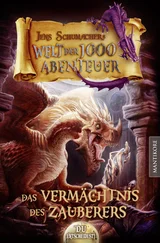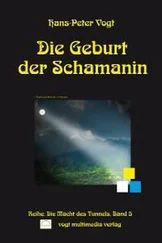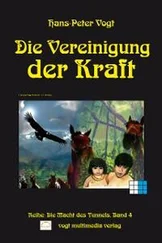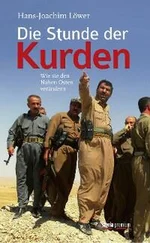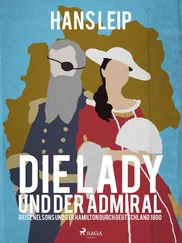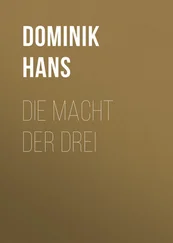Dieser Textabschnitt zeigt bereits einen erheblichen Teil des Erstreckungsraumes der Leib und Seele Metapher. 465Die Einheit mit Christus ist der zentrale Bezugspunkt. Das gilt für diesen Text wie für Scheebens gesamte Theologie, in den »Mysterien«, nicht zuletzt in den dortigen Ausführungen zur Eucharistie und den dort tragenden »Grundbegriff« der »Inkorporation«, 466in der Christologie der Dogmatik. 467Im zitierten Text ist wichtig der Aspekt der Ähnlichkeit des Lebens. Von »Zeugung« als »Verähnlichung« ist zuvor die Rede, von verähnlichender Lebensmitteilung. Die Verähnlichung, von der hier die Rede ist, ist Mitteilung göttlichen Lebens, also »Verklärung«, »Vergöttlichung«, Mitteilung einer höheren Form, »elevatio in formam alteram meliorem et altiorem« eine »translatio in formam divinam«, die eine Art Zeugung aus Gott« ist. 468
Man kann also sagen: Im Paradigma der Seele-Leib-Einheit kommt alles zusammen, was bisher schon zur Verbindungslinie »Zeugung« und »Information« gesagt wurde. Vom Logos, dem Inbegriff aller Gestaltung (vgl. D II n 1004), zu Christus in der Einheit von Gott und Mensch, bewegt sich diese Linie. Dafür steht das Bildwort »Salbung«. Christus, der menschgewordene Sohn Gottes hat sein Vorbild in der Einheit der Seele und des Leibes, in Adam. Die so gefasste Einheit von Seele und Leib bestimmt den Menschen als Kosmos im Kleinen, Abbild des Makrokosmos, und konfiguriert die zentrale Stelle Christi in der gesamten natürlich-übernatürlichen Ordnung, die Verbindung des »Zentralwerks« Gottes, des Menschen, mit dem trinitarischen »Grundprozess«, der Zeugung des Sohnes Gottes. 469Die Einheit von Seele und Leib ist für Scheeben das grundlegende Modell aller Einheit in der Schöpfung, es ist auch das ästhetische Grundmodell. Alle Einheit in und mit einer Person ist deshalb immer Seele-Leib analoge Teilhabe mit dem jeweils ursprünglichen Besitzer. Das wird deutlich an der Einheit von Mann (Adam) und Frau (Eva), an der Einheit von Christus und seinem Leib der Kirche bzw.der ganzen Menschheit bzw. der ganzen Schöpfung. Das zeigt sich im »Connbium divinum«, in der Maria eine der hypostatischen Union analoge Einheit mit Christus hat.
Auch aller Rede bei Scheeben vom »organischen Ganzen« und von »Gesamtbegriffen« bzw. »Gesamtbildern« liegt, wie schon erwähnt, das analoge Seele-Leib-Modell zugrunde. Das »organische Ganze« ist ein Ganzes, das von einem leitenden Prinzip bestimmt wird, welches das Ganze durchformt und es damit zu einem gestalteten Ganzen macht, ist immer analoge Seele-Leib-Einheit. Das gilt vom »organischen Ganzen« des Realen, z.B. geschaffene und ungeschaffene Gnade, aber auch für Scheebens Bemühen, tragende Prinzipien zu einem »organischen Ganzen« zu verbinden. Hier sei auch noch einmal auf das Verständnis von »Natur« hingewiesen, ein »principium motus«, eine »Wurzel«, mit der »Kraft und Tendenz« sich zu einem Ganzen zu entwickeln und zu gestalten.
Das Seele-Leib-Modell ist wie das Vermählungsparadigma in allen Teilen von Scheebens Werk präsent, direkt, etwa wenn von der Schöpfung als gestaltetem Kosmos die Rede ist, vom Menschen, von Christus und vom Leib Christi, von der Eucharistie, von der Ehe, von »substanzieller Gemeinschaft« oder »Wesensgemeinschaft«, in welcher ein »Wesen« und die Verbindung mit ihm das Ganze bestimmt und prägt. 470Indirekt ist dieses Paradigma immer präsent, wenn etwa von »Ganzheitsbegriffen« oder von »Totalprinzipien« gehandelt wird.
Dazu noch einige Anmerkungen. Zum einen ist diese Stellung des Seele-Leib-Paradigmas zunächst insofern überraschend, als bei Scheeben, besonders im Frühwerk, eine eher negative Sicht des Leiblichen dominiert. Es hindert die freie Betätigung des Geistes. Diese Sicht ist ganz besonders in »Natur und Gnade« stark ausgeprägt. E. Paul: »Er betrachtet vom übernatürlichen Leben her, d.h. vom Leben G o t t e s und findet dann eine analoge Lebensgestalt im geistigen Leben der Kreatur. Die Materie kann da nur stören, und Scheeben fängt mit ihr zunächst nichts an.« 471Insofern jedoch das Stoffliche oder Leibliche vom Geistigen bestimmt, durchformt, belebt, erhoben, ja verklärt wird, wird es positiv besetzt. Das Geistige zeigt seine Kraft, indem es das Leiblich-Stoffliche zu seinem Bild gestaltet. Die Einheit von Geist und Leib ist Scheebens zentrales ästhetisches Modell. Das gilt auch, wie bereits angedeutet, für sein Verständnis von Theologie, die dem göttlichen Wirken nachgestaltend ein »organisches« und »harmonisches« »Gesamtbild« schafft. In und mit Christus erreicht die Einheit des geistig-göttlichen Lebens und des geschaffen Leiblichen dann ihre Vollgestalt, in Christus selbst und in der Einheit mit Christus, die über die Menschheit der ganzen Schöpfung gilt. Was bei Scheeben allerdings weitgehend fehlt, ist eine Reflexion, in der etwa der »Geist in Welt«, das »Dasein«, Ort und Ausgangspunkt des geistigen Selbstvollzuges wären. Bei der Gotteserkenntnis gibt es Ansätze. 472
Eheliche Verbindung ist bei Scheeben immer auch analoge Seele-Leib-Einheit, wie die Darlegungen zur Ehe von Adam und Eva und zum »Connubium divinum« im eigentlichen Sinn zeigen. 473Es liegt nahe, hier das »Physische« bzw. das »Substanzielle« dieser Einheit zu sehen, wodurch die Vermählten »ein Fleisch« werden. Das Relationale wechselseitiger Beziehung und Liebe wäre dann das Moralische dieser Einheit, das auf dem »Physischen« aufruht bzw. dieses voraussetzt. Ähnlich könnten dann physische »Verähnlichung« und moralische »Vereinigung« zugeordnet werden. Es ist allerdings dabei zu beachten, dass bei Scheeben von Anfang an und dann immer ausgeprägter das Physische immer auch etwas Moralisches ist, das Moralische etwas Physisches. Ähnlich ist es beim Verhältnis von »Verähnlichung« und »Vereinigung.« Die Elemente dieser Begriffspaare überlappen, ja sie durchdringen sich. Dadurch haben die Begriffe getrennt Unschärfen. Bei der Vermählung von Mann und Frau ist die Zuordnung von Seele-Leib-Einheit und zur Wechselseitigkeit der Beziehung schließlich nicht ohne Ambivalenzen. Es steht das Relationale stark im Schatten der Seele-Leib-analogen Einheit, wodurch die Frau zunächst als Glied oder Organ des Mannes erscheint. Es wird so ein androzentrisches Subordinationsmodell deutlich verstärkt. 474
Abschließend ist also festzustellen, dass die gesamte Vermählungstheologie Scheebens integral auch Theologie analoger Seele-Leib-Einheit ist. Noch einmal: In und mit Christus erreichen sowohl das Seele-Leib-Paradigma wie das Vermählungsparadigma ihre Vollgestalt als Pleroma Christi und als Pleroma Trinitatis. Um einen schon zitiertenText hier nochmal zu wiederholen:
So gipfelt zuletzt die ganze übernatürliche Weltordnung darin, daß Gott in und aus seiner Schöpfung sich seine Kirche als ein in seinem Sohn gründendes und vom Heiligen Geist erfülltes Heiligtum baut und sie mit seinem Sohne als dessen Leib und Braut verbindet, damit sie, wie der Apostel (Eph 1, 23) so schön sagt, die plenitudo (πλήρωμα) dessen sei, qui omnia in omnibus adimpletur.« (D III n 1005) 475
Scheeben fügt hier in die eigentlich a-, besser prälapsarisch-prächristologische Gnadenlehre einen ausdrücklichen Bezug auf die Rekapitulation in Christus ein und schließt so an entsprechende Ausführungen in den »Mysterien« an bzw. ninmt die entsprechenden Passagen der Dogmatik vorweg. 476
Dass und wie Scheeben seine ganze Theologie vermählungstheologisch ausgestaltet, wurde hier überblickshaft gezeigt. Es wird nun an den einzelnen Traktaten gezeigt und ausgeführt. Dabei sind Wiederholungen unvermeidlich. Sie stehen aber jetzt in einem jeweils konkreten traktatbezogenem Kontext.
253S. dazu 7.6.
254S. zum Ganzen vor allem 11.1 u.11.2.
255Man vergleiche dazu den ähnlich gestimmten Text des reformierten Pietisten, Laienpredigers, Dichters und Mystikers Gerhard Tersteegen (1697–1769), die 5. Strophe seines Liedes »Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten«, jetzt auch im GL (GL 387): »Luft, die alles füllet, drin wir immer schweben, aller Dinge Grund und Leben, Meer ohn Grund und Ende, Wunder aller Wunder: ich senk mich in dich hinunter. Ich in dir, du in mir, lass mich ganz verschwinden, dich nur sehn und finden.«
Читать дальше