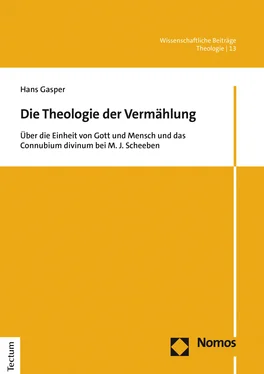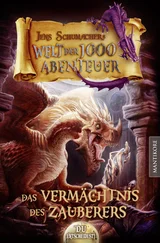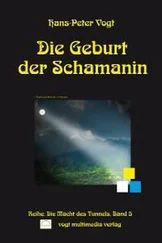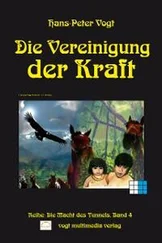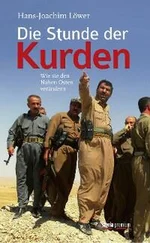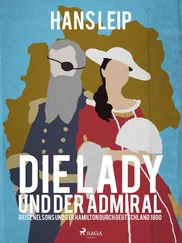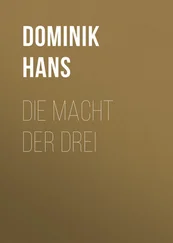256Belege bei Scheeben D III n 695 f.
257S. dazu 11.2.
258S. bes. 11. N. Hoffman stellt seine diesbezüglichen Ausführungen wie bereits angemerkt treffend unter den Titel: »Vergöttlichtes Sein: In Christus durch den Geist«, in: Natur und Gnade«, 261–353.
259Bibliographische Angaben und zu den Auflagen vgl. die Vorbemerkung des Hrsg. Robert Grosche im zweiten Teil von GS 1, III f.
260Vgl. auch hier 11.2.
261S. u. zu den weiteren von Albert Maria. Weiss OP besorgten Auflagen und ab der sechsten Auflage (1897) immer stärker bearbeiteten Auflage. Zu Balthasars Kritik an der »abstrakten Erbaulichkeit« des Werks und zum »leise dualistischen Eindruck« Herrlichkeit I,102.
262In seinem einführenden Essay zum ersten Band der GS schreibt Martin Grabmann: »Scheeben hat diese Vorlage so umgearbeitet und so viel vom Eigenen zugegeben, dass dieses Buch als sein eigenes Werk bezeichnet werden kann.« GS 1, XXVIII.
263In Katholik 40 (1860), I 280–299 und 40 (1860) II 657–674, hier nach GS VIII, 13–42 (= ÜN). Vgl. Briefe, 44.
264Briefe, 44 f. Scheeben vermischt hier den italienischen und den lateinischen Titel. Der Titel des spanischen Originals ist: Del aprecio y estima de la gracia divina, que nos mereció el Hijo de Dios, con su Preciosa Sangre, y Pasión, Madrid, 1638; der korrekte italienische Titel: Del prezzo e stima della divina grazia, Venezia 1715, der Titel der lateinischen Übersetzung: De inaestimabili pretio divinae gratiae, Würzburg 1740. Vgl. dazu die Anm. 37, Briefe, 122 sowie die Vorbemerkung von Robert Grosche in Herrlichkeiten, a.a.O. IIIf.
265ÜN 36–39, hier 36.
266S. dazu 5.
267D § 85.
268M. Grabmann, in:, Natur und Gnade, XXIX.
269M. Roszkowski, Zum Lob seiner Herrlichkeit, bes. 19–63.
270S. D V n 1374 bzw. 11.3.
271Scheeben zitiert Dionysius Areopagita wie schon bemerkt ohne jeden Vorbehalt in »Natur und Gnade« wie in der Gotteslehre, vor allem in den §§ 84 u. 85 über die Güte und Schönheit Gottes. S. dazu 2.2.5.
272Eccl,. Hier. C1 §3. Scheeben kennt auch die andere Reihenfolge, Vereinigung und Verähnlichung. »Est autem deificatio ad Deum quaedam, quatenus fieri potest, assimilatio et unio (ἀφομοίωσις τε καί ἕνωσις)« (D III n 690). Zur Frage, ob die Reihenfolge ein Indiz für die Neubewertung der ungeschaffenen Gnade ist, s. 7.4.1. Die Kontroverse mit Granderath zeigt die reifste Verwendung dieses Begriffspaars: Verähnlichung in und durch Vereinigung, Zeugung bzw. Adoptivkindschaft durch Vermählung.
273S. dazu 7.4.1.
274S. dazu. 6, 7.3.3 u.7.4.3.
275Vgl. dazu v.a. F. S. Pancheri, Pensiero teologico; N. Hoffmann, Natur und Gnade; E. Paul, Denkweg und W. W. Müller, Die Gnade Christi.
276Vgl. Anm. 263.
277Es ist »kaum eine Partie der katholischen Dogmatik, welche in neuerer Zeit so mangelhaft bearbeitet und so falsch aufgefasst worden … als die in den letzten Jahrhunderten unter so vielen Kämpfen in der Kirche und durch dieselben in das hellste Licht gestellte Lehre vom Übernatürlichen.« (ÜN 13 f.)
278»Das Haupt- und Grundübel unserer Zeit ist anerkanntermaßen der Rationalismus … er ist das Streben der menschlichen Vernunft, kein anderes Sein anzuerkennen, als das mit der Natur des Menschen zusammenhängende, keine andere Erkenntnis als die durch die Vernunft selbst erreichbare, nichts anderes als gut für die Liebe und als Richtschnur für das Handeln als etwas, was durch die Vernunft erkannt und mit der Natur, welcher die Natur angehört, zusammenhängt.« (ÜN 18)
279S. dazu 5.4.
280S. dazu 5.3.
281S. dazu 5.4.2.
282S. dazu 11.1.
283Zur Kritik von A. Schmid an Scheeben und die Verarbeitung dieser Kritik durch Scheeben E. Paul, Denkweg, 30 f.
284Vgl. dazu die Hinweise auf F. S. Pancheri u. Hoffmann in 3.2.8.
285»Um den Unterschied der beiden Ordnungen der Erkenntnis und Ethik allseitig und gründlich zu verstehen, muß man beide auf ihre gemeinsame Grundlage, eine doppelte ontologische Ordnung zurückführen; weil diese die Quelle und das Maß der Erkenntnis und der Liebe in subjektiver und objektiver, in formeller und materieller Beziehung ist.« (NG 11)
286E. Paul, Denkweg, 47
287Scheeben unterscheidet hier formal die göttlichen Tugenden von der heiligmachenden Gnade als Wurzel, um aber das formal Distinkte auf ein Ganzes zu beziehen.
288S. dazu 7.3.1.
289S. 7.6., bes. 7.6.5.
290Zur innigen Gottbezogenheit der Schöpfung D II und D III, s. dazu 5.2.
291Im Zusammenhang der Behandlung der concursus-Thematik D III § 131, hier D III n 50.
292S. dazu 5.2. Das gilt für die Schöpfung wie für die Erhaltung, vgl. D III n 35; kausal meint: Wie der Lichtquell die causa des Leuchtens ist und die Seele die der Seelenakte, so trägt analog Gott zuinnerst das geschaffene Sein.
293Es geht um die »ekstatische Liebe Gottes«, die aus sich herausgeht, sich »entäußert«, um die Schöpfung zu sich zu führen. »Weil aber das Aussichherausgehen der göttlichen Liebe wesentlich darauf abzielt, die Kreaturen zu Gott als ihrem letzten Ziel und Ende hinzuführen und mit ihm als dem höchsten Gut zu vereinigen: so kehrt die göttliche Liebe in ihrer Bewegung nach außen immer wieder zu Gott zurück, und dies ist jener berühmte Zirkel der göttlichen Liebe, von dem Dion. Vulg. redet.« In Abschnitt D II n 580 folgt ein langes Zitat aus dem einschlägigen Text des Dionysius, DN Kap. 4. S. zum Text B. R. Suchla (Hrsg.), Pseudo-Dionysius Areopagita. Die Namen Gottes, Kap IV, 14, 52 f.
294Er ergänzt:»Gott ist darum als Subjekt oder Inhaber des Guten absolut und in einziger Weise liebenswürdig, weil alles Gute, welches Objekt des Besitzes sein kann, nur in ihm und durch ihn besteht, und folglich schon das Wohlgefallen daran, daß überhaupt Gutes existiere und bestehe, notwendig auch darauf gerichtet sein muss, dass es in ihm existiere und bestehe.« (D II n 325).
295Ausführlich s. 5.4.
296L. Scheffczyk, Organische und transzendentale Verbindung, 164 f.
297»jedes Wesen, in was immer für einem Zustande, hat in sich eine aktive Kraft und Tendenz, nach dem ihm eigentümlichen Guten zu streben, dasselbe, wenn auch nicht ohne äußere Hilfe, in sich zu verwirklichen und so sich allmählich seiner zu seiner Vollendung zu entwickeln, seinen Zweck zu erreichen und zu dem ihm angemessenen Ziele sich hinzubewegen.« (NG 33)
298S. dazu NG 37–43.
299S. dazu NG 43–60.
300Vgl. zu Augustinus auch NG 58.
301»Sie wollen aber nicht den Grund angeben, warum der Geist jene Bestimmung habe erhalten müssen, sondern warum er sie habe erhalten können. Und wenn sie jenes Ziel das einzige letzte Ziel nennen, geschieht es nur darum weil es wirklich allein das höchste und letzte ist, zu dem der Mensch gelangen kann, während das natürliche Ziel viel tiefer liegt und gewissermaßen nur eine Vorstufe zu jenem bildet.« (ebd.), vgl dazu D VI n 590 ff.
302Vgl. dazu Henri de Lubac, Surnaturel. Etudes Historiques, Paris 1946 (Neuauflage Paris 1991) und ders., Die Freiheit der Gnade, Bd. 1, Das Erbe Augustins, Einsiedeln 1971, Bd. 2, Das Paradox des Menschen, Einsiedeln 1972.
303Am Ende von »De ente supernaturali« habe dieser festgestellt: »nolo ulterius stringere, ne saguinem emungam« – ich will nicht weiter drücken, um nicht das Blut herauszupressen. (NG 29)
304S. den Hinweis des Hrsg. von Bd. V der GS, W. Breuning: »Der substantivische Begriff ›Übernatur‹ in der Anwendung auf die Gnade wurde m. W. zuerst von Anton Günther gebraucht«, in ebd. n 273.
305S. dazu 5.4.
306. Zur gesamten Thematik des »desiderium naturale« bei Scheeben Hoffmann, Natur und Gnade, 73–78, bes. Anm.128, 132, 137 u. 138. Paul Denkweg, 121–124; Kleins ganze Arbeit ist diesem Thema der Gottebenbildlichkeit gewidmet, Grundsätzliches dazu bes. Kreatürlichkeit, 48–71 u. 240–243; Pancheri, der hier ebenfalls das Zentrum von Scheebens Anthropologie sieht, bemerkt eine klare Differenz zu Thomas zu Gunsten von Bonaventura, a.a.O. 322–349: »Il suo vero maestro nell’antropologia è S. Bonaventura«, wobei maestro hier »Lehrer« meint, Pensiero teologico, 331.
Читать дальше