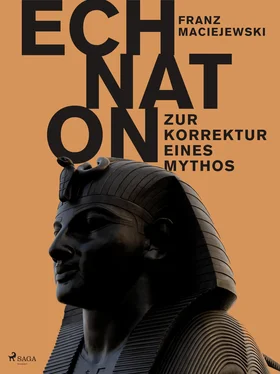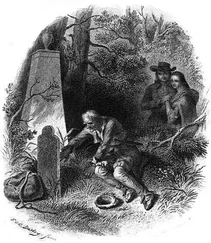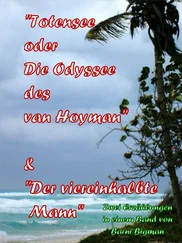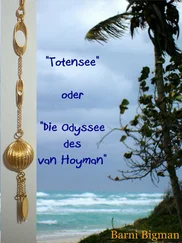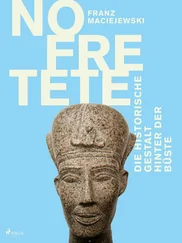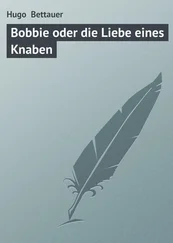Auch das frühe Sed-Fest dient der religionspolitischen Zementierung des prekären Machtgefüges zwischen dem Geschlecht der Thutmosiden und dem Hause Juja. Dass es sich um herrschaftssichernde Königstheologie handelt und nicht um das Weiterspinnen einer monotheistischen Sonnentheologie, belegt das Nebeneinander des Aton mit den anderen Gottheiten. Die traditionelle Göttervielfalt ist beim Erneuerungsfest des Königs noch unangetastet geblieben. Erst Echnaton der Amarnakönig legt Jahre später Hand an die alte Komplementarität von Gott und Göttern. Als er die Zügel der Macht endlich in die Hand nimmt, radikalisiert er eine Entwicklung, die ursprünglich anders gemeint war. Und doch hat Achetaton als Ganzes die polytheistische Semantik, die seit alters her ein Oszillieren zwischen dem Einen und den Vielen war, nicht wirklich durchbrochen. Die sich zunehmend dogmatisch gebende Monolatrie, die das Königspaar ausübt, wird seitens der erweiterten Atongemeinde konterkariert durch die Verehrung einer Trias aus Aton, Echnaton und Nofretete – und der Duldung von nachrangigen Gottheiten. Nicht in der Stiftung einer monotheistischen Religion, sondern – so die hier vertretene These – in der Errichtung eines Gottesstaates des Aton verbirgt sich die revolutionäre Tat des Echnaton. Zum ersten Mal in der Weltgeschichte vollzieht sich in Amarna die Umbuchung der politischen Bindungen auf Gott. Der Kult feiert und erneuert die unumschränkte Königsherrschaft des Gottes im heiligen Bezirk von Achetaton, in dem der junge Pharao als dessen erster Prophet auftritt.
Mit der Neubewertung der Tat des Echnaton – Theokratie statt Monotheismus – fällt auch auf die Gedächtnisgeschichte von Amarna ein neues Licht. Im Assmann’schen Entwurf ist die lange unterirdisch verlaufende Erinnerungsspur der verdrängten Atonreligion erst nach Ablauf eines Jahrtausends wieder greifbar – am Material einer fragmentarischen und mehrdeutigen Legende. Ein problematischer Befund. Der vorgeschlagene Perspektivenwechsel lenkt dagegen den Blick auf eine weitere theokratische Gründung auf ägyptischem Boden nur 250 Jahre nach Amarna: den thebanischen Gottesstaat des Amun. Erst in dieser Gegenüberstellung wird die Rede von Trauma, Verdrängung und Wiederkehr des Verdrängten konkret. Ethnopsychoanalytischem Verständnis zufolge kann die Aufrichtung des Gottesstaates des Amun als weitgehend unbewusste Reaktionsbildung auf den Gottesstaat des Aton verstanden werden – mithin als eine traumatische Reinszenierung. Träger dieser Bewegung war offensichtlich die entmachtete und gedemütigte Amun-Priesterschaft, die bestrebt war, die historische Niederlage über den bekannten Mechanismus einer »Identifikation mit dem Aggressor« in ihr Gegenteil zu verkehren und so ungeschehen zu machen.
Die zu Trittsteinen einer noch weithin unaufgedeckten Gedächtnisgeschichte verbundenen Theokratien von Amarna und Theben lenken den Blick unwillkürlich out of Egypt : auf das nachexilische Juda, wo die theokratische Semantik des Gottesstaates geschichtlich ein drittes Mal Fuß fassen konnte. Ist der judäische Gottesstaat (auf den Josephus Flavius den Begriff Theokratie ursprünglich gemünzt hat) jenseits der angeblichen Wirkungsgeschichte des monotheistischen Geistes in Wirklichkeit durch das jahrhundertelange Beispiel des thebanischen Gottesstaates beeinflusst worden? Mit der hier aufblitzenden »Nähe Amuns zu Jahwe« (Manfred Görg) verliert die von Jan Assmann postulierte Verbindung Echnatons zu Moses weiter an Plausibilität. Als Marker des Wiederauftauchens der traumatischen Amarnaerinnerung ist der Bericht des Manetho ohnehin nur bedingt geeignet, weil in ihm das Gedächtnis vieler anderer Leidenszeiten eingeschrieben ist. In ihrem Kern ist die »Legende von den Aussätzigen« eine polemische Gegengeschichte zur jüdischen Exoduserzählung, die (vergeblich) versucht, die historisch bezeugte Vertreibung der Hyksos aus Ägypten mit dem mythischen Auszug der Israeliten, der zweiten semitischen Großgruppe, in ein Verhältnis zu bringen. Alle Missverständnisse haben damit zu tun, dass die antiken Autoren (und in ihrer Nachfolge nicht wenige der christlichen Autoren von heute) leichtfertig die »Hebräer in Ägypten« als geschichtliche Größe ernst genommen und wahlweise mit den Hyksos selbst identifiziert oder als Platzhalter einer ägyptischen Großgruppe wie der Atongemeinde von Amarna wahrgenommen haben. Werden die Fäden von Geschichte und Gedächtnisgeschichte wieder auseinandergehalten, findet das Verwirrspiel um Moses den Ägypter ein Ende.
Unbeschadet dieser Einwände lenkt die These, bei Moses handele es sich um eine verschobene Erinnerung an den verdrängten Pharao, den Blick auf die mythologische Ebene; sie hat in der Amarnageschichte bis heute keine deutliche Kontur erfahren und sollte deshalb nicht leichthin verworfen werden. Ist es möglich, dass die Gestalt des Echnaton in einem anderen als dem biblischen Mythos verdeckte Spuren hinterlassen hat? Erinnern wir zunächst noch einmal an den besonderen historischen Raum, in dem Amarna angesiedelt ist: die späte Bronzezeit. Diese Zeit ist im kulturellen Gedächtnis des Abendlandes als heroische Epoche lebendig geblieben. Vor allem die griechische Antike hat diese Erinnerung wachgehalten und dabei den Untergang des heroischen Zeitalters auf die Kriege um Theben und Troia bezogen. Ihre Helden, Ödipus und seine Söhne nicht anders als Agamemnon oder Achill, bevölkern eine glänzende Vorwelt. Es ist, wenn wir uns die Fiktion gestatten, die Geschichte vor der Kulisse des Mythos abspielen zu lassen, die Welt von Theben, Amarna und Piramesse. Steckt im göttergleichen Geschlecht der letzten Thutmosiden und ersten Ramessiden die historische Vorlage für das göttergleiche Geschlecht der Heroen? Für den Kampf um Troia lässt sich zeigen, dass der gewaltige gedächtnisgeschichtliche Raum, in dem die Ilias Platz greift und den das Epos mit einer verwirrenden Vielfalt von Erinnerungsfäden vernetzt, von zwei ägyptischen Großereignissen begrenzt wird: durch die Schlacht von Kadesch (1275/4 v.u.Z.) auf der einen, die Eroberung Thebens (663 v.u.Z.) auf der anderen Seite. 9Lässt sich Ähnliches für den zweiten Mythenstrang sagen? Gibt es eine Verbindung zwischen dem siebentorigen Theben im Lande Böotien und dem »hunderttorigen Theben« im Land der Ägypter, das Homer besungen hat? Ist König Ödipus der zu Echnaton passende Mythos? 10
Unter dieser Fragestellung soll in behutsamer Weise der mythologische Bodensatz gefiltert werden, in dem die Amarnageschichte auf andere Weise überlebt haben könnte. Es ist dies zugleich – nach den unter den Stichworten Machtpolitik, Sexualpolitik, Religionspolitik und traumatische Gedächtnisgeschichte skizzierten Ebenen – die letzte Schicht, mit welcher der Sondierungsschritt zur Formulierung einer alternativen Sinngeschichte sein Ende findet. Zu den Eckpfeilern des neuen Erzählgebäudes, dessen Solidität und Standfestigkeit sich in den nachfolgenden Kapiteln zu beweisen hat, zählen – thesenhaft gebündelt – diese Aussagen:
Das bewegende Geschichtsmoment der Amarnazeit ist ein vom Hause Juja betriebener Dynastiewechsel und nicht die Erfindung des Monotheismus.
Zum Machterhalt werden inzestuöse Verwandtschaftsverhältnisse auf Dauer gestellt, welche letztlich den Untergang der Thutmosiden heraufbeschwören.
Die religionspolitische Großtat Echnatons besteht in der Aufrichtung des weltgeschichtlich ersten Gottesstaates in Achetaton.
Im thebanischen Gottesstaat des Amun erlebt die untergegangene Theokratie von Amarna nach Jahrhunderten eine traumatische Wiederkehr.
Nicht in der Gestalt des biblischen Moses, sondern in König Ödipus könnte sich eine verschobene Erinnerung an König Echnaton erhalten haben.
Sämtliche Bausteine meiner Argumentation stammen aus dem Fundus, den die Forschung zusammengetragen hat. Das heißt, ich selber werde keinen neuen Sensationsfund präsentieren, sondern die vorhandenen Materialien – als handele es sich um verstreute Talatatblöcke 11– neu zusammensetzen und deuten. Keines der zentralen Zeugnisse der Monumente und Keilschriften, der Hymnen und Inschriften, der Kunst und Architektur wird dabei unberücksichtigt bleiben. Alles, was hier erzählt wird, wurde schon einmal erzählt – nur bruchstückhaft oder in anderer Reihenfolge und mit anderem Zungenschlag. Diese Arbeit will nicht das Sichtbare wiedergeben, sondern (nach dem schönen Wort von Paul Klee) sichtbar machen. Die Leser werden eingeladen, Amarna zu verlassen, um von außen einen neuen Blick auf die erweiterte Epoche zu werfen. Das schließt ein, dass die Sache nicht nach der herkömmlichen Weise chronologisch abgehandelt wird. Die Kapitel des Buches schließen aneinander vielmehr an wie die Teile eines Puzzles. Sie müssen passen, Sinn machen und neue Möglichkeiten eröffnen. Das ist ihre Ordnung. Eine Ordnung, die es mit sich bringt, dass zuweilen etwas vorausgeschickt werden muss, was erst später eingeholt werden kann. Und so beginnt die ägyptische Reise in Hattuscha, der Hauptstadt des bronzezeitlichen Hethiterreiches, um nach langer Fahrt in der griechischen Thebais zu enden, dem Schauplatz einer Tragödie, die wir möglicherweise als fernes Echo auf den Aufruhr von Amarna verstehen müssen.
Читать дальше