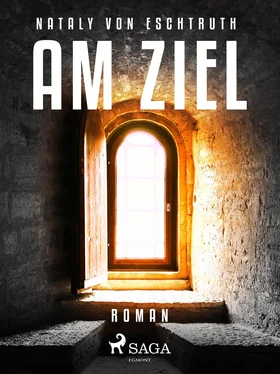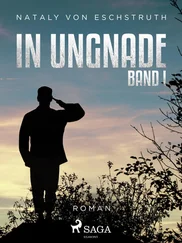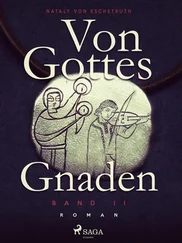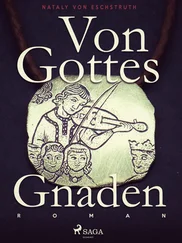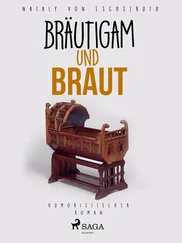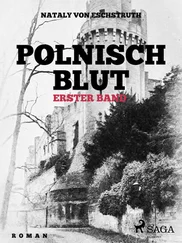Nataly von Eschstruth
Roman
Saga
Am Ziel
© 1901 Nataly von Eschstruth
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711472835
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com– a part of Egmont, www.egmont.com
Es brängen und jagen die Menschen so viel —
Nach einem entfernten, verschleierten Ziel,
Ob sie’s erreichen? —
A. Müller.
Eine stille, klare Winternacht. Der Vollmond schwebt am wolkenlosen Himmel, die Sterne funkeln und blitzen, wie ein schimmerndes Märchengebild liegt der bereifte Wald.
Die Berge ragen an drei Seiten hoch und schroff empor und treten nur nach Süden hin breiter auseinander, um einem langgestreckten, lieblichen Tal Platz zu schaffen, einer herrlichen, fruchtbaren und meilenweiten Talebene, die wie ein kleines Paradies inmitten des Hochgebirges hingestreckt liegt.
Mächtige Waldungen ziehen sich an den Berghängen empor und dehnen sich noch meilenweit im Tale hin, durchschnitten von dem krausen Silberband eines Flüsschens, das hell und wild von den Felsen herabschäumt und geschwätzig in die fremde Welt hineinsprudelt. Selbst jetzt hat der Frost vergeblich die glitzernden Arme nach ihm ausgestreckt.
In gemächlicher Höhe über dem Tale hebt ein trutziger Herrensitz seinen Wartturm aus den Eichwipfeln.
Im Winter hatte Schloss Kochenhall stets einsam und verlassen in tiefem Schlaf gelegen; selten, dass Burgwart, Jäger und Verwalter mit ihren Familien aus dem Schlosshof und ihrem stillen, weltentrückten Heim herauskamen; die Wege waren verschneit, das nächste Dorf lag immerhin weit ab, und wer da zu Fuss gehen musste, der tat es nur in schlimmster Not.
In diesem Jahre aber blitzten die Fensteraugen von Kochenhall Abend für Abend zu dem stillen Tal hernieder, gleichviel, ob der Herbst ins Land zog, ob der November schon ganz plötzlich einen grimmen Frost und Schneefall mit sich brachte.
Der junge Graf Thum, der mit seiner Gemahlin zu Anfang September in Kochenhall eingetroffen war, um mit vieler Dienerschaft, Wagen und Pferden und etlichen Gästen die Herbstjagden abzuhalten, schien die Abreise in diesem Jahre total vergessen zu haben.
Und das hatte seinen guten Grund.
In der Residenz, die das gräfliche Paar bewohnte, war, wie leider schon so oft, eine heftige Typhusepidemie ausgebrochen, die die Rückkehr nach M. vorläufig unmöglich machte.
Da die Gräfin sich leidend fühlte und die Anstrengungen einer erneuten Badereise oder eines Aufenthalts in dem Süden scheute, zog sie es vor, in Kochenhall zu verbleiben, bis die Gefahr einer Ansteckung in M. vorüber sei. In wenig Wochen pflegte man gewöhnlich der unheimlichen Seuche Herr zu werden, das wusste Graf Thum, und war darum um so betroffener, als Woche um Woche verstrich, ohne günstigere Nachrichten aus M. zu bringen. Je längere Zeit aber verging, um so unmöglicher war es für die Gräfin, zu reisen, und als man sich eines Morgens in dem stillen hochgelegenen Schloss „eingeschneit“ fand, beschloss das gräfliche Paar, nun wohl oder übel den Aufenthalt in Kochenhall über den ganzen Winter auszudehnen, und traf dementsprechend alle so wichtigen und eiligen Vorbereitungen.
Dem Reichtum ist nichts unmöglich, auch nicht, auf einsamem Bergschloss eine Haushaltung unter erschwerenden Umständen zur Winterzeit einzurichten.
Die Equipage mit dem eleganten Viererzug fand auch über verschneite Pfade ihren Weg, und sie brachte alle jene Personen, die auf Kochenhall nötig wurden, herzu, — den Arzt, die Wärterinnen und die Amme, — und über die altertümliche Zugbrücke rollten die Gepäckwagen, die Vorräte in das Schloss schafften, als sollte dieses einer jahrelangen Belagerung standhalten!
Und nun war es eine stille, klare Winternacht, und in Kochenhall leuchtete Licht aus allen Fenstern, bis weit in das schlummernde, schneeweisse Tal hinab, so dass die schlanken Rehe staunend im Park standen, den fremden Glanz anzustarren.
Gräfin Theodora aber lag in den spitzenbesetzten Kissen des seidenen Himmelbettes, mit geschlossenen Augen und einem feinen, scharfen Schmerzenszug um die blassen Lippen, still und regungslos, — „heldenhaft mutig!“ wie der Arzt im Nebenzimmer dem Grafen zuflüsterte, als dieser seine unruhige Promenade über den dicken Smyrnateppich einen Augenblick unterbrach, um die feuchtperlende Stirn mit dem breitkantigen Sporttaschentuch zu trocknen.
Die Gräfin schlief nicht. Ihre Gedanken waren lebendiger und erregter als je.
Sie dachte zurück.
Vor vier Jahren war es gewesen, als sie, die vielgefeierte, bildschöne Tochter des Generals von Teutin, ihre Hand dem Grafen Alexis von Thum gereicht hatte.
Sie war stolz und glücklich, hochbefriedigt gewesen, denn ihr Gatte bot alles, was eines Weibes Herz begehren kann, stattliche Jugend, ritterlichen Edelsinn, ein frisches, liebenswürdiges Wesen, das sein männlich hübsches, offnes Gesicht charakterisierte, und last not least einen uralten Grafentitel, ein enormes Vermögen, das diesem Titel auch die nötigen Mittel garantierte.
Ja, Graf Alexis war wohl die beste Partie des ganzen Landes, — und hätte wohl jedes Weib vollkommen glücklich und zufrieden gemacht, nur nicht eine Theodora Teutin.
Nicht dass ihre Ehe eine unglückliche gewesen! Die Gräfin liebte ihren Gemahl und erkannte all seine Vorzüge in rückhaltloser Weise an, ja, sie hätte wohl nichts zu tadeln und nichts mehr zu wünschen gehabt, wenn ... ja, wenn dieses „wenn“ nicht gewesen wäre! Theodora von Teutin war kein Durchschnittscharakter, sie war ein eigenartiges Wesen, das nicht den Pfad all der harmlosen, lebensfrohen, toleranten Mitschwestern ging. Ein Erbteil ihres Vaters war ihr in die Wiege gelegt und begleitete sie wie ein grauer Schatten auf ihrem sonnigen Lebensweg: der Ehrgeiz, wie er wohl die Brust strebender Männer durchflammt, selten aber Frauenherzen höher schlagen lässt.
Und was den Ehrgeiz jedweder andern Dame voll befriedigt hätte: die reiche Gräfin von Thum zu sein, — das deuchte ihr im Gegenteil nur die goldene Schale, auf der Besseres serviert werden musste: Macht, Stellung, Einfluss!
Just diese aber besass Graf Alexis nicht. Er war ein reicher Mann, — mehr aber nicht. Von nachsichtigen Eltern erzogen, hatte er nur das Notwendigste gelernt, was zur Bildung eines vornehmen Menschen nötig ist, der Sport überwog die Kenntnisse, und die heitere Lebensfreudigkeit den Ernst, der studiert, strebt, ringt und sich ein hohes Ziel setzt. Der einzige Beruf, dem Graf Alexis sich gewidmet hätte, wäre derjenige des Offiziers gewesen.
Er hatte auch bereits sein Fähnrichexamen gemacht, als eine sehr heftig auftretende Blinddarmentzündung ihm das Reiten auf Jahre hinaus unmöglich machte, und da der anstrengende Dienst in einem Gardegrenadierregiment erst recht Schwierigkeiten bereitete, so sah der junge Graf mit einem heiteren Lächeln und ohne die geringsten Seelenkämpfe von einem Eintritt in die Armee ab und lebte fröhlich und guter Dinge als freier Mann von seinen Renten.
Und das war der Gifttropfen, der in den Freudenbecher der Gräfin fiel.
Die Tatenlosigkeit ihres Mannes deuchte ihr geradezu unbegreiflich.
Wie war es möglich, dass ein begabter Mensch müssig durch das Leben bummelte, ohne den brennenden Wunsch zu hegen, auf der Leiter des Ruhms emporzusteigen, hoch — immer höher bis zu einem schwindelnden Ziel, von dem man auf seine Mitmenschen herabblickt wie der Adler auf das Gewürm, das ohnmächtig am Boden kriecht!
Читать дальше