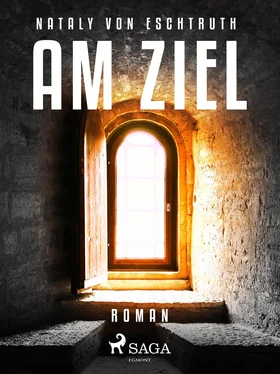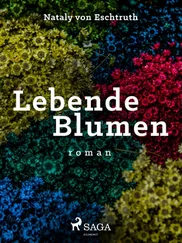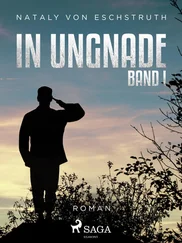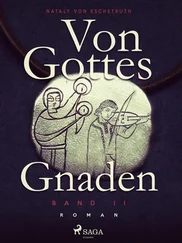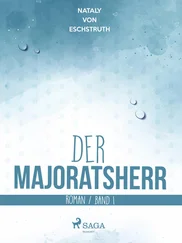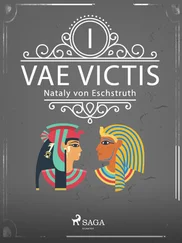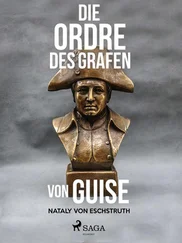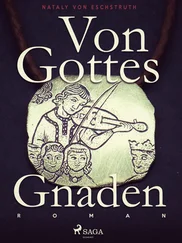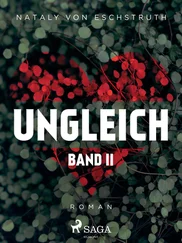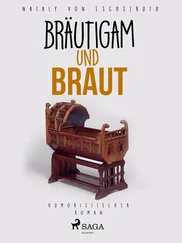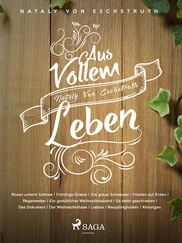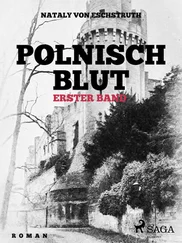„Wie meinst du das, Zirblerin?“
„Ich hab’ so denkt, eine Schand’ wär’s grad nit fürs Hascherl, wenn der Graf oder die Gräfin droben seine Taufpaten werden möchten. So ein Herr sorget schon für den Buben und tät’ ihm aushelfen, wann er einmal eine Hilf’ brauchet.“
Die Susei lachte hell auf, und der Feldjägerleutnant stimmte fröhlich ein.
„Gott bewahre, Zirblerin! Sie hat ja plötzlich den Hochmut g’kriegt! — Der Graf der Pate zum Friedel? Wozu das? Wäre mir leid um den Buben, wenn er so ein Lapperl würde, dass er Hilfe brauchte, um es in diesem Leben zu was zu bringen. Selber ist der Mann! Almosen taugen nie etwas, aber die Taler, die man mit seiner Hände Arbeit, aus eigner Kraft, erwirbt, die klingen! Schaut, Zirblerin, ich denke, unser Junge braucht kein Gängelband, der läuft allein seinen Weg!“
„Das schon; aber ob der Weg zum Glück oder ins Elend führt, das ist die Frag’.“
„Ein jeder ist seines eignen Glückes Schmied, Zirblerin, und kein Mensch kann zuvor wissen, wo des andern wahres Glück blüht, — drunten oder droben. Behagt’s dem Friedel mal, emporzukommen, ei, so mag er kraxeln und sich selber sein Ziel stecken, — erreicht er’s, nun so hat er es selber gewollt, und des Menschen Wille ist sein Himmelreich, während das Schönste und Beste, wenn es aufgezwungen ist, den querköpfigen Menschenkindern selten nach Geschmack ist! — Wenn der Friedel ein Flank wird, nutzten ihm zehn Grafenpaten nichts, wenn er aber ein fescher Kerl ist, der sich selber sein Ziel setzt — dann braucht er keine Hilfe, dann erreicht er’s doch!“
„So lassen wir’s dabei, in Gottes Namen,“ seufzte die Zirblerin, „möglich, dass er so auch zurechtkommt!“
Der Seehofer und die Susei drückten sich die Hände und sahen sich fest in die strahlenden Augen, nickten einander voll heiterer Zuversicht zu und küssten sich.
„In Gottes Namen!“ wiederholte die junge Frau leise.
„Abschied nehmen — sagt er,
Ist nit fein — sagt er,
Und es muss halt — sagt er,
Dennoch sein! — sagt er,
Wisch’ die Äugerln — sagt er,
Sachte aus — sagt er,
Fallt ein Tränerl — sagt er,
Still heraus!
Österreichisch.
Es schien beinahe, als ob die gräflichen Herrschaften der Zirblerin Ansinnen erraten hätten und es dem jungen Paar im Forsthaus recht nahelegen wollten, des kleinen Friedels Taufpate aus dem Schloss zu holen.
Die Gräfin hatte schon wiederholt in das Forsthaus herabgeschickt, Körbe voll Wein, Süssigkeiten und seltener Früchte, und dabei nach dem Befinden der Frau Seehofer und ihres Erstgeborenen fragen lassen, und sie hatte so viel wissen wollen, wie schwer das Büblein gewogen habe und wie es ausschaue, und ob es viel schreie oder zur Nachtzeit gut schlafe, und ob es die junge Mutter selber nähre, oder ob es eine Amme habe, und was dergleichen mehr war.
Die Zirblerin tat sich auf all diese Freundlichkeit viel zugute und gab prompten Bescheid: „Wägen oder messen täte sie das Hascherl nit, denn das bringe Unheil und tauge nichts, aber das Bübli sei gar ein strammes und habe wohl gleich mehr gewogen als ein halbwüchsiges Rehkitz oder ein feister Novemberhas. Und die Susei wär’ ein kerng’sundes Leut und gäb’ dem Söhnli selber die Brust, und schreien tät der kleine Flank gar wohl, zuerst auch nächtens, aber nun gewöhn’ er sich an die Weltordnung und gäb’ einen Fried! — Und wenn’s vergunnt wär’, dann wollte sie, die Ambrosia Zirblerin, selber mal zum Schloss hinaufsteigen und der Gnaden Frau Gräfin Bescheid und schön’ Dank bringen, denn vorerst könne die Susei noch nicht in den Schnee hinaus.“
Der Feldjägerleutnant, der auf einer Jagd mit dem Grafen zusammengetroffen und nebst dem Oberförster aufs Schloss geladen ward, machte zuvor seinen Besuch bei der Gräfin und hatte auch den kleinen Eckbrecht zu sehen bekommen.
„Zart ist das Kind, so recht ein Prinzlein aus blaustem Blut,“ sagte er, „aber gesund ist er, und wenn sie ihn recht frank und frei aufwachsen lassen, kann er sich mit unserm derben Schlingel schon getrost mal raufen!“
Und dann kam die Zeit, wo auch die Susei in der kleinen Halbchaise des Vaters zum Schloss fahren konnte. Ihre frische, blühende Schönheit, ihr herziges, kindlich treues Wesen, das bei aller Harmlosigkeit doch nicht der städtischen Formen und des feinsten Taktes entbehrte, entzückte die Gräfin ungemein. Die beiden Büblein bildeten das Band, das die jungen Mütter unwiderstehlich zueinander zog, und es war bald eine gewohnte Sache, dass die gräfliche Equipage vor der Obersörsterei hielt, um Theodora als herzlichst begrüssten Kasseegast zu bringen.
Da wiegte sie auch den kleinen Friedel auf den Armen, ganz entzückt von dem rosigen, lachenden Schelm mit den blanken, rehbraunen Augen und dem blonden Krakeelstrupp über der Stirn, der dem Kleinen ein gar lustiges, fideles Ansehen gab.
Sie Zirblerin leistete wahre Wunderdinge der Backkunst, und wenn die grosse, braune Kaffeekanne auf dem blendend weissen Tischtuch stand und die Alte die buntgeränderten Schüsseln voll Spritzkuchen, Kräpfli, Nestli und Rahmkuchen auftrug, dann konnte sie nichts stolzer machen und mehr beglücken als der entzückte Ausspruch der Gräfin: „Mir deucht, Frau Zirblerin, so gut wie hier hat mir der Kaffee und Kuchen noch nie geschmeckt!“
„Gott geseg’ns der Frau Gräfin!“ — knickste die Alte und hatte die grösste, allergrösste Tasse für den hohen Besuch herzugerückt, denn so Not leiden, wie im Schloss, wo die Schälchen knapp so gross waren wie ein Fingerhut, — nein, das sollte kein Gast in des Oberförsters Hause!
Die Zeit verging, die Schneewolken verzogen, und die weissen Alphäupter hoben sich glänzend gegen den blauen Himmel.
Lawinen stürzten fernab zu Tal, und die Gebirgsbäche und das Flüsschen schäumten hoch über und verwandelten die Talwiesen in einen weiten, glänzenden See.
Der Föhn sauste feuchtwarm durch die Schluchten, und die zarte Fussspur des Lenzes ward sichtbar in tausend jungen Grashalmen, tausend frischen Moosspitzen und schwellenden Knospen. Wundervoller frischherber Duft würzte die Luft, über Nacht rieselte der Regen und trommelte an die Fensterscheiben, und das Stinli konnte sich kaum noch bergan schleppen, so klebte das Erdreich an seinen Nagelschuhen.
Die gräfliche Familie war nach der Residenz abgereist und beabsichtigte erst im Spätsommer wieder nach Kochenhall zurückzukehren, und auch das Susei ging mit glänzenden Augen umher und rüstete sich zum Abschied. Der lag schon jetzt wieder wie eine unheilschwangere Wolke über dem Forsthaus; all die frohen Gesichter hatten sich in trübselige Mienen verwandelt, und die Seufzer waren zahlreicher als das Lachen und Singen, und der Zirblerin und des Roselis Augen sahen oft so rot aus, dass der Schürzenzipfel nimmer davonkam. Selbst der Hiesel, der wohl hier und da eine gotteslästerliche Red’ vollführt hatte, sonst aber ein frommes Mannsbild war, liess gar nicht mehr ab von grausigen Schwüren und Flüchen, aber er wischte sich auch die Augen dazu, und selbst ein Geselchtes und die Mass Bier schmeckten ihm nicht mehr.
„Was hast nur, Hiesel, bist krank?“ fragte die Susei herzlich und legte ihm die Hand auf die Schulter. Da wandte er sich zur Seite.
„Ich kann nit schlafen!“ brummte er. „Und das kommt bei mir vom Herzen, sagt der alte Hüter im Selchtal. Ich kann mir nit genug schnaufen, und ich därf aufpassen, dass sich nix anders noch dazu schlagt.“
„Was du nit sagst, Hiesel, das wär’ nit gut.“
„So eine Herzkrankheit kann ein’m über Nacht den Rest geben, mein’ ich“, seufzte der Alte.
„Red’ nit so dumme Sachen! Dir fehlt’s nirgends nit. Nur verdriesslich bist, weil das Bübli fort kommt! Sei kein Narr, Hiesel! Um Mariä Himmelfahrt herum sind wir ja sicher wieder da.“
Читать дальше