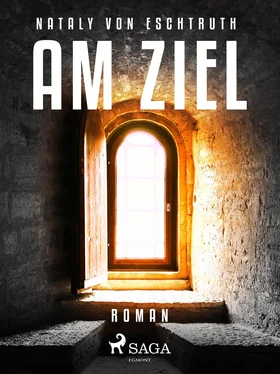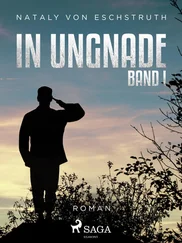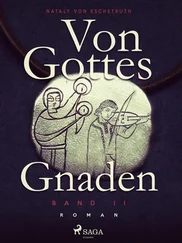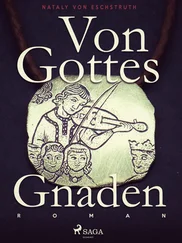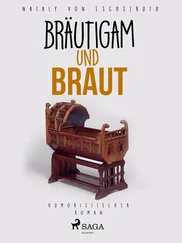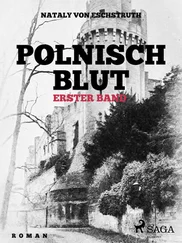Gräfin Theodora empfand es als unerträgliche Qual, ja geradezu als Schmach, dass sie bei allen Festen, wo die Form und Etikette waltete, hinter den meisten Frauen zurückstand, deren Gatten eine Stellung in der Welt einnahmen. Ihre Titel und Mittel sprachen in diesem Falle so gar nicht mit, und alle Exzellenzen, Generalinnen bis zur Majorin herab hatten den Vortritt vor Gräfin Thum, die nicht einmal bei Hofe die Vorrechte der Landstandsdamen genoss, da die Thumschen Besitzungen in Österreich und der Schweiz lagen, der Graf aber eine Vorliebe für die Residenz M. besass und infolgedessen seinen dauernden Wohnsitz dort genommen hatte.
Anfänglich hatte Gräfin Theodora sich diese „Schattenexistenz“ nicht so schlimm gedacht. Ihr reiches, gastfreies Haus vereinigte die erste und vornehmste Gesellschaft, man rechnet es sich zur Ehre an, in den Thumschen Salons zu Hause zu sein, denn das gräfliche Paar war ungemein beliebt und fraglos der Mittelpunkt der Gesellschaft.
Bei Hofe so wohl gelitten, dass die hohen Herrschaften es nicht verschmähten, zu den glänzenden Festen im Hause des Grafen zu erscheinen, von den Künstlern wegen ihrer imposanten Schönheit geradezu gefeiert und umworben, blieb dennoch im Herzen der Gräfin ein feiner Stachel zurück. Sie war unbefriedigt, sie entbehrte just das, was sie am leidenschaftlichsten ersehnte.
Mit der ärmsten Exzellenz hätte sie getauscht, hätte all ihre Reichtümer freudig dahingegeben für das eine, stolze Bewusstsein, einen Mann zu besitzen, der eine hervorragende Stellung einnimmt, eine Frau zu sein, die erhobenen Hauptes voranschreitet, während die andern sein demütig folgen.
Der Graf ahnte nicht, wie bitter ernst es seiner jungen Frau mit dem Strebertum war. Er hielt ihren Ehrgeiz für eine fixe Idee, eine jener pikanten kleinen Schrullen, mit denen sich schöne Frauen gern interessant machen. Er lachte sie aus, wenn er sie in ihrem Boudoir antraf, russische oder italienische Vokabeln lernend, Kunstgeschichte treibend oder gar über einer Generalstabsarbeit grübelnd, die ein guter Freund „mit den himbeerfarbenen Streifen“ ihr voll freudigen Entzückens aufgezeichnet hatte.
„Ich glaube wahrhaftig, Frauchen, du willst noch General oder Professor werden!“ scherzte er, sich behaglich in einen Sessel werfend, das Bein überschlagend, dass der elegante seidene Strumpf über dem Lackschuh sichtbar ward, und die Zigarette mit weisser, ringgeschmückter Hand zu Munde führend; „o ja, ich glaube, du würdest famos mit einer Division oder gar einem Armeekorps fertig! Das Schicksal hat einen groben Schnitzer begangen, dich als Weiblein in die Wiege zu legen, wenngleich ich persönlich ihm von ganzem Herzen dankbar dafür bin!“
Und der Sprecher zog die schöne, energische Hand seiner Frau galant an die Lippen und blickte sie aus seinen blauen Augen so fröhlich an, wie ein Kind, das mit sich und der ganzen Welt zufrieden ist.
Die Gräfin schlang in aufwallender Empfindung die Arme um ihn.
„Alexis! Du hältst mich für eine hohe Stellung geboren, — hast du denn gar nicht den Trieb und Wunsch, mich einmal zur Exzellenz zu machen?“
Er lachte schallend auf. „Nein, Schatz! Etwas so Vergebliches, was wir beide kaum noch erleben würden, wünsche ich mir nicht!“
„Nicht mehr erleben?“
„Nun — wenn ich jetzt noch als Leutnant oder Studiosus anfangen wollte — was meinst du wohl, wie lange ich klettern müsste, bis ich die Exzellenz erreicht hätte?“
Sie seufzte tief auf und presste momentan die Lippen herb und schmerzlich zusammen. Dann nickte sie mit starrem Blick vor sich hin und strich mit der kühlen, schlanken Hand leicht über sein elegant gescheiteltes Haar.
„Ja, ja, ich sehe es ein, — es ist zu spät. Du kannst das Versäumte nicht mehr nachholen. Aber Alexis“ — sie richtete sich empor, ihr Auge blitzte auf, und ihre Brust hob sich unter tiefem Atemzug: „Wenn ich einmal einen Sohn haben werde — der soll alles erreichen, was mein glühendes Sehnen umsonst erstrebt!“
„Hoffen wir es, liebes Herz!“
„Er soll lernen — lernen — lernen!“ Wie ein Aufschrei klang’s von ihren Lippen, mit dem das harmlose Lächeln des Grafen seltsam kontrastierte.
„Armer Junge,“ scherzte er, „welch ein Glück für ihn, wenn er als Mädchen zur Welt käme!“
„Glück? Das nennst du Glück?“ rief sie erregt. „Fühlst du dich etwa glücklich ohne Stellung und Beruf?“
Er dehnte behaglich die Arme; das silberne Armband mit dem Georgsdukaten blitzte an seinem Handgelenk. „Unendlich glücklich!“ versicherte er, und seine weissen, gesunden Zähne blinkten durch den blonden Schnurrbart, und seine Augen strahlten wie wolkenloser Sommerhimmel. — „Ich sage dir, Theo — unsagbar glücklich! Ohne Ärger, ohne Sorgen, ohne Schinderei und Abhetzerei — ach, es ist schön, wenn man sein eigener Herr ist! Langweilen tue ich mich nicht, ich arbeite an unsrer Familiengeschichte, ich interessiere mich für die Neubauten auf den Gütern, ich wirke in allen möglichen Vereinen ... Ja, potz Wetter! Da fällt mir ja mein Kriegerverein ein! Wollen eine hübsche patriotische Feier haben, die Veteranen sollen noch einmal Lorbeeren für anno 13 pflücken! Gut, dass ich daran denke, will gleich mal zum Tivoli hinausfahren.“
Der Sprecher küsste das schöne, stolze, steinerne Gesicht seiner Gemahlin und schritt pfeifend aus der Tür, — die Gräfin aber stützte mit finsterm Blick das Haupt in die Hand.
Ja, es war zu spät! Für den Vater zu spät — für den Sohn nicht!
Ach, dass sie die Mutter eines Sohnes würde! Wie wollte sie Funken des Ehrgeizes in sein junges Herz streuen, wie wollte sie nur noch nach dem einen Ziele leben — durch den Sohn zu erreichen, was ihr durch den Gatten versagt blieb! — Macht! Stellung! Ehre! Einfluss! Dem Sohn soll es einst werden, und seiner Mutter soll er es verdanken!
Wie ein Schrei der Sehnsucht ging es durch das stolze, ehrgeizige Frauenherz, und doch vergingen noch drei Jahre, ehe sie voll jauchzenden Triumphs die Wiege für den Heissersehnten bereiten konnte.
Vier Jahre waren sie vermählt, alles, was sie für ihren Gatten in dieser Zeit erreicht hatte, war der Titel eines Kammerherrn, das war ein bescheidenes Ziel, — dem Sohn soll es weiter gesteckt werden, — hoch und weit! Oh, ihr schwindelt es selbst, wenn sie im Geist die Höhe sieht, auf der ihr Fleisch und Blut doch noch mal triumphieren soll.
Exzellenz auf jeden Fall! Als Minister — als Feldmarschall — als Kanzler — gleichviel! Nur Exzellenz! Sie ist verliebt in diesen Titel, sie erblickt in ihm das Ziel aller Wünsche. — Ein Sohn!
Herr des Himmels — und wenn es eine Tochter würde?
Die Gräfin fröstelt und beisst die Zähne noch fester zusammen.
Ihre Seufzer zittern durch das stille, nächtliche Gemach, und die alte Frau am Fussende des Himmelbettes erhebt sich leise und blickt prüfend in das schöne, bleiche Antlitz der jungen Frau.
Nur noch eine kurze Spanne Zeit — nur noch der letzte Sturm nach der Ruhe — dann weiss sie es, ob ein Sohn das Ziel erreichen wird!
Ein Sohn! — ach, nur ein Sohn!
„Ihre Frau Gemahlin hat sich absolut einen Stammhalter bestellt, Herr Graf!“ flüstert der Arzt lächelnd im Nebenzimmer. „Teilen Sie diesen Wunsch, oder darf ich auch eine kleine Komtesse bringen?“
Alexis strahlt über das ganze Gesicht. „Bringen Sie es nur! Was es ist — das ist mir ganz egal! Ja, ich glaub beinahe, ein Mädel würde mir noch mehr Spass machen! Ich gehöre nicht zu den ungalanten Männern, die nur in Söhnen ihren Stolz erblicken! Eine Tochter würde ich noch zärtlicher, noch inniger lieben, als meinesgleichen! Schon als Ebenbild der Mutter würde sie mir willkommener sein als ein Junge, der als höflicher junger Mann stets den Damen den Vortritt lassen muss. Erst ein Mädel! Was später kommt, können meinetwegen sechs Jungens sein!“
Читать дальше