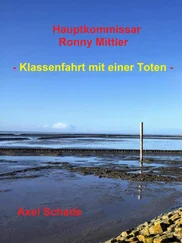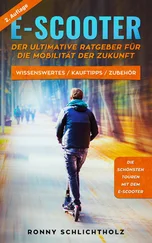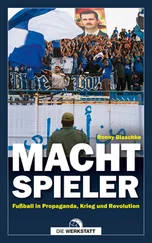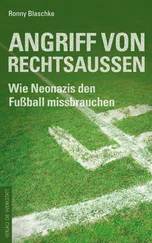Gaschke äußerte einen selbstbewussten Gehaltswunsch, Zwanziger willigte ein, doch kurz vor ihrem Wechsel zum DFB machte sie einen Rückzieher. „Ich habe dann auch andere Mitarbeiter des DFB kennengelernt“, sagt sie. „Und ich hatte nicht den Eindruck, dass meine Rolle dort schon bekannt gemacht wurde. Das Risiko, dort gegen Mauern zu laufen, erschien mir zu groß.“ 2012 wurde die Sozialdemokratin Gaschke zur Oberbürgermeisterin von Kiel gewählt, im Oktober 2013 trat sie wegen einer heftigen innerparteilichen Kontroverse zurück. Inzwischen ist sie Autorin bei der „Welt“.
Es zählt der Status, nicht das Argument
Alexandra Hildebrandt nahm das Risiko auf sich. Die Wirtschaftspsychologin hatte beim Handelskonzern Arcandor die Gesellschaftspolitik verantwortet, bis zu dessen Insolvenz. Hildebrandt lernte Zwanziger eher zufällig kennen und wurde von ihm nach längeren Gesprächen in die Kommission „Nachhaltigkeit“ des DFB berufen. In diesem Gremium sollten 15 Experten aus verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens ab Oktober 2010 Denkansätze für den Fußball entwickeln. Die Grünen-Politikerin Claudia Roth wurde die Beauftragte für Klimaschutz, die Sozialpädagogin Tanja Walther-Ahrens für Bildung, Teresa Enke für Programme gegen Depressionen. Hildebrandt übernahm den Bereich Nachhaltigkeit, insbesondere den Wissenstransfer aus der Wirtschaft. Der DFB stellte zwei Millionen Euro bis 2013 zur Verfügung, in den Verbandsmedien wurde die Kommission als Meilenstein beschrieben.
Die erste Versammlung der Nachhaltigkeitskommission verlief vielversprechend, einige Teilnehmer sprachen sich für die Einbeziehung der DFB-Sponsoren aus, die ihre Gesellschaftsressorts bereits aufgebaut hatten. Die Kommissionsmitglieder stellten für ihre Themen eigene Arbeitsgruppen zusammen. Und Hildebrandt schlug vor, dass der DFB auf neue Partner außerhalb des Fußballs zugehen solle, auf Fachmedien aus Wirtschaft, Umwelt und CSR, also Corporate Social Responsibility, gemeint ist die Verantwortung eines Unternehmens für die Gesellschaft.
Schon nach kurzer Zeit regte sich Widerstand an der Basis, die Landes- und Regionalverbände fühlten sich übergangen. „Wir sind doch kein Sozialverband“, hieß es öfter. „Wir sind kein Umweltverband.“ Alexandra Hildebrandt fühlte sich von Funktionären ausgegrenzt. Mehrfach warfen ihr DFB-Mitarbeiter vor, dass sie keine Ahnung vom Fußball habe. Mehrfach blieben Anfragen und Ideen von ihr unbeantwortet. „In der Kommission gab es keine kreativen Treffen, sondern eher Absegnungszeremonien“, sagt Hildebrandt. Viele Innovationen seien durch „Abschottungskräfte im Keim erstickt“ worden. In den Diskussionen habe weniger das Argument des Kritikers gezählt, sondern vor allem sein Status innerhalb der Fußballfamilie.
In einem Essay für die „Salzburger Nachrichten“ schrieb Hildebrandt, dass in schwerfälligen Organisationen wie dem DFB nicht nur ein kleiner Teil, sondern alle Arbeitsweisen auf neue Herausforderungen abgestimmt sein müssten: „Geschieht dies nicht, ,herrscht‘ die Macht der Inkompetenz und Wendigkeit, die stets die gesicherte Deckung sucht. Leider überschätzen inkompetente Menschen ihr Können. Sie sind häufig Egozentriker auf ihrem Selbstverwirklichungstrip, die nicht davon geleitet werden, was eine gesunde Organisation braucht, sondern was sie selbst brauchen. Ihr Bezugspunkt sind ihre Bedürfnisse, nicht ihre Aufgabe.“
Auch der Sportsoziologe Gunter A. Pilz war Mitglied der Nachhaltigkeitskommission, zuständig für Antidiskriminierung. Vor mehr als 20 Jahren hatte Pilz mit ähnlichen Worten über die Rückständigkeit des DFB geurteilt wie Hildebrandt. 1988, während der Europameisterschaft in Deutschland, wollte er mit dem Austragungsort Hannover ein Willkommensprogramm auflegen, mit landestypischer Musik und Verköstigung für die Gästefans. Der damalige DFB-Sicherheitschef Wilhelm Hennes lehnte das Konzept ab. Auf einem Podium warf Pilz ihm vor, dass er zu weit entfernt sei von den Bedürfnissen der Fans. Beim DFB galt Pilz fortan als unerwünschte Person, doch er analysierte weiterhin dessen Beharrungskräfte. In Aufsätzen, Vorträgen, Interviews.
So auch 1996. Pilz sprach in einem Fachblatt über die Kommerzialisierung, überschrieben mit der Schlagzeile: „Der Fußball verkauft seine Seele und verrät seine sozialen Wurzeln.“ Daraufhin wurde er von Egidius Braun nach Frankfurt eingeladen. Der damalige DFB-Chef hatte einige Passagen des Interviews unterstrichen und stellte Nachfragen. Am Ende des Gesprächs rief Braun beim Europäischen Verband UEFA an und meldete Pilz für eine Tagung über Gewalt im Fußball an. Als offiziellen Berater des DFB. Pilz war vorher nicht gefragt worden, er stutzte, überlegte eine Weile und willigte ein.
In den zwei Jahrzehnten danach prägte Pilz die Gewaltprävention beim DFB wie nur wenige. Er erhielt auch Ablehnung: Der DFB habe einen Kritiker „mundtot“ gemacht, hieß es in der Fanszene. Wie könne ein unabhängiger Professor so nah an den Verband heranrücken, fragten Wissenschaftler. Pilz sagt heute, dass er sich nie „verbogen“ habe: „Als junger Mensch glaubte ich, dass man die Welt sehr schnell verändern kann. Aber beim DFB habe ich gelernt, dass man viel Geduld aufbringen muss. Man muss auf Leute zugehen, die vielleicht nicht die gleiche Meinung haben. Man sollte auch mal eigene Wünsche zurückstellen, um langfristige Ziele zu erreichen. Es geht um Kompromisse und um kleine Schritte. Mit dem Wissen von heute wäre ich damals diplomatischer aufgetreten.“
Würde man die Schablone des Parteienspektrums auf Pilz anlegen, so ist aus dem Fundi mit den Jahren ein Realo geworden. Spricht man ihn auf die Kritik von Alexandra Hildebrandt an, so wird seine Stimme etwas lauter. Pilz sagt, dass Hildebrandt die Empathie gefehlt habe, um sich auf die gewachsenen Strukturen des DFB einzulassen: „Ein Fußballverband mit einer großen Ehrenamtstruktur erfordert andere Maßnahmen als ein Industriekonzern.“ Bevor man Widerstände kritisiere, müsse man ihre Wurzeln verstehen. Man müsse die Entscheidungsträger kennen, ihr Umfeld und ihre Abhängigkeiten.
Zäsur nach Zwanziger
Es ist eine Herausforderung, auf die viele traditionelle Institutionen keine Antworten haben. Wie leiten Parteien, Kirchen oder Verbände wichtige Inhalte an ihre Mitglieder weiter, ohne dabei abstrakt zu wirken? Nur 0,1 Prozent des Fußballgeschehens findet auf Bundesebene statt. 4,9 Prozent liegen im Verantwortungsbereich der Landesverbände. Gut 95 Prozent sind Angelegenheiten der Vereine, auf Basis des Ehrenamts. Es können in der DFB-Zentrale noch so viele Konzepte geschrieben werden – der Weg bis zur Kreisklasse ist lang. Und diese Kreisklasse sieht in Stuttgart anders aus als in Vorpommern.
Der Eifer von Theo Zwanziger überdeckte die Spannungen zwischen den Konservativen und den Reformern im DFB. Zwanziger geriet ab 2011 zunehmend in die Kritik, insbesondere für seine Aufarbeitung im Skandal um den Schiedsrichterausbilder Manfred Amerell, der sein Amt für Annäherungen an den Kollegen Michael Kempter ausgenutzt haben soll. Mitarbeiter des DFB schildern, dass Zwanziger in jener Zeit oft selbstherrlich gewesen sei und sich nicht mehr beraten ließ. Als seine Amtsübergabe an Wolfgang Niersbach 2012 abzusehen war, soll Zwanziger bereits isoliert gewesen sein. Er sprach öffentlich weiter über politische Themen, aber mit der Umsetzung waren stets andere beschäftigt, darunter nicht wenige Mitarbeiter, die nicht mehr an ihn glaubten.
„Wie politisch wird der DFB nach Ihrem Ausscheiden sein?“ Auf diese Frage antworte Zwanziger 2011 im Buch „Angriff von Rechtsaußen“: „Mein Nachfolger wird an dieser Entwicklung nicht ohne Weiteres vorbeikommen. Wir werden es so organisieren: Egal, wer irgendwann auf meinem Platz sitzen wird, niemand wird die politische Seite des Fußballs mehr wegreden können.“ Zwanziger hätte gern den früheren Präsidenten des VfB Stuttgart, Erwin Staudt, oder den Ligapräsidenten Reinhard Rauball an der DFB-Spitze gesehen, nicht aber seinen Generalsekretär Wolfgang Niersbach.
Читать дальше