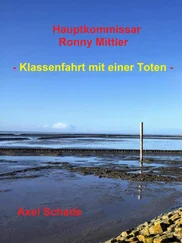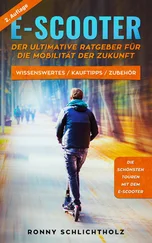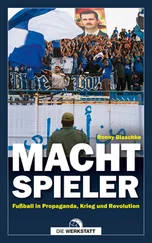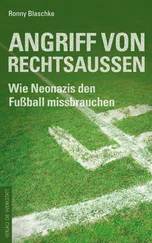In solchen Fällen zeigt sich, wie wichtig glaubwürdige und reflektierte Repräsentanten an der Spitze sind. Der einstige Sportreporter Wolfgang Niersbach begann als DFB-Chef 2012 mit dem Versprechen, wieder das „Kerngeschäft“ in den Mittelpunkt zu rücken. Für ihn war der DFB zuvorderst eine Verwaltung für Fußballspiele. Niersbach prägte keine gesellschaftlichen Debatten, aber er stellte sich auch nicht grundsätzlich quer. Als Vorsitzender der Jury für den Julius-Hirsch-Preis soll er einen angenehmen Ton für seine Moderationen gefunden haben, berichten Teilnehmer. Er wirkte sicher, wenn er auf Podien vom DFB-Kommunikationschef Ralf Köttker befragt wurde. Aber er wirkte unsicher in einem politischen Rahmen, den er schwer abschätzen konnte.
So auch 2014 bei einer Tagung des Bündnisses „Nie Wieder“, das sich für eine lebendige Gedenkkultur einsetzt. Monatelang hatten Medien über rechtsextreme Angriffe auf die antirassistische Gruppe „Aachen Ultras“ berichtet. Niersbach gab vor 150 Gästen zu, dass er davon kaum etwas mitbekommen habe. Er vertrat den DFB seltener bei gesellschaftlichen Anlässen als Theo Zwanziger. Niersbach war zum Beispiel bei einer Wohltätigkeitsgala der Hirschfeld-Stiftung zu Gast, er traf auch bei einer Projektvorstellung Aydan Özoğuz, die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Aber in beiden Fällen, so ist aus Organisationskreisen zu hören, soll Ligapräsident Reinhard Rauball die treibende Kraft für die gemeinsamen Auftritte gewesen sein. Und wenn die Bundesliga im Rampenlicht steht, dann will der DFB natürlich nicht fehlen.
Fan-Ärger über den DFB-Dialog
Vielleicht ist es kein Zufall, dass in der Amtszeit von Wolfgang Niersbach etliche Fußballprojekte mit einem kritischen Profil neue Mitglieder gewonnen haben, beispielsweise BAFF, die schwullesbischen Queer Football Fanclubs oder die Frauenrechtsgruppe „Discover Football“. Ihre Aktivisten wurden von Niersbach nicht mehr zum Meinungsaustausch eingeladen, daher fühlten sie sich auch weniger durch den Verband repräsentiert. Deutlich wurde das im Oktober 2015, als mehrere Fanorganisationen den Dialog mit dem DFB abbrachen. Eine ergebnisorientierte Gesprächsbereitschaft und Wertschätzung sei über Jahre nicht etabliert worden, hieß es in ihrer Pressemitteilung. Auch von vielen Fanprojekten wird die Deutsche Fußball-Liga in Fan-Angelegenheiten als offener und professioneller wahrgenommen.
Beim DFB lässt auf Fachebene niemand etwas auf Niersbach kommen, offiziell. Die Mitarbeiter berichten von einer Gestaltungsfreiheit, die sie unter Zwanziger nicht gehabt hätten, weil sie ständig dessen spontane Ideen umsetzen sollten. In der Zentrale hat sich die Abteilung „Gesellschaftliche Verantwortung“ nach schwierigen Anfangsjahren etabliert. Wenn man in der Branche nachfragt, erhält man ähnliche Meinungen: Die Abteilung sei kompetent, aber unterbesetzt, außerdem stoße sie an die Grenzen der DFB-Bürokratie. Vier Angestellte sind für die „Gesellschaftliche Verantwortung“ im Verband hauptamtlich zuständig, sie entwerfen Broschüren, organisieren Preisverleihungen und sollen inhaltliche Visionen formulieren. Zum Vergleich: Die Medienabteilung hat rund 30 Mitarbeiter.
„Es kommt nicht unbedingt auf die Zahl der Mitarbeiter an“, sagt die Nachhaltigkeitsexpertin Alexandra Hildebrandt, die 2014 das Standardwerk zum Thema herausgebracht hat, der Titel: „CSR und Sportmanagement. Jenseits von Sieg und Niederlage: Sport als gesellschaftliche Aufgabe verstehen und umsetzen“. Hildebrandt findet, dass die Abteilung weit oben angesiedelt sein müsse. Wie in Bremen: Eine CSR-Direktion mit zehn Mitarbeitern ist bei Werder direkt dem Vereinspräsidenten untergeordnet, der auch Geschäftsführer der Kapitalgesellschaft für die Profis ist. Beim DFB dagegen ist die Abteilung „Gesellschaftliche Verantwortung“ eine Abteilung unter vielen. Ihr Direktor Willi Hink ist auch für Amateurfußball, Qualifizierung und Schiedsrichter verantwortlich.
Doch die Umsetzungskette beim DFB ist länger als in jedem Profiklub. Die vier Abteilungsmitarbeiter in Frankfurt müssen für ihre Bildungskonzepte eine Sprache finden, die ehrenamtliche Vertreter nicht als Bevormundung empfinden. Möchte der DFB ein Projekt für Klimaschutz oder eine Kampagne gegen Homophobie bundesweit etablieren, so ist er auf die Bereitschaft seiner 21 Landesverbände angewiesen. In einer DFB-Umfrage kam 2015 heraus, dass 52 Prozent der befragten Mitarbeiter in den Landesverbänden den Bereich Gesellschaftliche Verantwortung für zunehmend wichtig erachten. 46 Prozent der Verbände haben dafür eine eigene Abteilung gegründet. „Wir möchten einen regen Austausch mit den Landesverbänden pflegen“, sagt Stefanie Schulte, die Leiterin der DFB-Abteilung für Gesellschaftliche Verantwortung: „Wir wollen viele Mitglieder auf unserem Weg mitnehmen. So entwickelt sich das Bewusstsein systemisch und wird von der ganzen Organisation getragen.“
Schulte kam unter Theo Zwanziger zum DFB. Sie war vorübergehend im Stab von Maria Böhmer tätig, der ehemaligen Integrationsbeauftragten der Bundesregierung. Sie sagt, dass sie Projekte im Fußball oft unkomplizierter durchsetzen könne als in der Politik. Und das will was heißen. Ihre Abteilung betreut ein Netzwerk von ehrenamtlichen Kommissionen, Arbeitsgemeinschaften und Projektgruppen, die sich für bestimmte Themen regelmäßig treffen, etwa Vielfalt oder Gewaltprävention. Die Landesverbände entsenden in diese Gremien ihre ehrenamtlichen Beauftragten für Integration, Inklusion oder Fair Play. Man braucht eine Weile, um diese Gremienstruktur zu durchblicken.
Viele dieser Vertreter sind motiviert, kompetent, neugierig. Aber etliche können mit ihrem Posten wenig anfangen, sie freuen sich über schicke Hotels und gutes Essen bei den Treffen in Frankfurt. Experten aus fußballfernen Institutionen sind kaum noch vertreten. Und wenn doch, dann scheinen sie sich mit Kritik zurückzuhalten, berichten Teilnehmer, schließlich können sie mit dem DFB in ihrer Außendarstellung gut punkten. Die Abteilung von Stefanie Schulte hat in den vergangenen Jahren viele Kommunikationsformen probiert, zum Beispiel die erste Jahreskonferenz zur Gesellschaftlichen Verantwortung im November 2015 in Hennef. Ein Debattenforum auf hohem Niveau, das nun jährlich stattfinden soll – und wofür der DFB eine beachtliche Summe ausgibt.
Für sein Themenfeld „Verbandstätigkeit/Nachhaltigkeit“ hat der DFB 2015 mehr als 22 Millionen Euro aufgewendet, dazu zählen Ehrenamt, Schulfußball, Breitensport oder Prävention. Diese Summe entspricht etwa zehn Prozent der gesamten Ausgaben des DFB. Die Zahlen dürften weiter wachsen, aber an andere „Haushaltsgruppen“ werden sie so bald nicht heranreichen: Für Administration und Kommunikation wandte der DFB 2015 rund 63 Millionen auf, für Sponsoring und Vermarktung fast 57 Millionen.
Unter Geldmangel hat die Gesellschaftspolitik des DFB künftig jedenfalls nicht zu leiden. Das zeigen die jährlichen Teamreisen der U18 nach Israel, wo die Spieler auch die Holocaust-Gedenkstätte Jad Vashem besuchen. Das zeigen die Tagungen, Broschüren, Sozialspots, Minispielfelder oder Mobile für Qualifizierungsangebote vor Ort. Und das zeigen die Verleihungen des Julius-Hirsch-Preises oder des Integrationspreises.
Zudem erklärten sich DFB und DFL 2013 bereit, ihren Finanzierungsanteil an den 60 Fanprojekten zu erhöhen, von einem Drittel auf 50 Prozent. Die andere Hälfe teilen sich die Kommunen und Länder. Der DFB überweist jährlich fast drei Millionen Euro für die Sozialarbeit mit jungen Anhängern. Und er würde diese Summe noch bis zu einem Drittel erhöhen, wenn die öffentlichen Geldgeber an einigen Standorten mitziehen würden.
Seit der WM 2006 sollen die Einnahmen des DFB um mehr als 50 Prozent gestiegen sein, schrieb der Journalist Michael Ashelm in der „FAZ“. Um die 55 Millionen Euro erzielt der DFB aus Sponsorenverträgen, darunter sind acht Dax-Konzerne. Hinzu kommen 40 Millionen durch TV-Vermarktung und Ticketerlöse. Der jährliche Haushalt liegt bei 220 Millionen Euro, die Gesamtrücklagen belaufen sich auf fast 170 Millionen. Wie genau die Amateure von der lukrativen Nationalmannschaft profitieren, ist nicht einfach nachzuvollziehen. Der DFB sei als gemeinnütziger Träger sowieso der Allgemeinheit verpflichtet, sagen seine Führungsleute, und im Gegensatz zu den olympischen Kernsportarten erhalte er keine staatliche Förderung.
Читать дальше