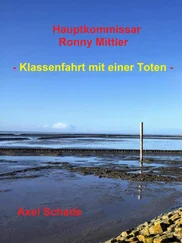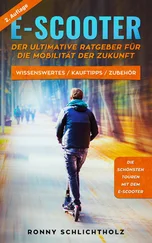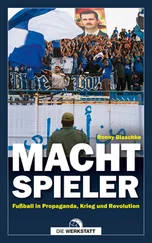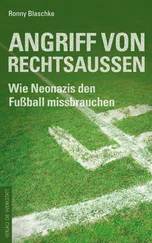Vielleicht würde die politische Debatte innerhalb des DFB ein höheres Niveau erreichen, wenn Tietz mit seinen Erfahrungen öfter an Funktionärsrunden teilnehmen würde. Das gilt auch für Wolfgang Watzke und Tobias Wrzesinski, den Geschäftsführer und seinen Stellvertreter der DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger. Ihre Geschäftsstelle liegt in Hennef – von dort lässt sich das Bewusstsein in Frankfurt nur bedingt prägen.
Die Aufgaben der Stiftungen grenzen sich klar voneinander ab. Sie verschicken unterschiedliche Newsletter, pflegen getrennte Internetseiten, veröffentlichen eigenständige Jahresberichte. Wer sich in der Branche umhört, der merkt schnell: Selbst viele Funktionäre der Landesverbände können die Stiftungen nicht unterscheiden. Und Unkundige wissen gleich gar nicht, wie sie einen DFB-Experten für ein bestimmtes Thema schnell erreichen können. Vor 20 Jahren mag die Auslagerung von sozialen Themen in Stiftungen noch modern gewesen sein. Mittlerweile ist sie das nicht mehr (siehe Seite 102).
Was kommt mit Grindel?
„Eine in Frankfurt angesiedelte Einheit für soziale Themen halte ich nicht zwingend für notwendig“, sagt Reinhard Grindel. „Aber wir brauchen eine stärkere Abstimmung der Stiftungen untereinander und mit dem Hauptamt.“ Seit April 2016 ist Grindel der zwölfte Präsident des DFB. Ob er den Verband in der Öffentlichkeit wieder gesellschaftspolitisch stärken kann? Es sprechen mehr Argumente dafür als dagegen.
Der Jurist Grindel legte im Funktionärswesen einen schnellen Aufstieg hin – für manche zu schnell. Das kann Misstrauen und Neid erzeugen, gerade bei Kollegen, die sich seit Jahrzehnten durch die Strukturen mühen. Wie seine Vorgänger Mayer-Vorfelder und Zwanziger ist er Mitglied der CDU, in der Partei wird er dem konservativen Flügel zugerechnet. Das verdeutlichen Aussagen über Integration, die eher an Mayer-Vorfelder erinnern als an Zwanziger.
Als Journalist hatte er für das ZDF die Studios in Berlin und Brüssel geleitet. Als Abgeordneter saß er im Innenausschuss und im Sportausschuss des Bundestages. Man kann ihm das positiv oder negativ auslegen. Positiv: Er kann seine Rhetorik an die Bedürfnisse der Medien anpassen und ist gut vernetzt mit den politischen Schaltzentralen. Negativ: Er hat die Seilschaften im Geschäft so schnell verinnerlicht, dass er jedem Gesprächspartner das Gefühl vermitteln kann, auf seiner Seite zu sein.
Mit der Gesellschaftspolitik des DFB ist Grindel vertraut. Als Schatzmeister des Verbandes soll er großzügig auf Geldanfragen für soziale Themen reagiert haben. Zum Beispiel im Sommer 2015: Die DFB-Kulturstiftung förderte eine Ausstellung vor dem Berliner Hauptbahnhof über jüdische Sportler im Dritten Reich. Grindel gefiel die Idee, aber er fragte sich, ob die hohen Kosten der wetterfesten Skulpturen im Verhältnis zu ihrer Wirkung stehen. Er willigte ein – die Ausstellung wurde ein Erfolg. „Ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl dafür entwickelt, ob Projekte eine Breitenwirkung haben“, sagt Grindel. Als Schatzmeister saß er gemäß seiner Funktion auch in den Vorständen der drei DFB-Stiftungen. Zudem war er Mitglied der Nachhaltigkeitskommission unter Zwanziger gewesen, zuständig für den Bereich Antikorruption. Zu anderen Themen, sagen Teilnehmer des Gremiums, soll er sich weniger positioniert haben.
In den ersten Monaten als Präsident legte Grindel ein beachtliches Tempo vor. Er sprach über die Willkommenskultur für Flüchtlinge, redete über Fußball in Ganztagsschulen und stellte einen detaillierten Finanzbericht vor, den es so im Verband noch nicht gegeben hatte. Unterstützt von seinem Nachfolger als Schatzmeister: Stefan Osnabrügge hatte sich als Leiter der ehramtlichen Kommission „Gesellschaftliche Verantwortung“ einen Ruf als Antreiber erworben. Bei der EM 2016 besuchte Grindel mit Kollegen eine Gedenkstätte, die an die Opfer des französischen Widerstands im Zweiten Weltkrieg erinnert. Und er diskutierte in Paris mit Fanvertretern und Wissenschaftlern die Integrationschancen im Fußball.
Im Interview holt Grindel einen Ordner hervor und gibt Auskunft über Budgetdetails. Er weiß genau, welche Zahlen er auf welcher Seite findet. Grindel will ein Compliance-System gegen Regelverstöße etablieren. Er möchte den Austausch mit Fans wieder aufnehmen und die Partnerschaften mit zivilgesellschaftlichen Institutionen pflegen. Er sagt: „Für mich gehören alle Themen zum Kerngeschäft. Je besser es unseren Vereinen geht, desto mehr können sie sich für Integration und andere soziale Fragen stark machen. Das möchte ich mit der Öffentlichkeit, die ein Präsident hat, unterstützen.“
In einem Bereich ist Grindel gegenüber Niersbach im Nachteil: Er muss belastungsfähige Kontakte zum Profifußball erst aufbauen, auch zu ehemaligen Nationalspielern, die aus dem Ruhestand heraus oft Diskussionen prägen. Von verschiedenen Seiten erfährt man, dass der Marketingzirkel der Nationalmannschaft um Manager Oliver Bierhoff für die gesellschaftspolitischen Fachleute des DFB schwer erreichbar ist.
Es gibt in Deutschland keine ernstzunehmende Debatte über die soziale Vorbildfunktion von Nationalspielern. Nach Attacken gegen Flüchtlinge veröffentlichte der DFB im Sommer 2015 ein kurzes Video. Darauf halten Spieler beschriebene Karten hoch: „Gegen Hass“, „Gegen Fremdenfeindlichkeit“. Die Mehrheit in Medien und Sport gibt sich mit solchen inhaltsleeren Botschaften zufrieden. Und bestärkt sie sogar: Zur gleichen Zeit erhielt nämlich Joachim Löw für sein Engagement die Goldene Sportpyramide von der Deutschen Sporthilfe. Der Bundestrainer hatte einem Flüchtlingsprojekt des Schauspielers Til Schweiger 25.000 Euro zur Verfügung gestellt. Doch darüber hinaus ist keine visionäre Aussage Löws über die gesellschaftliche Rolle seines Teams in Erinnerung geblieben. So hat die Sporthilfe ihre Auszeichnung bekannter machen können, aber das Thema gewann nicht an Konturen dazu. Die Liste vergleichbarer Promi-Ehrungen ohne Substanz ist lang.
Millionen Fans sind es nicht gewohnt, dass sich ihre Lieblingsspieler zu Themen jenseits des Fußballs äußern. Und wenn sie es tun, dann gehen ihre Aussagen in schriller Aufregung unter. Im Mai 2016 veröffentlichte Mesut Özil ein Foto von sich in Mekka, dem zentralen Wallfahrtsort für Muslime. Für Özil kümmert sich ein Marketingteam um seine Darstellung in sozialen Netzwerken, daher dürfte das Bild ein Zeichen für Akzeptanz gewesen sein. Innerhalb von wenigen Stunden wurde das Bild millionenfach geliked, doch es gab auch Hetze und Unverständnis. Vertreter der sächsischen AfD warfen Özil ein „antipatriotisches Signal“ vor.
Der Brandenburger AfD-Chef Alexander Gauland wurde in der gleichen Woche mit Worten über den schwarzen Nationalspieler Jérôme Boateng zitiert: „Die Leute finden ihn als Fußballspieler gut. Aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben.“ Zu diesem Zeitpunkt war die rechtspopulistische Häme über ein Kinderbild von Boateng noch gar nicht abgeklungen, mit dem der Konzern Ferrero auf seiner Kinderschokolade geworben hatte.
Sind sachliche Auftritte der Nationalspieler in dieser Erregungskultur überhaupt möglich? Vor der EM 2012 in der Ukraine und Polen sprach Thomas Urban, Korrespondent der „Süddeutschen Zeitung“, mit Spielern über Polen. Der damalige Kapitän Philipp Lahm äußerte sich differenziert über Menschenrechte in der Ukraine. Und eine Delegation besuchte das einstige KZ Auschwitz. Doch selbst das wurde dem DFB auch negativ ausgelegt, denn, so der Vorwurf, es sei nicht das gesamte Team in der Gedenkstätte gewesen. Reaktionen wie diese dürften dazu beigetragen haben, dass Oliver Bierhoff sich genau überlegt, welcher Spieler wozu etwas sagt.
Das System DFB ist voller Widersprüche, doch man es sollte es nicht aus den falschen Gründen kritisieren. Der Verband wird für sein Nationalteam bald noch höhere Einnahmen von Sponsoren, Ausrüstern und Sendeanstalten erzielen. Zugleich betonen die Funktionäre stets ihre Bodenhaftung gegenüber der Basis. Zwischen diesen unterschiedlichen Interessen ist es vielleicht gar nicht möglich, einen gesellschaftspolitischen Leitfaden zu entwickeln.
Читать дальше