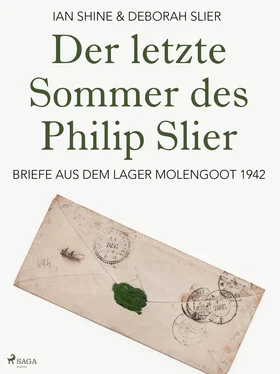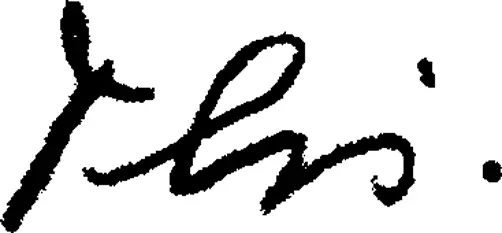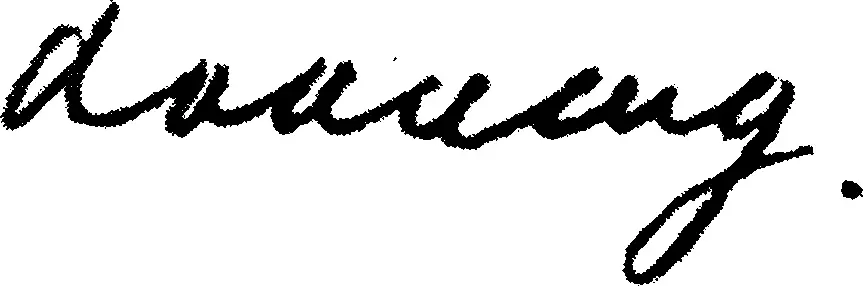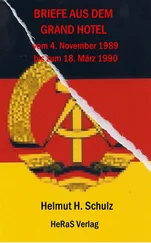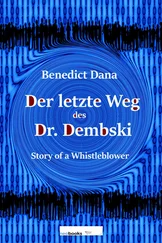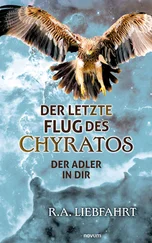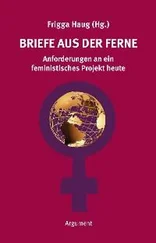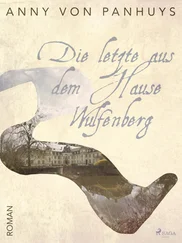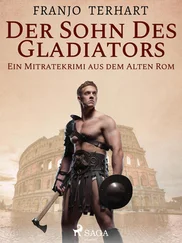Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich über mein Paket bin. Die Holzschuhe waren nicht mehr notwendig, die kann jetzt jemand anders gut gebrauchen. Wenn ich meine Schuhe noch einen Tag länger getragen hätte, hätte ich sie wegschmeißen können. Meine Windjacke habe ich jetzt an. Sie sitzt herrlich. Sagt Riek [Hendrika Schaap] herzlichen Dank. Sie ist wirklich toll. Ich freue mich auch über die Hausschuhe, die Flöte, das Apfelkraut und alles andere. Nur schade, dass ich noch keine Handschuhe habe. Durch die Kälte sind meine Hände ganz rau. Morgen werde ich jedoch ein paar Socken für meine Hände mitnehmen. Das Klappmesser brauche ich nicht gleich. Auch meinen Gelbfilter braucht ihr nicht zu schicken.
Wie gemein, dass man Harry 4keine Pakete mehr schicken darf. Hauptsache sie können die Juden piesacken. Wenn ich keine Pakete mehr empfangen darf, schickt sie einfach nach Vriezenveen. 5Vielleicht kann man sie mir dort geben ... Über die Fam. De Bruin 6schreibe ich euch in einem anderen Brief. Vielen Dank noch für die Briefmarken. Die Bezugskarte für Textilien lege ich bei. Wir dürfen nicht nach Hardenberg. Wir dürfen nicht einmal das Lager verlassen. Wir sind hier eingesperrt wie Sklaven. Mein Setzschiff liegt noch bei Verdoner in der Druckerei.
Wenn Liesjes Lou auch nur einen Tag lang unsere Arbeit machen würde, würde er zusammenbrechen. Er soll in A. bleiben. Hier ist es nicht spaßig.
Aber noch einmal: Ich werde mich schon durchschlagen. Sollte irgendetwas passieren, bin ich sofort weg. Das könnt ihr mir glauben. Also Papa und Mama, bleibt stark. Falls Papa einen Einberufungsbefehl bekommt, versucht alles Mögliche vorzutäuschen.
Einen dicken Kuss von
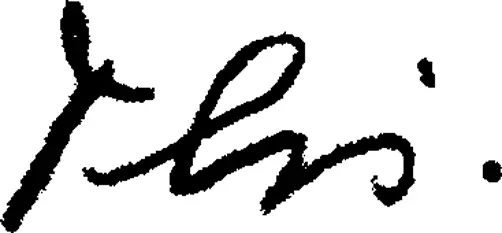
Ich kann auch noch ein Paar ganz alte, kaputte Socken für die Holzschuhe brauchen.
Schickt so schnell wie möglich ein paar dicke Handschuhe per Eilboten. Noch einmal herzlichen Dank für das Paket. Ich bin überglücklich.
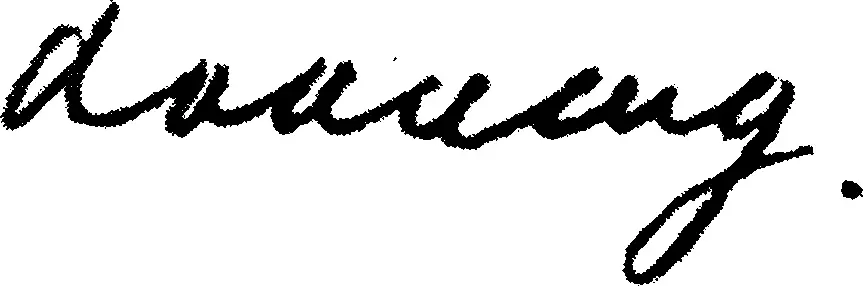
[Tschüüüüs] 7
Erinnerungen an das Lager Molengoot
Egbert de Lange aus Marienberg war zweiundzwanzig Jahre alt, als er im Lager Molengoot eintraf. Dieses Lager diente als Unterkunft für jene Arbeitslosen, die für die Heide-Gesellschaft Entwässerungskanäle ausheben sollten. Egbert de Lange war als Hilfskoch unter der Aufsicht des Kochs und Verwalters C. Abspoel eingesetzt.
Im März 1941, als de Lange erst seit einer Woche im Lager arbeitete, trafen die ersten Bewohner ein. Es handelte sich um Arbeitslose aus Den Haag und Scheveningen. Sie sollten drei Wochen lang Arbeit leisten, dann ein Wochenende frei bekommen und danach noch einmal für drei Wochen Kanäle ausheben. Im Dezember 1941 gab man ihnen für längere Zeit frei, weil eine Tätigkeit im Freien nicht mehr möglich war. Sie sollten Mitte Januar zurückkehren. Die Küchenmannschaft hatte einhundertachtzig Liter Erbsensuppe vorbereitet, doch niemand erschien. Erst eineinhalb Monate später kamen die Arbeiter wieder. Die Leute, die aus Scheveningen und Den Haag geschickt worden waren, arbeiteten etwa bis Ende März 1942, dann mussten sie ihren Platz für die Juden räumen.
»Diese Gruppe [von Juden] bestand zum größten Teil aus Geschäftsleuten, vor allem waren es die Inhaber von Bekleidungsgeschäften ... aber unter ihnen befanden sich auch etliche junge Leute. Sie hatten die gleiche Arbeit zu verrichten wie die Leute aus Scheveningen, bekamen aber für die gleiche schwere körperliche Arbeit weniger zu essen. Für sie lieferte man uns einfach weniger Vorräte«, erzählte Egbert de Lange. »Aber manchmal konnten wir die Lage ein wenig aufbessern. So kauften wir z.B. zusätzlich Kartoffeln, für die die Juden selber zahlten.« Doch mit der Zeit wurde es immer schwieriger, für die Arbeiter eine anständige Mahlzeit zuzubereiten, denn die Rationen wurden noch stärker gekürzt. Das Lager Molengoot war ein echtes Arbeitslager und unterschied sich sehr von einem Durchgangslager wie etwa Westerbork.
Die Juden durften sich einigermaßen frei bewegen; z.B. durften sie das Lager verlassen und mit dem Fahrrad nach Hardenberg fahren. »Dazu benutzten sie die Diensträder. Dieselben Räder dienten ihnen gelegentlich auch zur Flucht oder um unterzutauchen. Einmal erhielten wir einen Brief von einem Insassen, nachdem dieser sich aus dem Staub gemacht hatte. Er schrieb, er sei nach Almelo geradelt und das Rad sei dort auf dem Fahrradparkplatz abgestellt. Den Parkschein hatte er beigelegt. Es gab auch Juden, die um die Erlaubnis baten, das Lager zu verlassen, weil sie zu ihren Frauen in Westerbork wollten (die Erlaubnis wurde ihnen gewährt). Diese »Freiheit«, welche die Juden genossen, ließ sich aber auch anders auslegen, denn im Lager gab es eigentlich keine Wachen, und die Deutschen kamen selten oder nie vorbei. Einige der Männer erhielten auch Besuch von ihren Frauen. Die kamen dann morgens mit dem Zug in Hardenberg an, trafen sich außerhalb des Lagers mit ihren Ehemännern und fuhren abends mit dem Zug wieder zurück.
»Die Juden mussten auch nicht zum Appell antreten. Einmal fuhr Abspoel, der Verwalter und Koch, sogar für eine Woche ins Lager Erika in Ommen, nur um zu lernen, wie man die Juden zum Appell antreten lässt, aber es wurde nichts daraus.«
Offiziell arbeitete de Lange im Auftrag der Arbeitsbeschaffungsbehörde der Regierung im Lager, die Arbeitslosen jedoch und später dann die Juden waren für die Heidemaatschappij tätig. Die Gesellschaft hatte, wie de Lange sagte, keinerlei Einfluss auf das Leben im Lager. »Auch nicht auf die Verpflegung. Die [christlichen] Arbeiter aus Scheveningen und Den Haag bekamen gehaltvolle Mahlzeiten, ja sogar eine doppelte Ration, weil sie so schwere Arbeit verrichteten. Die Juden hingegen erhielten viel weniger. Morgens Suppe mit Brot, und später am Tag Brot, Milch und Kaffee. Abends gab es etwas Warmes, aber es war nie genug. Abgesehen vom Gemüse, davon gab es reichlich.« Die jüdischen Arbeiter blieben bis Oktober 1942 im Lager. Eines Abends kam eine Kompanie Deutscher ins Lager. Auf der Durchreise, wie wir annahmen, aber am nächsten Morgen nahmen sie alle Juden mit nach Westerbork. Nach dem Frühstück durften diese ihre Sachen packen und wurden dann unter Bewachung abgeführt. »Als man ihnen mitteilte, es gehe nach Westerbork, reagierten sie sehr resigniert«, erinnerte sich de Lange.
»Im Lager gab es 24 Räume, jeweils für acht Personen, aber sie waren nicht alle belegt. Die Gruppe von zwanzig deutschen Soldaten hatte etwa einhundertfünfzig Juden auf dem Weg zum Bahnhof von Hardenberg zu bewachen.«
Einen Monat nach dem Abtransport der Juden wurden evakuierte Niederländer in den Baracken untergebracht. De Lange war inzwischen ins Lager Balderhaar versetzt worden, dessen Leiter Mitglied der niederländischen nationalsozialistischen Bewegung war. »Ein ziemlich unangenehmer Zeitgenosse, und ich war froh, als ich nach einer Weile nach Molengoot zurückkehren konnte.« Zu der Zeit lebten einige Frauen und Kinder aus dem Westen der Niederlande im Lager Molengoot. Man hatte sie evakuieren müssen, weil die Deutschen dabei waren, die Atlantikdeiche zu bauen. »Diese Familien, die das gesamte Jahr 1943 in Molengoot verbrachten, waren nicht sehr sozial eingestellt. Sie haben eigentlich gar nichts getan. Ab und zu kam einmal ein Sozialarbeiter vorbei oder eine Kindergärtnerin, und gelegentlich eine Krankenschwester, Schwester Binnenmas aus Emmen. Sonst kam keiner, Das Lager stand unter der Aufsicht des Amtes für Evakuierungslager in Overijssel. Der Leiter war irgendjemand aus Ommen, aber er kümmerte sich nicht selbst um die Familien.«
Читать дальше