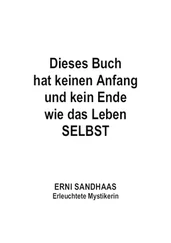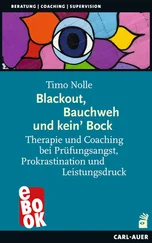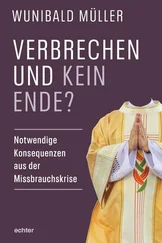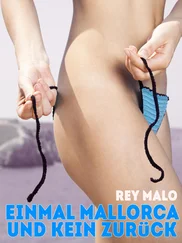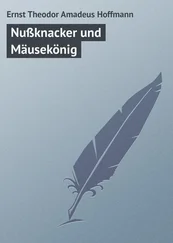Die Einquartierung solch ungeheurer Mengen von Soldaten war freilich, dies war sofort klar, mit großen Schwierigkeiten verbunden. Und auch das wurde sehr rasch deutlich: Man war schlicht und ergreifend nicht darauf vorbereitet. Bereits vorhandene militärische Bauten wie Truppenübungsplätze und Festungsanlagen waren in viel zu geringem Ausmaß vorhanden, sodass man seitens des K. u. K. Kriegsministeriums den Bau komplexer „Barackenstädte“ anvisierte. Damit erhoffte man sich ausreichende Kapazitäten, gepaart mit einer gesicherten Unterbringung.
So wurden im Oktober 1914 die ersten Transporte, mehrere hundert russische Kriegsgefangene, bis zur Fertigstellung des Lagers in Wegscheid im Turm Nr. 25 des Artillerie-Depots in Linz untergebracht, wenngleich dies von Haus aus nur als temporäre Ersatzunterkunft gedacht war. 62
Allerdings gewannen rasch sanitäre und hygienische Fragen eine vorrangige Bedeutung. Wie der Seuchenwinter 1914/15 in Oberösterreich zeigte, herrschten in so manchen Lagern katastrophale Verhältnisse.
Am 1. März 1915 fand im K. u. K. Kriegsministerium in Wien eine grundlegende Sitzung statt, an welcher außer den beiden Referenten, dem Oberleiter der K. u. K. Lagerbauleitungen Generalmajor Carossa und dem Oberstabsarzt Dr. Schattenfroh von der 14. Abteilung (Sanitätsabteilung), auch Vertreter der 8. Abteilung (Hochbau) und der 10. Abteilung (Kriegsgefangene) teilnahmen. Ebenso vertreten waren die Militärbaudirektoren jener Militärkommanden, in welchen Lager errichtet werden sollten.
Es wurde schließlich die Herausgabe eines Behelfs zu „Bauhygienischen Grundsätzen“ beschlossen. 63
Eine weitere Schwierigkeit kam noch dadurch hinzu, dass die kriegsgefangenen Offiziere anders untergebracht werden sollten als die übrigen Mannschaften. Sie wurden zunächst in gesonderten Einzelgebäuden, welche das Militär kurzfristig angemietet hatte, beherbergt. Daneben wurden auch Hotels und Gasthäuser ins Auge gefasst. Und so mancher Beherbergungsbetrieb erhoffte damit neue Einnahmequellen lukrieren zu können, war doch seit Kriegsbeginn ein massiver Rückgang in den klassischen Fremdenverkehrsorten zu spüren gewesen. 64 Was Oberösterreich betraf, so wurde kurzzeitig im Schloss Kreuzstein bei Mondsee eine Offiziersstation für kriegsgefangene Russen eingerichtet. Mit dem raschen Fortschritt des Lageraufbaues an den jeweiligen Standorten war damit jedoch bald Schluss, und die kriegsgefangenen Offiziere wurden innerhalb der Lager in eigenen Abteilungen bzw. Stationen konsigniert. Jedenfalls verfügte das K. u. K. Kriegsministerium die Aktivierung des Kriegsgefangenenlagers in Freistadt für den 18. Oktober 1914. Rund 3.000 Kriegsgefangene kamen Ende Oktober 1914 aus dem Militärkommandobereich von Poszony in Ungarn hierher. Die Belagskapazität wurde anfänglich jedoch auf 5.000 Mann limitiert. Aber bereits am 24. November 1914 wurde eine Vergrößerung des Belags um 10.000 Mann angeordnet. Die Fertigstellung der dazu erforderlichen Barackenbauten hoffte man durchaus optimistisch seitens der
K. u. K. Militärverwaltung bis Mitte Dezember 1914 abgeschlossen zu haben. Insgesamt sollte das Kriegsgefangenenlager an die 50.000 Kriegsgefangene aufnehmen. 65
Nur acht Tage vorher, am 10. Oktober 1914, wurden im Zuge einer kommissionellen Verhandlung über die Errichtung des Lagers wesentliche bautechnische Grundlagen fixiert.
Anwesend dabei waren Vertreter der Stadtgemeinde Freistadt, an der Spitze Bürgermeister Theodor Scharitzer, ein Beauftragter der K. u. K. Militärverwaltung sowie Vertreter der Grundbesitzer, ein technischer Sachverständiger der K. K. Statthalterei aus Linz sowie der für die sanitären Belange zuständige Bezirksarzt Dr. Moosböck. Der Mediziner äußerte sich eher skeptisch. Der Platz sei vom sanitären Standpunkt aus ungeeignet. Der Untergrund sei schottrig und wasserundurchlässig. Der Platz für die Baracken sei durch den umliegenden Sumpf der kälteste in der ganzen Umgebung. 66
Die Bettensorten stellte das K. u. K. Kriegsministerium zur Verfügung. Im Rahmen einer Begehung wurde der Exerzierplatz, er befand sich nur etwa 300 m südlich der Stadt, als der geeignetste Platz ausgewählt. 67
Der noch im November zur Schau gestellte Optimismus bezüglich einer raschen Fertigstellung erwies sich aber als Trugschluss, denn schon zur Jahreswende war klar, dass man um eine Erweiterung des Lagers nicht umhinkam. Das eingesetzte Baupersonal unterschied sich nunmehr aber erheblich von der Anfangszeit. Wurde die im Herbst 1914 errichtete Lagergruppe noch größtenteils durch angeheuerte Zivilarbeiter errichtet, wurden die übrigen Lagererweiterungsbauten von den Kriegsgefangenen selber ausgeführt. Bis Jahresende 1915 kamen noch drei weitere Lagergruppen dazu: Lagergruppe II, die südlich an die Lagergruppe I angrenzte, wurde Anfang März 1915 fertiggestellt, Lagergruppe IV umfasste sowohl die Unterkunftsbaracken der eigenen Offiziere als auch jene der Wachmannschaften, sie waren ab April 1915 bezugsfertig. Diese Lagergruppe bestand auch noch aus Neben- und Wirtschaftsgebäuden. Im November 1915 war dann die Lagergruppe III vollendet. Die Bauarbeiten waren dort zunächst aufgrund von Problemen bei der notwendigen Fäkalienbeseitigung für einige Zeit unterbrochen. Ab diesem Zeitpunkt besaß das Kriegsgefangenenlager eine Belagskapazität von 25.000 Mann und von den ursprünglich von Seiten des K. u. K. Kriegsministeriums gewünschten 50.000 konnte gar keine Rede mehr sein. 68
Das Lager in Mauthausen hingegen wurde erst am 10. November 1914 aktiviert. In diesem Zusammenhang erfolgte eine Überstellung von 3.000 serbischen Kriegsgefangenen, die ebenfalls aus Poszony kamen. 69 Der Barackenbau auf den Zirkinger Feldern hatte dort bereits am 23. September 1914 begonnen.
Es handelte sich dabei um nur dünne Schotterböden, unter denen sich starke Lehmschichten verbargen, die außerdem im Inundationsgebiet der Donau lagen. Mangels rasch aufzutreibender Arbeitskräfte aus der Umgebung, es musste also improvisiert werden, verfiel man auf eine kuriose Idee.

Abb. 4: Gesamtansicht des Kriegsgefangenenlagers Mauthausen im Jahre 1914 (erste Bauetappe)
Man behalf sich fürs Erste mit 700 sogenannten „Wiener Plattenbrüdern“, in der Mehrzahl Kleinkriminelle, die aber dem lokalen K. K. Gendarmerieposten gehörig zu schaffen machten. 70 Erst einen Monat später, am 22. Oktober 1914, kamen 300 russische Kriegsgefangene aus dem Lager Kleinmünchen-Wegscheid hinzu.
Das Kriegsgefangenenlager umfasste eine Fläche von 68 Hektar und erstreckte sich hauptsächlich auf die Industriegemeinde Haid. Von den insgesamt acht Lagergruppen, die im Jahre 1917 bestanden, war die Lagergruppe I nur knappe 1,5 km vom Ortszentrum Mauthausen entfernt. Die übrigen Gruppen grenzten unter anderem an die Nachbargemeinde Ried bei Mauthausen. In nordöstlicher Richtung, in der Ortschaft Oberzirking, wurde das Lager von einer Bezirksstraße, die Richtung Schwertberg führte, umschlossen. Die Donauuferbahn und die Hauptstraße von Freistadt nach Linz durchschnitten das Lager. Eine Gemeindestraße teilte das Lager überdies in eine nördliche und südliche Richtung. In Letzterer befand sich auch die Lagergruppe III, wo sich im Rahmen einer Eigenwirtschaft Rinder-, Schweine- und Geflügelstallungen befanden. 71 Es war schließlich die Lagergruppe I, in der Ende Dezember 1914 eine Reihe von Infektionskrankheiten ausbrach, die sich zu einer wahren Epidemie steigern sollten. Schon kurze Zeit nach der Aktivierung des Lagers sah sich das Lagerkommando mit massiven Beschwerden durch die zivilen Verwaltungsbehörden konfrontiert. In einem dringlichen Schreiben wandte sich der K. K. Bezirkshauptmann Dr. Schusser Anfang Dezember 1914 an die Statthalterei in Linz, um über anscheinend unhaltbare Zustände im Mauthausener Lager zu berichten. Anstelle der Russen hätten, wie allgemein bekannt, die weit gefürchteteren Serben in einer Stärke von 14.000 Mann Einzug gehalten.
Читать дальше
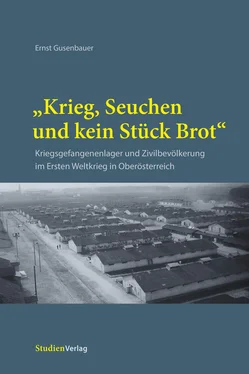

![Edzard Ernst - Trick or Treatment. The Undeniable Facts about Alternative Medicine [Electronic book text]](/books/151762/edzard-ernst-trick-or-treatment-the-undeniable-fa-thumb.webp)