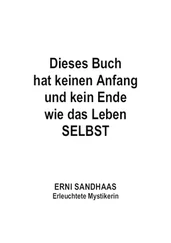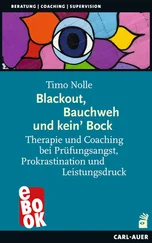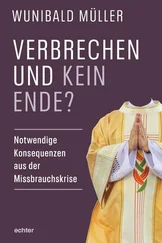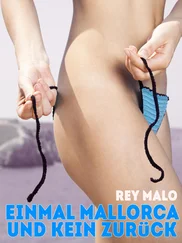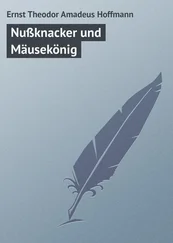Diese Missstände hätten schließlich zu einer moralischen Depression geführt. Dazu kam noch die desillusionierende Wirkung des Wissens um die ablehnende Haltung im eigenen Land.
Aber, so Procacci weiter:
„[…] Der Hass gegen das eigene Land […] schwächte bei vielen kriegsgefangenen Soldaten den Hass auf den Feind ab, dem weder eine besonders strenge Disziplin noch die Schuld für materielle Mängel zur Last gelegt werden konnte […]“. 33
Die italienische Regierung lehnte nämlich staatlich finanzierte Hilfsgüterlieferungen an die Kriegsgefangenen in Österreich-Ungarn und Deutschland rundweg ab. Sie wurden abschätzig als Vaterlandsverräter oder als „Fahnenflüchtige jenseits der Alpen“ tituliert. 34
Luca Gorgolini hat jüngst mit der Publikation „Kriegsgefangenschaft auf Asinara“ aufhorchen lassen. 35
Ausgehend von den Forschungsarbeiten Giovanna Procaccis untersucht der Autor nunmehr die Bedingungen, denen österreichisch-ungarische Soldaten am Beispiel des sardischen Insellagers Asinara ausgesetzt waren. Er kommt zum Ergebnis, dass Hunger und Seuchen trotz mannigfaltiger Bemühungen aufgrund der gewaltigen und unvorhergesehenen Dynamik dieses Krieges nicht zu vermeiden waren.
Und welche Entwicklungslinien lassen sich für die österreichische Weltkriegsforschung verorten?
In den letzten zehn Jahren gab es, initiiert vom Institut für österreichische Geschichte an der Universität Innsbruck, eine erfolgreiche transnationale und interregionale wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen österreichischen, deutschen und italienischen Historikern zur Thematik des Ersten Weltkriegs. Dies ist ein deutlicher Beleg dafür, dass die vielfach als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnete kriegerische Epoche gerade die heutige jüngere Historikergeneration in ihren Bann zu ziehen vermag. 36
In der historischen Aufarbeitung des Ersten Weltkrieges in Österreich standen lange Zeit militärische Aspekte im Vordergrund. Diese einseitige Ausrichtung auf die militärische Sichtweise erzeugte aber ein Bild vom Krieg als einem „eigenständigen und losgelösten Raum“ 37 , der anscheinend keinerlei Auswirkungen auf das zivile Leben hatte.
In der Ersten Republik besaß das Militär die alleinige historische Verfügungsgewalt, verbunden mit einer restriktiven Archivsperre. Nur einem kleinen Kreis nicht-militärischer Historiker wurde der Zugang zu den Archivbeständen erlaubt. Sie trachteten naturgemäß danach, den Kriegsschuldvorwurf zu entkräften. In dieser Zeit dominierte die sogenannte Offiziersgeschichtsschreibung. Sie galt als die einzig gültige Form der Weltkriegsaufarbeitung.
Klarerweise wurden sozioökonomische Aspekte dabei ausgeklammert. 38
Die Vorbedingungen für eine Neugestaltung der Weltkriegsgeschichte waren nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs alles andere als optimal. Der Universitätsbetrieb lag darnieder und ein großer Teil der Archivbestände des ehemaligen Kriegsarchivs war ausgelagert worden.
1945 fand wie 1918 eine Demilitarisierung des Kriegsarchives statt. Es wurde nämlich in die zivile Verwaltung eingegliedert.
Zugleich gründete man die Generaldirektion des österreichischen Staatsarchivs. Damit zog allmählich ein neuer Zeitgeist ein. 39
Die zuvor schon erwähnte personelle Zivilisierung nach 1945 hatte den Anteil der nichtmilitärischen und professionellen Historiker sukzessive in die Höhe schnellen lassen. Seit 1945 entwickelte sich das Kriegsarchiv ebenso schrittweise vom erstrangig militärisch dominierten Forschungsinstitut zu einem Service- und Dienstleistungscenter für alle historischen Forschungsbereiche. Es muss dabei freilich auch festgehalten werden, dass sich dadurch aber zunächst keine neuen und bemerkenswerten Entwicklungen im Forschungsbereich auftaten.
Dieser unbefriedigende Zustand änderte sich erst im Jahre 1956. Mit diesem Datum erfolgte die Freigabe der Aktenbestände bis 1918. Dies stellte sich rasch als durchaus impulsgebender Faktor dar. 1957 wurde dann die „Militärwissenschaftliche Abteilung“ beim Bundesministerium für Landesverteidigung installiert. In den folgenden Jahren wurde der moderne Begriff der Militärgeschichte von den universitär gebildeten Historikern in zunehmendem Maß verwendet. 40
Das Thema „Kriegsgefangene bzw. Kriegsgefangenenlager in Österreich-Ungarn während des Ersten Weltkrieges“ war lange Zeit ein Stiefkind der historischen Forschungsdisziplin.
Während der Zwischenkriegszeit fand eine Auseinandersetzung mit der Thematik nur in sehr eingeschränktem Ausmaß statt. Memoiren und Erinnerungsliteratur tauchten in Buchform erst in den späten 1920er Jahren auf. Die 1921 gegründete Bundesvereinigung ehemaliger österreichischer Kriegsgefangener gab 1931 die zweibändige Publikation „In Feindeshand“ heraus. Darin wurden persönliche Erlebnisschilderungen in Einzeldarstellungen, so der vollständige Buchtitel, von österreichischen Kriegsgefangenen in verschiedenen Feindstaaten gesammelt und einem breiteren Publikum präsentiert. Gleichzeitig bildete diese Memoirenliteratur die Grundlage eines Klischeebildes, das sich auch nach 1945 geraume Zeit hartnäckig zu halten vermochte, nämlich jenes von der besseren Kriegsgefangenschaft in Österreich-Ungarn als in irgendeinem anderen Land. Als Leitwörter dominierten: „[…] notorische Gewissenhaftigkeit, korrektes Verhalten und peinliche Ordnung“. 41
Dies änderte sich erst nachhaltig, nachdem in den späteren 1960er Jahren an der Universität Wien der erste Lehrstuhl für Zeitgeschichte gegründet wurde. Der Erste Weltkrieg erhielt jetzt Eingang in die universitäre Forschung, ohne allerdings bezüglich Kriegsgefangenen bzw. Kriegsgefangenschaft nennenswerte Ergebnisse zu liefern.
Aus dem Jahre 1981 datiert dann eine Dissertation von Rudolf Koch über das Kriegsgefangenenlager Sigmundsherberg in Niederösterreich, Titel: „Im Hinterhof des Krieges“. 42 1988 verfasste Petra Rappersberger eine Magisterarbeit, in der das Kriegsgefangenenlager im oberösterreichischen Freistadt im Mittelpunkt des Forschungsinteresses steht. Peter Hansak übernahm 1991 die doch relativ umfangreiche Aufgabe im Rahmen seiner Dissertation, die steirischen Kriegsgefangenenlager während des Ersten Weltkrieges zu untersuchen. 43 1999 verfasste Oswald Haller eine Magisterarbeit über das Lager Katzenau bei Linz, in dem zwischen 1914 und 1918 Zivilinternierte aus dem Trentino in Südtirol festgehalten bzw. konfiniert waren.
All diesen wissenschaftlichen Publikationen ist allerdings gemeinsam, dass sie erstrangig organisatorische und bauliche Bedingungen der Lagerwirklichkeit ins Blickfeld rücken, wenngleich sich Koch und Hansak bemühen, den Lageralltag und die Bedeutung der Standorte für die Zivilbevölkerung ansatzweise zu thematisieren. In dieser Hinsicht wesentlich ergiebiger für die einschlägige Forschungscommunity ist freilich die 2005 veröffentlichte Studie von Verena Moritz „Zwischen Nutzen und Bedrohung“, in der die Autorin eine detaillierte und kritische Darstellung der Lebensbedingungen der russischen Kriegsgefangenen in Österreich-Ungarn gibt. 44
Julia Walleczek setzt sich in ihrer Dissertation „Hinter Stacheldraht“ aus dem Jahre 2012 kritisch mit dem „Mythos von der besseren Gefangenschaft“ in österreichisch-ungarischen Kriegsgefangenenlagern auseinander.
Eine ganz andere Facette zeigen Veröffentlichungen von geschichtsbegeisterten lokalen und regionalen Arbeitskreisen, sogenannten Heimatforschern. Zwischen 1989 und 1997 erschienen: Fritz Fellner: „Die Stadt in der Stadt – Das Kriegsgefangenenlager Freistadt“ 45 und Franz Wiesenhofers „Gefangen unter Habsburgs Krone“ 46 . Während im ersten Fall nur eine überblicksmäßige Darstellung erfolgt, basiert die zweite Publikation auf einer fundierten Auswertung der Quellendokumente bezüglich der Lager im niederösterreichischen Erlauftal. 2013 hat der Museumsverein Marchtrenk eine eindrückliche Publikation über das Kriegsgefangenenlager Marchtrenk herausgebracht. Auch für das ehemalige Kriegsgefangenenlager Aschach wurde im gleichen Zeitraum unter dem Titel „Bilder einer vergessenen Stadt“ in ähnlicher Weise ein Erinnerungsbuch veröffentlicht.
Читать дальше
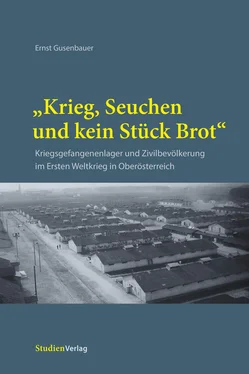
![Edzard Ernst - Trick or Treatment. The Undeniable Facts about Alternative Medicine [Electronic book text]](/books/151762/edzard-ernst-trick-or-treatment-the-undeniable-fa-thumb.webp)