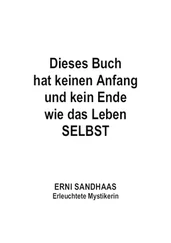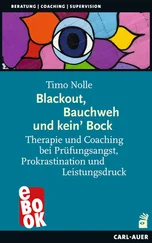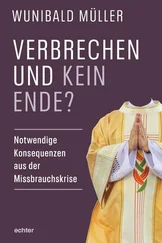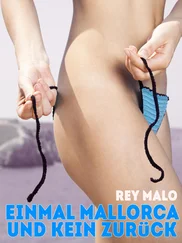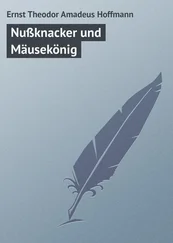Den Schwerpunkt bildet die facettenreiche Darstellung des Verhältnisses von Zivilbevölkerung und Kriegsgefangenenlager. Dabei wird dem Seuchenjahr 1915 naturgemäß breiter Raum gewidmet. Hier werden wie in den anderen Themenbereichen aus der Fülle der Fallbeispiele des Originals nur eindrückliche herangezogen. Die Studie reklamiert keineswegs in einem Anflug von Vermessenheit große epochale Erkenntnisse beizubringen. Was sie jedoch beabsichtigt, ist, eine möglichst genaue Studie über die Auswirkungen der Errichtung von Kriegsgefangenenlagern auf oberösterreichischem Boden zu liefern. Doch wird auch der Blick auf die Nachwirkungen geschärft, welche zweifellos bis in die Anfangsjahre der Ersten Republik reichten.
Zuletzt sind noch einige methodische Anmerkungen zu Quellenkorpus und Verfahrensweisen angebracht.
Die im nachfolgenden Literaturverzeichnis angeführten Quellen stammen einerseits aus amtlichen Beständen (K. u. K. Kriegsministerium, K. K. Innenministerium, K. K. Statthalterei) bis zur kleinsten Verwaltungseinheit, der kommunalen Ebene.
Andererseits stammt der zweite Teil aus den Beständen der damals in Oberösterreich erscheinenden Tages- und Wochenzeitungen. Dabei wurde besonders Wert darauf gelegt, die verfügbare Publikation möglichst lückenlos heranzuziehen.
Nun sind die zuvor erwähnten Quellentypen in gewissem Sinne als durchaus hybrid zu bezeichnen. 5 Folglich würde jeder Typus nur für sich genommen einer kritischen Bewertung und schlüssigen Interpretation keineswegs genügen. Erst die Verschränkung beider Seiten des verfügbaren Quellenkorpus ermöglicht eine aussagekräftige interpretative Erschließung.
Während der amtliche Schriftverkehr der Bevölkerung praktisch verborgen blieb, konnten in Zeitungsberichten, trotz der allgegenwärtigen Zensur, durchaus Stimmungen in der einen oder anderen Richtung erzeugt werden. Es ist dabei überraschend, wie offen zu manchen Missständen Stellung genommen wurde, die freilich in den internen Berichten der verschiedenen Behörden noch weit dramatischer klangen.
Das vorliegende Buch ist eine kompakte und an ein breites, interessiertes Publikum gerichtete Version. Es basiert auf der gleichnamigen Dissertation, die im Jahre 2012 an der FernUniversität in Hagen, Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften – Historisches Institut, eingereicht und von Prof. Wolfgang Kruse bzw. Prof. Peter Brandt mit der Beurteilung „CUM LAUDE“ angenommen wurde.
Ernst Gusenbauer – Ried, Herbst 2020
_____________________________________
1Vgl. Assmann, Aleida: Der lange Schatten der Vergangenheit (München 2006) 24.
2Vgl. Moritz, Verena: Zwischen Nutzen und Bedrohung (Bonn 2005); Procacci, Giovanna: Fahnenflüchtige jenseits der Alpen. In: Oltmer, Jochen (Hg.): Kriegsgefangenschaft im 1. Weltkrieg (Paderborn/München/Wien/Zürich 2006); Überegger, Oswald (Hg.): Zwischen Nation und Region (Innsbruck 2004); siehe auch Procacci, Giovanna: Soldati e prigionieri italiani nella Grande guerra (Torino 2000); Kramer, Alan: Dynamic of Destruction. Culture and Mass Killing in the First World War (Oxford 2008).
3Vgl. Hansak, Peter: Das Kriegsgefangenenwesen in der Steiermark während des 1. Weltkrieges (Diss. Univ. Graz 1991); Haller, Oswald: Das Internierungslager Katzenau bei Linz im 1. Weltkrieg (Dipl.-Arb. Univ. Wien 1999); Koch, Robert: Das Kriegsgefangenenlager Sigmundsherberg 1915–1918. Im Hinterhof des Krieges (Diss. Univ. Wien 1980); Rappersberger, Petra: Das Kriegsgefangenenlager in Freistadt 1914–1918 (Dipl.-Arb. Univ. Wien 1988).
4Dies gilt vor allem für den Zeitschriftenbestand des OÖLA und der Ö.O. Landesbibliothek (Mikrofiches, Filmrollen, Druckexemplare, bereits digitalisierte Bestände).
5Vgl. Moritz, Verena: Zwischen Nutzen und Bedrohung (Bonn 2005) 48.
Allgemeine Betrachtungen zu Krieg und Kriegsgefangenschaft
Die von dem berühmten deutschen Kriegstheoretiker Carl von Clausewitz angesprochene Dreifaltigkeit des Krieges besagt, dass der Krieg ein Akt der Gewalt ist, dass der Krieg stets in einen Zweikampf zwischen zwei oder mehreren Gegnern mündet mit dem klaren Ziel, Gegner wehrlos zu machen, und dass der Krieg seiner Natur nach immer auch ein politisches Werkzeug darstellt. 6
Doch noch in anderer Weise nähert sich Clausewitz dem Kriegsphänomen, indem er eine Unterscheidung zwischen wirklichem und absolutem Krieg vollzieht.
Der absolute Krieg wird um seiner selbst willen geführt und legt es dabei auf die Zermürbung der Soldaten an. Hier dominieren unbedingter Gehorsam, unerschütterlicher Mut und Selbstaufopferung sowie unbedingtes Ehrgefühl.
Allein daneben existiert der wirkliche Krieg, mit Mäßigung zwischen Zweck und Mittel, der zugleich die Kehrseite der hehren Kriegstugenden offenbart, wie Geschäftemacherei, Furcht, Flucht, Feigheit und Desertion. 7
Auch im Ersten Weltkrieg mochten sich absoluter und wirklicher Krieg miteinander wie ehedem verschränken.
Völlig unbestritten im Forschungsdiskurs ist jedoch die Erkenntnis, dass es sich hier um eine ganz neue Dimension in der Weltkriegsgeschichte handelte. Dieser Krieg galt bereits unter den unmittelbar Mitlebenden als etwas Neuartiges, Ungeheuerliches und Ausgreifendes. 8
Der Erste Weltkrieg war nach Herfried Münkler nicht nur eine Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, hier den US-Diplomaten George F. Kennan zitierend, sondern konnte auch als Laboratorium gesehen werden, in dem fast alles entwickelt wurde, was in den Konflikten der späteren Zeit eine gewichtige Rolle spielen sollte. 9
Der Erste Weltkrieg wurde überdies mit einem nie da gewesenen Einsatz von personellen und materiellen Ressourcen ausgefochten. Der berühmte Soziologe Max Weber prägte dabei die Bezeichnung vom Maschinenkrieg. 10
Das führte einerseits bereits in kürzester Zeit zu einem enormen Blutzoll unter den Soldaten und zu einer massenhaften Zahl von Kriegsgefangenen, die die Logistik der kriegführenden Staaten zu überfordern drohte. Der forcierte Einsatz neuartiger Technologien ermöglichte es, einen Krieg auf Distanz zu führen. Ernst Piper vermeint darin ein Kennzeichen des modernen Kriegs zu finden, nämlich einen rapiden Entpersönlichungsprozess, der beispielsweise sowohl das Sterben im Feld wie auch die Gefangenschaft im fremden Hinterland in ein sachlich-rationales Licht zu rücken vermag. 11
Dass trotz des hohen Blutzolls die Soldaten aller kriegführenden Staaten in ihrer überwältigenden Mehrheit dennoch weiterkämpften, mag damit zu tun haben, dass sie gar keine andere Möglichkeit besaßen, außer der Option, die Waffen zu strecken. Sich zu ergeben und dadurch in Kriegsgefangenschaft zu geraten, war ein durchaus gefährliches Unterfangen.
Soldaten wurden auf beiden Seiten oftmals getötet, nicht nur, wenn sie zu kapitulieren versuchten, sondern auch, nachdem sie die Waffen niedergelegt hatten. Der britische Historiker Niall Ferguson spricht in diesem Zusammenhang von den versteckten Gräueltaten des Ersten Weltkriegs. 12
Eine viel häufigere Variante war jedoch nicht die selbst gewählte Kapitulation, sondern jene, die durch Kriegshandlungen des Gegners unausweichlich wurde.
Für die Nehmerseite wurden Kriegsgefangene mit der zunehmenden Dauer des Krieges und der damit verbundenen Lebensmittelknappheit zu einer immer größeren Belastung, und dies galt besonders für die Mittelmächte, die schwer unter der alliierten Blockade litten.
Kriegsgefangene waren als Ersatz für die fehlenden Arbeitskräfte im Hinterland willkommen. Die Haager Landkriegsordnung hatte dies ja bekanntlich durchaus unterstützt, denn neben der Verpflichtung, die Kriegsgefangenen mit Menschlichkeit zu behandeln, galt ein allfälliger Arbeitseinsatz als erlaubt, freilich mit der Einschränkung, dass sie im Hinterland keine Aufgaben erhalten durften, die zu militärischen Operationen genutzt werden konnten. 13 Diese Grundprämisse wurde jedoch von den meisten kriegführenden Staaten wohlweislich umgangen bzw. negiert.
Читать дальше
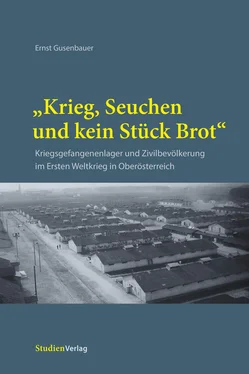
![Edzard Ernst - Trick or Treatment. The Undeniable Facts about Alternative Medicine [Electronic book text]](/books/151762/edzard-ernst-trick-or-treatment-the-undeniable-fa-thumb.webp)