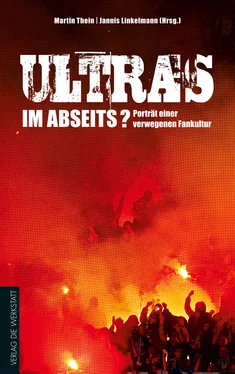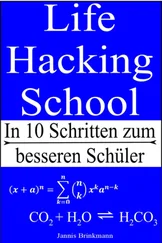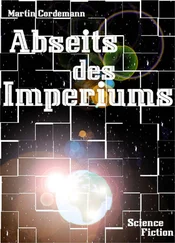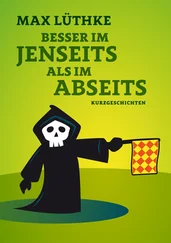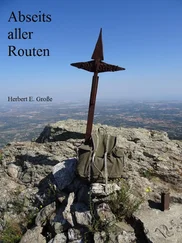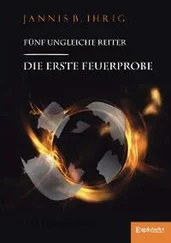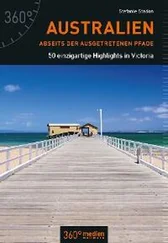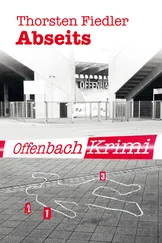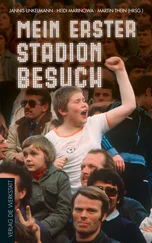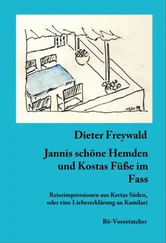Markus Verma: „Der Weg ist das Ziel“
Gerd Dembowski: Eine notwendige Erfindung des Selbst
Peter Czoch: Wandel von Fanidentitäten im Zuge kommerzieller Entfremdung
Tobias Wark: Ultras und Politik
Einblicke in eine verborgene Szene Mit Ultras im Gespräch
Jonas Gabler: „Sich die Freiheiten nehmen“
Martin Thein: Ultras hautnah!
Umstritten und gefürchtet Eine Subkultur zwischen Gewaltvorwürfen, Repression und Prävention
Konrad Langer: Ultras zwischen Gewalt und Kriminalisierung
Udo Tönjann: Ultras und Polizei
Michael Müller / Silke Martin: Vom Verhältnis zwischen Polizei und Ultras
Volker Herold: Fansozialarbeit Gewaltprävention im Umgang mit Ultras
Thomas Feltes: Ultras und Fanbeauftragte
Alexandra Schröder: Zu Risiken und Nebenwirkungen bei Fußballspielen in Spanien ein Bericht
Ultras von außen Spurensuche aus unterschiedlichen Perspektiven
Jan-Philipp Apmann / Gabriel Fehlandt: Pyrotechnik
Mike Glindmeier: Ultras in den Medien
Christoph Ruf: Occupy Sesame Street
Tilmann Feltes: Ultras und „die Anderen“
Martin Gerster / Oliver Stegemann / Alexander Geisler: Ultras und Sportpolitik in Deutschland
Jannis Linkelmann / Martin Thein: „Ich denke, wir waren auf einem guten Weg!“
Ultras im Abseits? Chancen und Risiken einer Subkultur
Gerald von Gorrissen: „Ultra“ in Deutschland am Scheideweg
Michael Gabriel / Volker Goll: Die Ultras
Die Herausgeber
Die Autoren
Immer häufiger scheint der deutsche Fußball am Abgrund zu stehen. Das Verhalten der Fans rückt deutschlandweit regelmäßig medial in den Mittelpunkt und zeichnet das Bild einer von Hass und Gewalt durchsetzten Fankultur. Manche Medien sahen im Herbst 2011 in den Vorfällen bei den zwei DFB-Pokalspielen in Dortmund und Frankfurt Ende Oktober sogar ein „Attentat auf den Fußball“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung) oder einen „Anschlag auf den Fußball“ (STERN Online). Nach umfangreichem Pyrotechnik-Einsatz und einem im Freudentaumel begründeten verfrühten Platzsturm beim Relegationsspiel für die 1. Bundesliga zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC aus Berlin im Mai 2012 verstärkte sich die Hysterie nachhaltig. Die Abschaffung der Stehplätze steht seitdem genau so im Raum wie ein Alkoholverbot in den Zügen des öffentlichen Nahverkehrs im Vorfeld von Fußballspielen. Einen unrühmlichen Höhepunkt fand die Diskussion in einer bekannten Fernseh-Talkshow, in der von „Taliban der Fans“ gesprochen und Choreografien als „faschistoide Versammlungsrituale“ dargestellt wurden. Heben die deutschen Vereine und Verbände die Fans häufig aufgrund ihrer Kreativität und der tollen Stimmung hervor, werden Fußballanhänger bei öffentlichkeitswirksamen Ereignissen schnell als Gewalttäter gebrandmarkt.
Die Darstellungen in der Öffentlichkeit vermittelten allgemein den Eindruck, dass Straftaten in und um Stadien nachhaltig gestiegen und die heutigen Fußballfans gewalttätiger als die früheren sind. Offizielle Verlautbarungen untermauerten dies: So berichtet die „Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze“ (ZIS) für die Saison 2010/11 in der 1. und 2. Bundesliga von insgesamt 846 verletzten Personen, wobei Unfallopfer in dieser Zahl nicht enthalten sind. Nach Angaben der ZIS handelt es sich dabei um den Höchststand der vergangenen zwölf Jahre.
Fankultur im Wandel Vom Aufstieg einer Subkultur
Elmar Vieregge: Fußball im Wandel
Traditionell eingestellte Fans im „modernen Fußball“ zwischen Kommerz, Komfort und Konfrontation
Zwischen 2000 und 2010 kam es im deutschen Profifußball zu grundlegenden Veränderungen, die erhebliche Auswirkungen auf die traditionell eingestellte Fanszene hatten. Deren in Anhängerschaften einzelner Vereine unterteilte Angehörige unterstützten zwar in erster Linie ihre Klubmannschaften, konnten aber den Zustand des Ligabetriebs auch an der Leistungsfähigkeit der Nationalmannschaft ablesen. Diese schied zu Beginn des Jahrzehnts bei der 2000 in Belgien und in den Niederlanden ausgetragenen Europameisterschaft nach einer derart desolaten Leistung aus, dass sich viele Fans pessimistisch hinsichtlich der Zukunft und der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Fußballs zeigten. Nur sechs Jahre später belegte die DFB-Auswahl den dritten Platz bei der 2006 im eigenen Land veranstalteten Weltmeisterschaft. Dabei entstand eine als „Sommermärchen“ beschriebene Stimmung, die nicht nur reine Sportfreunde, sondern auch ein eventorientiertes Publikum erfasste. Während der 2010 in Südafrika ausgetragenen Weltmeisterschaft bestätigte das Nationalteam nicht nur seine wiedergewonnene Stärke durch einen weiteren dritten Platz, sondern weckte Zuversicht auf erfolgreiche Teilnahmen an zukünftigen Turnieren.
Die Grundlage für die internationalen Auftritte deutscher Auswahlspieler bildeten vor allem die Verhältnisse der 1. und 2. Bundesliga. 1Die positive Entwicklung der Nationalmannschaft ging mit Veränderungen einher, die eine Steigerung des Medienengagements, eine Verbesserung der Finanzierungsmöglichkeiten, den Neubau von Stadien und die Gewinnung neuer Zuschauergruppen einschlossen. Die als „moderner Fußball“ bezeichnete Entwicklung wirkte sich erheblich auf die Situation der Fan-szene aus. Zu ihr gehören zwar unterschiedliche Gruppen, sie wird aber von Fans geprägt, die sich als Teil ihrer Vereine begreifen, diesen unabhängig vom Tabellenstand langjährig die Treue halten, sich im Alltagsleben zu ihnen bekennen und durch ihre lautstarke Unterstützung die Atmosphäre in den Stadien prägen. Diese Personen können als traditionell eingestellte Fans bezeichnet werden. Dazu gehören sowohl sogenannte Normalos und die nach ihren geschmückten Jacken benannten Kutten als auch Hooligans und Ultras.
In den Jahren nach 2000 veränderten sich die Verhältnisse im Fußball grundlegend, wobei verschiedene Faktoren wechselseitig aufeinander einwirkten. So steigerte sich etwa die Aufmerksamkeit der Medien, was zu höheren Einnahmen der Vereine aus Werbung und Vermarktung von Fernsehübertragungsrechten führte. Zudem erhöhte sich die Investitionsbereitschaft der Wirtschaft. Größere Einnahmen eröffneten den Klubs neue Möglichkeiten, Spitzenspieler anzuwerben, die Ausstattungen ihrer Spielstätten zu verbessern und die Nachwuchsarbeit zu fördern. Dies motivierte mehr Menschen zu Stadionbesuchen, was wiederum das Interesse der Medien und der sonstigen Wirtschaft verstärkte. Im Verlauf dieser Entwicklung änderten sich auch die Bedingungen für die Fußballfans.
Der Profifußball erfreute sich bereits vor der Jahrtausendwende eines, insbesondere im Bereich des Fernsehens, beständig wachsenden Interesses der Medien. Von 2000 bis 2010 hielt diese Entwicklung an, und insbesondere die durch Werbung finanzierten Privatsender steigerten ihr Bemühen, den Fußball zu vermarkten. Den Bundesligavereinen kam dabei zugute, dass sich ihre Einnahmen aus der Veräußerung von Übertragungsrechten erhöhten. Andererseits wirkten die Sender zur Wahrung ihrer ökonomischen Interessen auf den Spielbetrieb ein, was die Verhältnisse in den Stadien beeinflusste.
Für deren Besucher hatte dies einerseits positive Folgen, denn die zunehmenden Einkünfte trugen dazu bei, dass die Vereine ihre bauliche Infrastruktur modernisierten, die Ausbildungsbedingungen für Nachwuchsspieler verbesserten und ihre Attraktivität im internationalen Wettbewerb durch herausragende Spieler steigern konnten. Zudem sorgten die Sender durch Investitionen in ihre Kamera- und Übertragungstechnik dafür, dass Fußballanhänger umfassend über die Geschehnisse auf den Spielfeldern unterrichtet wurden. Andererseits kam es zu diversen Nachteilen, die sich aus dem primären Interesse der TV-Gesellschaften ergaben, ihre Gewinne zu maximieren. Sie waren bestrebt, die Spieltage auf mehrere Termine zu zersplittern, um das Produkt Fußball durch möglichst viele Einzelspiele zu für Fernsehzuschauer freundlichen Zeiten zu vermarkten. Die bereits vor der Jahrtausendwende erfolgte Einrichtung von Freitagabend- und Sonntagsspielen verfestigte sich nach 2000, was den hergebrachten Anpfiff eines kompletten Spieltages am Samstag um 15:30 Uhr zu einer Erscheinung der Vergangenheit machte. Während die Fernsehsender ihren Zuschauern dadurch Übertragungen zu ihnen genehmen Zeiten anboten, belasteten die Spielansetzungen insbesondere zu Auswärtsspielen mitreisende Anhänger, also besonders stark engagierte Fans. Diese standen vor allem bei weit entfernten Sonntagsspielen vor dem Problem einer langen nächtlichen Rückreise im Vorfeld einer am nächsten Morgen beginnenden Arbeitswoche. Darüber hinaus erschwerte ihnen die erst im Verlauf der Saison erfolgende Terminierung der Freitags- und Sonntagsspiele die Vorbereitung ihrer Reisen.
Читать дальше