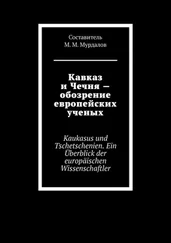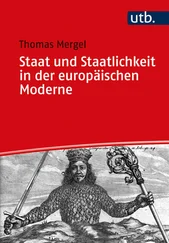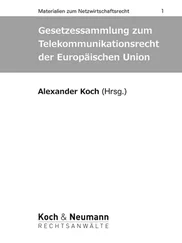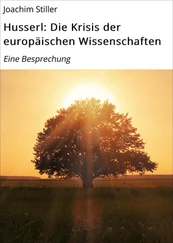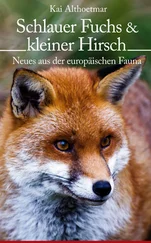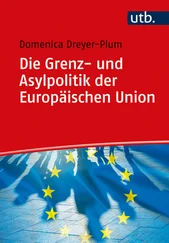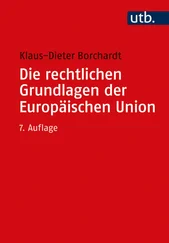Durch die Bereitstellung von unsicheren Produkten auf dem Markt kann ein Hersteller ferner einer Reihe von zivilrechtlichen Folgen ausgesetzt sein, die es durch geeignete Compliance-Strukturen zu verhindern gilt. Bereits an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass nach den verschiedenen zivilrechtlichen Haftungsnormen der Ersatzverpflichtete autonom zu bestimmen ist. Dementsprechend ist nicht automatisch der Hersteller im Sinne des ProdSG auch der zivilrechtlichen Haftungsadressat. Allerdings können zwischen dem öffentlichrechtlichen Herstellerbegriff und den zivilrechtlichen Haftungsregimen Verbindungen entstehen, insbesondere bei gesetzesverweisenden Haftungsnormen, bei denen der Verstoß gegen produktsicherheitsrechtliche Normen zu einer zivilrechtlichen Haftung führt, zum Beispiel bei § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 3 Abs. 1 ProdSG oder § 3 a UWG i.V.m. § 3 ProdSG.
aa) Deliktische Ansprüche
In erster Linie können gegen den Hersteller deliktische Produkthaftungsansprüche nach §§ 823 ff. BGB in Betracht kommen, wenn Schäden an Rechtsgütern eines anderen, unter anderem an Leben, Körper und Gesundheit, eingetreten sind. Dabei muss die schädigende Handlung rechtswidrig und schuldhaft erfolgen. Insbesondere sieht § 823 Abs. 2 BGB eine Schadensersatzpflicht für denjenigen vor, der schuldhaft gegen ein Gesetz verstößt, das den Schutz eines anderen bezweckt. Schutzgesetze mit produktsicherheitsrechtlichem Bezug sind unter anderem das ProdSG, die Verordnungen zum Produktsicherheitsgesetz, die Gesetze zur Umsetzung von EU-Richtlinien, zum Beispiel das LFGB, das PflanzenschutzG und das AMG.54
bb) Herstellerhaftung beim autonomen Fahren
Im Kontext von stets komplexer werdenden Produkten kann die Herstellerhaftung nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 3 ProdSG erheblich an Bedeutung gewinnen. Dies zeigt sich insbesondere im Rahmen der Haftung von autonom fahrenden Fahrzeugen. Nach der aktuellen Rechtslage haften bei Verkehrsunfällen von selbstfahrenden Pkws vor allem die Fahrzeughalter nach § 7 StVG.55 Jedoch ist daneben durchaus an eine Haftung des Herstellers zu denken, der die Steuerung des Fahrzeugs konzipiert. Insbesondere die Haftung nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 3 ProdSG kann in Zukunft eine maßgebliche Rolle spielen, da § 3 ProdSG kein Verschulden voraussetzt.56 Folglich könnte über § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 3 ProdSG der Hersteller des Fahrzeugs für Unfälle haften, die auf einen fehlerhaften Fahrassistenten zurückzuführen sind.
Als sicher gilt, dass autonom fahrende Fahrzeuge in Verkehrsunfälle verwickelt sein werden, die sie auch (mit-)verursacht haben. Dies geht zum Beispiel aus einem aktuellen Bericht von Google an die kalifornische Kraftfahrzeugbehörde hervor, der besagt, dass es in dem vierzehnmonatigen Berichtszeitraum zu mehr als einem Dutzend Unfälle gekommen wäre, wenn der Fahrer nicht eingegriffen hätte.57 Bemerkenswerterweise halten die Hersteller der autonomen Fahrzeuge selbst die Produktverantwortlichkeit des Herstellers für das adäquate Haftungsinstrument, wie Vertreter von Google und Volvo bereits beteuerten.58
Somit eröffnet die Haftung des Fahrzeugherstellers nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 3 ProdSG eine neue Gefahr der Haftung für intelligente beziehungsweise selbstlernende Systeme. Der Fahrassistent hat im Sinne des § 3 ProdSG sicher zu sein. Für diese Sicherheit trägt der Hersteller die Verantwortung. Jedoch wird es in diesem Rahmen entscheidend sein zu wissen, wer als Hersteller im Sinne des ProdSG anzusehen ist, um als Geschädigter von diesem Haftungsanspruch Gebrauch machen zu können.
cc) Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz
Produkthaftungsrechtliche Ansprüche gegen den Hersteller können aufgrund des ProdHaftG59 geltend gemacht werden. Der Hersteller eines Produkts haftet gemäß § 1 Abs. 1 S. 1 ProdHaftG für Produktfehler, durch die eine Person getötet, ihr Körper oder ihre Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt wurde. Der Hersteller ist in diesem Fall verschuldensunabhängig zum Schadensersatz verpflichtet.60 Ob der Herstellerbegriff des ProdHaftG und des ProdSG gleichzusetzen sind und welche Interdependenzen zwischen den Herstellerbegriffen bestehen, ist Gegenstand der weiteren Untersuchung.61
Gewährleistungsrechte sind Ansprüche, die zwischen zwei Vertragspartnern, insbesondere Käufer und Verkäufer, als Folge eines mangelhaften Produkts ausgelöst werden können. Der Verstoß gegen produktsicherheitsrechtliche Vorschriften kann zu einem Mangel eines Produkts im Sinne des § 434 Abs. 1 BGB führen. Beispielsweise wird in der Zulieferindustrie regelmäßig als Beschaffenheit des Produkts vertraglich vereinbart, dass das gekaufte Produkt rechtmäßig ein CE-Kennzeichen tragen muss. Das Gewährleistungsrecht ist vor allem für Fragen des Regresses in der Lieferkette entscheidend: Sobald ein Kunde Ansprüche geltend macht, stellt sich die Frage danach, wer innerhalb der Lieferkette dafür letztlich die Verantwortung trägt.62 Dies kann auch der Hersteller des Produkts im Sinne des ProdSG sein.
ee) Wettbewerbsrechtliche Folgen
Wettbewerbsrechtliche Folgen treffen den Hersteller, sofern Verstöße gegen produktsicherheitsrechtliche Vorschriften als unlautere geschäftliche Handlung im Sinne des § 3 Abs. 1 UWG angesehen werden. Darunter fällt unter anderem gemäß Nr. 2 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG die Verwendung von Güte- oder Qualitätskennzeichen wie dem GS-Zeichen ohne die erforderliche Genehmigung.63 Außerdem sind gemäß Nr. 9 des Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG unwahre Angaben oder das Erwecken des unzutreffenden Eindrucks verboten, dass ein Produkt verkehrsfähig sei. Des Weiteren kann derjenige unlauter handeln, der einer gesetzlichen Vorschrift zuwiderhandelt, die gemäß § 3a UWG auch dazu bestimmt ist, das Marktverhalten im Interesse der Marktteilnehmer zu regeln. Unter dieses Verbot können auch ausgewählte produktsicherheitsrechtliche Vorschriften fallen, beispielsweise § 3 ProdSG64 und § 6 Abs. 1 S. 1 und S. 2 ProdSG.65 Dementsprechend sind Unterlassungsansprüche nach § 3a UWG i.V.m. § 7 ProdSG und § 5a Abs. 2, Abs. 4 UWG möglich, wenn ein Unternehmen Produkte ohne ein erforderliches CE-Kennzeichen auf den Markt bringt.66 Daneben können Beseitigungs- sowie Schadensersatzansprüche oder Gewinnabschöpfungen durch Wettbewerber oder Verbraucherverbände geltend gemacht werden. Jedoch erfolgt in der Praxis regelmäßig zunächst eine Abmahnung, die auf Kostentragung und Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung abzielt.67
Darüber hinaus zeigen Unternehmen nicht selten ihre Wettbewerber bei Marktüberwachungsbehörden an, wenn sie Erkenntnisse über nicht konforme Produkte (zum Beispiel durch Vergleichstests) erhalten.68
d) Ordnungswidrigkeits- und strafrechtliche Folgen
Verstöße gegen produktsicherheitsrechtliche Vorschriften können für den Hersteller außerdem Ordnungswidrigkeits- und strafrechtliche Folgen haben. Nach dem Bußgeldkatalog des § 39 ProdSG sind Bußgelder in Höhe von bis zu 100.000 € bei (jedem) Verstoß gegen produktsicherheitsrechtliche Vorschriften möglich. Zudem kann eine Meldung an das Gewerbezentralregister nach § 149 Abs. 2 Nr. 3 Gewerbeordnung (GewO) erfolgen, wenn ein Bußgeld verhängt wird, das mit der Ausübung eines Gewerbes im Zusammenhang steht und mehr als nur 200 Euro beträgt. Ferner ist eine Gewinnabschöpfung im Rahmen des Bußgeldtatbestands nach § 17 Abs. 4 OWiG oder § 29a OWiG möglich, die im Übrigen steuerliche Abzüge nicht berücksichtigt.
Im Rahmen der Legalitätspflicht der Unternehmensführung können derartige produktsicherheitsrechtliche Verstöße auf das vorsätzliche oder fahrlässige Außerachtlassen von Aufsichtsmaßnahmen seitens der Unternehmensführung zurückzuführen sein. In diesem Fall kann gemäß § 130 Abs. 1 OWiG ein Ermittlungsverfahren persönlich gegen die Mitglieder des Vorstands beziehungsweise der Geschäftsführung eingeleitet werden.
Читать дальше