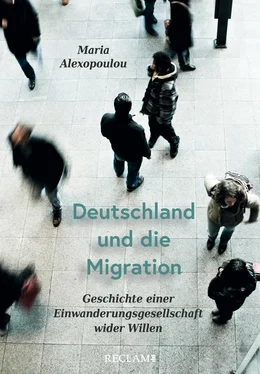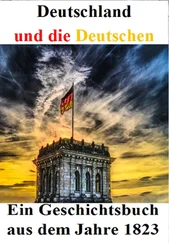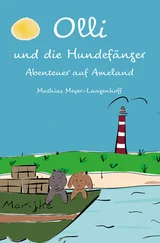In ihrem Zusammenhang wurde auch das Für und Wider der Kolonialpolitik breit diskutiert. Reichskanzler Bülow erklärte dem Reichstag, dass Kolonialpolitik keine Entscheidungsfrage sei – man könne sich nicht dagegen entscheiden, sondern man müsse kolonisieren, da der »Trieb zur Kolonisation zur Ausbreitung des eigenen Volktums« in jedem vitalen Volk angelegt sei. Der Zentrumspolitiker Matthias Erzberger stimmte dem Prinzip zu, plädierte aber dafür, die Kolonialvölker nicht als Feinde, sondern als »Mündel« zu betrachten; denn der »Eingeborene ist das schwarze Kind mit seinen Vorzügen und all seinen großen, großen Schattenseiten«. Und selbst August Bebel, Abgeordneter der SPD, die sich bislang gegen die Kolonialpolitik ausgesprochen hatte, bezeichnete die Kolonisation als »Kulturtat«, welche den »fremden Völkern« die »Errungenschaften der Kultur und der Zivilisation« bringe.14
In der medialen Berichterstattung über den Guerillakrieg der Nama gegen die deutschen Kolonisatoren vollzog sich in Deutschland, so der Historiker Frank Oliver Sobich, parallel dazu ein Wandel des vorherrschenden Bilds »des Negers« vom faulen, kindergleichen Wilden zur gefährlichen »schwarzen Bestie«.15 Als Träger des Siedlungsimperiums in Afrika – und im Osten des Reichs, wo seit 1908 auch eine Kolonisationskommission tätig war – verstand man jedenfalls in der Regel nicht die Nation, den Staat oder bestimmte Klassen, sondern das »deutsche Volk«.16
Die weniger politisch Interessierten erreichte das sich ausbreitende rassistische Wissen auch auf anderen Wegen. So war auf der 300-Jahr-Feier der Stadt Mannheim 1907 der »Vergnügungspark Abessinisches Dorf« eine der Hauptattraktionen. Dort wurden in täglichen Schauen, wie eine Postkartensammlung aus der Zeit verrät, nicht nur Themen wie »Schule«, »Töpfer«, »Mutterfreude« und »Moschee« präsentiert, sondern auch Krieger gezeigt und Lanzengefechte vorgeführt. Diese »Attraktionen« bekamen nicht nur die Besucher*innen der »Internationalen Kunstausstellung und der Großen Gartenbauausstellung« zu Gesicht, die von Mai bis Oktober 1907 andauerte, sondern auch die Empfänger der Postkarten oder die Zeitungsleser der nahegelegenen Gemeinde Sandhofen. In einer Ankündigung zur »muhamedanische[n]« Taufzeremonie »im abessinischen Dorfe« konnten sie lesen:
Die Zeremonien, die diese Fremden aus einem fernen Weltteile dabei gewißenhaft ausführen, muten jeden Europäer seltsam an, und da zuletzt noch durch Speerwerfen, Freudentänze, Fußringkämpfe, einen Umzug sowie einen sehr ergiebigen Schmaus die Schaulust befriedigt wird, so dürfte dieses eigenartige Fest auch von Europäern viel besucht werden.17
»Völkerschauen« hatten sich in den europäischen Städten zu einem rentablen Geschäft entwickelt und brachten einen Hauch von »Afrika« in zahlreiche Metropolen. Das »deutsche Volk« konnte somit am sprichwörtlichen »Platz an der Sonne« teilhaben. Schließlich kamen alle Gesellschaftsschichten in gewissem Maße im Alltag mit den Kolonien in Verbindung, sei es, dass sie im Kolonialladen exotische Waren erwarben, sich bei den Schauen in wohligem Grusel über die »Eingeborenen« ergingen oder sich bei der Zeitungslektüre selbst mittelbar als Kolonialherr*innen fühlen konnten.
Andererseits gehörten die Teilnehmer*innen solcher Schauen zu den wenigen »Farbigen«, die neben der persönlichen Dienerschaft von deutschen Militärs oder Siedlern aus den Schutzgebieten überhaupt als Migrant*innen nach Deutschland kommen durften. Einigen wenigen unter ihnen gelang es auch, in Deutschland zu bleiben, was einer der Gründe war, weshalb die Deutsche Kolonialgesellschaft derartige Schauen ablehnte.
Der Kameruner Ekwe Bruno Ngando beispielsweise hatte 1896 mit einer Truppe an der Berliner Gewerbeausstellung teilgenommen. Wie er in einem Schreiben an die Behörden berichtete, mit dem er sich 1912 um die Reichsangehörigkeit bewarb, verspürte er daraufhin »keine Lust« mehr, »mit meiner Truppe weiter zu reisen«. Stattdessen war er bei einem Berliner Schneidermeister in die Lehre gegangen, arbeitete nun in Hannover als Kellner und wollte dort die »Büffetdame Ida Kleinfeld« heiraten. Sein Einbürgerungsantrag wurde abgelehnt, wie wohl in den meisten dieser ohnehin wenigen Fälle im Deutschen Reich.18
Die »Eingeborenen« sollten in Übersee, oftmals unter Zwang bzw. in regelrechten Arbeitslagern, für die deutschen Siedler*innen vor Ort arbeiten, was zudem im Zuge ihrer »Zivilisierungsmission« als »Erziehung zur Arbeit« verklärt wurde.19 Zuhause im Reich erledigten derweil andere »minderwertige Völker« jene Arbeit, die man als Deutscher nicht mehr machen wollte.
»Arbeitseinfuhrland« Deutschland
Es ist fraglos, daß die deutsche Volkswirtschaft aus der Arbeitskraft der im besten Alter stehenden Ausländer einen hohen Gewinn zieht, wobei das Auswanderungsland die Aufzuchtkosten bis zur Erwerbstätigkeit der Arbeiter übernommen hat. Von noch viel größerer Bedeutung ist jedoch das Abstoßen oder die verminderte Anwerbung der ausländischen Arbeiter in Zeiten wirtschaftlichen Niederganges. Die Nichtbeschäftigung der ausländischen Arbeiter bedeutet alsdann für den deutschen Arbeitsmarkt keine Arbeitslosigkeit, sondern ein Fernbleiben der Ausländer aus Deutschland […].
[…] Die ausländischen Tagelöhner zeigen die größere Bereitwilligkeit, grobe und schwere Arbeiten zu übernehmen, als die auf höherer Kulturstufe stehenden deutschen Arbeiter. Ihnen sind gewisse Arbeiten vorbehalten, die der deutsche Arbeiter nur mit Widerstreben ausführt. […]
Mit der Schwere der Ausländerarbeit ist aber zumeist eine ermüdende Einförmigkeit ohne irgendwelche geistige Anspannung, ein abstoßender Schmutz und ein Zusammenkommen unvermeidlicher, unhygienischer Arbeitsbedingungen verbunden. Das Abstoßen dieser Arbeiten auf die Ausländer bedeutet keine Entartung, sondern eine in hygienischer Beziehung erwünschte Förderung der Volkskraft. […]
Ist es unvermeidlich, ausländische Arbeiter heranzuziehen, so scheint es auch sozialpolitisch angezeigt, sie gerade mit den niedrigsten, keine Vorbildung erfordernden und am geringsten entlohnten Arbeiten zu beschäftigen, denn dadurch besteht für die einheimische Arbeiterschaft der beachtenswerte Vorteil, daß ihr Aufstieg von der gewöhnlichen, niedrig entlohnten Tagelöhnerarbeit zu der qualifizierten und gut entlohnten Facharbeit wesentlich erleichtert wird.1
Dieses Resümee zog 1918 Friedrich Syrup, der zwei Jahre später, nunmehr in der Weimarer Republik, erster Leiter des Reichsamtes für Arbeitsvermittlung wurde und der während der NS-Herrschaft als Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz die Zwangsarbeit maßgeblich mitorganisierte. In diesen Absätzen fasste Syrup nicht nur die bisherigen Erkenntnisse zum Phänomen der ausländischen Arbeitsmigration zusammen. Er formulierte gleichzeitig auch das Verwertungskalkül, unter dem ausländische Arbeitnehmer*innen auch künftig betrachtet wurden und das trotz aller »volkstumspolitischen« Einwände im Zweifel überwog. Die »Arbeitsfähigkeit« entschied darüber, ob eine wegen ihrer Herkunft geringgeschätzte und damit für das »Deutschtum gefährliche« Gruppe dennoch zeitweilig als nützlicher Teil der Bevölkerung in Deutschland akzeptiert wurde.2
Die Migration von Arbeiter*innen war bereits im gesamten 19. Jahrhundert Normalität gewesen, wobei Sesshaftigkeit und Mobilität zunächst auf regionaler Ebene ausgehandelt wurden. Die Historikerin Katrin Lehnert hat am Beispiel Sachsens herausgearbeitet, wie die Behörden in den 1830er Jahren zunächst versuchten, das Gesinde, hochmobile junge Frauen und Männer, die traditionell auch aus dem benachbarten Böhmen auf Zeit zum Arbeiten kamen, gegen deren Widerstand zur Sesshaftigkeit zu bewegen. Gegen Ende des Jahrhunderts war schließlich die Freizügigkeit nur der Ausländer beschränkt worden, während Deutsche das Recht auf Freizügigkeit – zu kommen, zu gehen oder zu bleiben – nun in allen deutschen Bundesstaaten zuerkannt bekamen. Die deutschsprachigen Böhmen, die formaljuristisch Ausländer*innen waren, durften allerdings auch weiterhin nach Sachsen kommen, während tschechischsprachige Böhmen als Ausländer*innen nicht nur in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt wurden, sondern weitere rechtliche und soziale Diskriminierungen erfuhren.3 Mobilität und Arbeit entwickelten sich zu den zentralen gesellschaftlichen Feldern, auf denen die Trennung und Hierarchisierung von ›Deutschen und Ausländern ‹ stattfand und das spezifische Bild des Ausländers sein Gepräge bekam.
Читать дальше