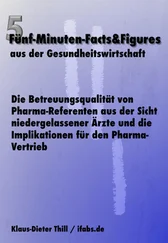Diese Zeichen dienten dazu, in diesen nach Herkunft segregierten Gesellschaften die unterschiedlichen Gruppen, die mit den Deutschen auf engstem Raum zusammenarbeiteten, erkennbar zu machen. Je extremer das Regime in dieser Hinsicht war, desto wichtiger war die Sichtbarmachung. Schließlich ließ sich die Herkunft der ausländischen Arbeiter*innen oder weiterer Minderheiten in Deutschland nicht an äußeren Merkmalen festmachen. Die Betroffenen trugen das Zeichen ihrer Differenz nicht direkt auf der Haut, im Gegensatz zu den Schwarzen Amerikaner*innen, den mexikanischen oder chinesischen Arbeitsmigrant*innen in den USA, die anhand phänotypischer Merkmale kategorisiert und hierarchisiert wurden. Derartige Assoziationen stellten schon Zeitgenossen wie der Agrarökonom August von Waltershausen her. Er schrieb 1903 in Bezug auf die gesamte ausländische »Arbeiterschicht zweiten Grades« in Deutschland, dass sie die gleichen Funktionen erfülle wie »der Neger in den nordamerikanischen Oststaaten, der Chinese in Kalifornien, der ostindische Kuli in Britisch-Westindien, der Japaner in Hawaii, der Polynesier in Australien«.1
Trotz der beschriebenen Hindernisse migrierten Menschen, wie sie es schon immer getan hatten, über Staatsgrenzen hinweg und wurden sesshaft. Oft widersetzten sie sich dabei den Kontrollansprüchen des Staates und wurden mit Widerwillen und Diskriminierungen innerhalb der Gesellschaft konfrontiert, in die sie einwanderten oder durch Grenzverschiebungen oder koloniale Eroberungen hineinkatapultiert wurden.
1884/85 trat das Deutsche Kaiserreich als »verspätete Nation« direkt in die Phase des Hochimperialismus ein und wurde zum Kolonialreich. Die überseeischen Kolonien stellten in der wilhelminischen Ära einen der imperialen Grenzräume dar, in denen es um das »Schicksal des deutschen Volkes« ging, das seiner »Überlegenheit« als »Kulturvolk« weltweit Geltung verschaffen sollte. Auch im östlichen Grenzgebiet Preußens trieb man die Konsolidierung des ›Deutschtums‹ voran, indem die weitere Ansiedlung und kulturelle Dominanz von Deutschen gefördert wurden. In beiden imperialen Grenzräumen, so die Historikerin Dörte Lerp, sicherte sich das Kaiserreich die Herrschaft über die in Besitz genommenen Territorien und die dortige Bevölkerung, indem es Deutsche von Nicht-Deutschen scharf trennte und Ausbeutungsstrukturen zugunsten ersterer etablierte. Obwohl beide Kolonialismen – der überseeische und der osteuropäische – innerhalb des Kaiserreichs immer wieder kritisiert wurden, prägten sie Deutschland nachhaltig, was die Produktion von rassistischen Wissensbeständen über ›Deutsche und Ausländer ‹ betrifft.
Das polnische Königreich war unter den europäischen Mächten mehrfach aufgeteilt worden und seit 1796 als eigenständiger Staat vollständig von der Karte verschwunden. Die damit verbundenen Gebietszugewinne hatten Preußen neue polnisch-sprachige Untertan*innen eingebracht, die nun preußische Staatsbürger*innen wurden. Nach der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 wurde die polnischsprachige Bevölkerung Preußens allerdings immer mehr als Fremdkörper empfunden: Das betraf polnischstämmige Deutsche ebenso wie die sogenannten Auslandspolen, also jene, die unter der Herrschaft Russlands und der Habsburger Monarchie standen und die wie zuvor, insbesondere in den Grenzregionen, auf ›deutschem Territorium‹ mobil waren.
Mittels Germanisierungsmaßnahmen und im Kulturkampf gegen die katholische Kirche – der die polnischsprachigen Deutschen zumeist angehörten – sowie deutscher Siedlungs- und Kolonisierungstätigkeiten an den Ostgrenzen wurden sie unter der Federführung des Reichskanzlers und preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck zunehmend als zentrale Gefahr für die deutsche Nation bekämpft. Die »polnische Gefahr« wurde dabei nicht nur an politischen nationalpolnischen Aktivitäten festgemacht, sondern auch am Fortleben polnischen Sprach- und Kulturbewusstseins, sowie an den Jahrzehnte andauernden massenhaften Arbeits- und Transmigrationsbewegungen von Osten nach Westen.
Einen Höhepunkt erreichte die »polnische Abwehrpolitik« 1885, als eine große Zahl von »Russisch-Polen« aus den östlichen Provinzen Preußens ausgewiesen wurde. Personen, die teilweise seit Generationen dort lebten und sich ihres formaljuristischen Status als Ausländer nicht einmal bewusst waren, wurden binnen einiger Tage ausgewiesen oder regelrecht vertrieben. Als entscheidendes Kriterium definierte die amtliche Statistik die Abstammung – nicht aber die Sprachkenntnisse oder die nationale Selbstzuschreibung der Betroffenen. Das zeigt sich klar im Wortlaut der preußischen Ausweisungsbefehle von 1885:
[D]a festgestellt worden ist, daß Sie durch Ihre Abstammung, wenn auch der deutschen Sprache mächtig, zu der Kategorie der gedachten Ausländer gehören, werden Sie im Auftrag der Landespolizeibehörde hiermit angewiesen, Ihren gegenwärtigen Aufenthalt […] und das preußische Staatsgebiet […] mit ihren Familienangehörigen zu verlassen und sich auf dem kürzesten Wege nach Ihrem zukünftigen Aufenthaltsort im Auslande zu begeben.1
In derartigen Prozessen begann sich die binäre Vorstellung von ›Deutschen und Ausländern ‹ herauszubilden, die bei der Volkszählung 1890 erstmals in die neuen statistischen und rechtlichen Kategorien des »Reichsangehörigen« und des »Reichsausländers« gegossen wurde. Diese formaljuristische Unterscheidung zwischen Deutschen und Ausländern wurde laut der Historikerin Léa Renard zwar erst nach zwei Weltkriegen »auch zu einer lebensweltlichen, alltagspraktischen Kategorisierung«.2 Doch der Definitionsprozess dessen, wer Deutsche*r war und wer nicht, trat zu jener Zeit in eine höchst dynamische Phase ein, die von vielen Faktoren beeinflusst wurde.
Es war das Zeitalter der Biopolitik, in dem immer effizienter agierende und sich auf die neuen positivistischen Wissenschaften berufende nationale Staatsapparate die Zusammensetzung und Eigenschaften ihrer Bevölkerungen zu bestimmen, zu kontrollieren und zu manipulieren suchten: Das geschah etwa durch die Einführung von Pässen, das Führen von Statistiken, soziologische, biologische, medizinische Studien und Maßnahmen wie etwa medizinische Grenzkontrollen.3 Besonders angesichts von Migration stellte sich die Frage, wer Teil der Bevölkerung werden durfte und wer nicht – und wie dies reguliert und überwacht werden könnte.
Doch von den antipolnischen Maßnahmen waren auch immer wieder preußische und damit deutsche Staatsbürger*innen betroffen. Beispielsweise ein großer Teil der sogenannten Ruhrpolen, die vom landwirtschaftlich geprägten Osten in den Westen gezogen waren, um dort als Bergleute zu arbeiten, oder auch die polnischsprachige Bevölkerung in Posen, die dort sogar die Mehrheit stellte. Parallel dazu versuchte man stets, die polnischsprachigen Deutschen durch Germanisierungsmaßnahmen von ihrem »minderwertigen, stets zu Exzessen geneigten« Wesen zu befreien und der »Überlegenheit des Deutschtums« näherzubringen, wie es eine preußische Denkschrift von 1898 formulierte.4 Darauf reagierten die Gemaßregelten jedoch oft mit kollektivem oder individuellem Protest und Widerstand.
Besonders mit Blick auf Posen schrieb der Vorstand des Alldeutschen Verbands, Ernst Hasse, 1906: »Die harmlosen Gemüter, die uns noch immer den Rat zu geben wagen, um des lieben Friedens willen ›unsere Mitbürger polnischer Zunge‹ sänftiglich zu behandeln«, seien »mehr als kindlich«, da sie »nicht daran glauben, daß wir uns in einem von den Polen aufgedrängten Kriegszustande befinden.« Deshalb solle man die Polen zwar nicht »ausrotten«, aber »durch eine anders gestaltete Grenze […] dauernd unschädlich« machen.5 Tatsächlich schränkte das Reichsvereinsgesetz von 1908 den Gebrauch der polnischen Sprache in der Öffentlichkeit an Orten ein, an denen die Mehrheit deutschsprachig war – somit praktisch überall im Westen des Reichs.6 Das Verbot, polnisch zu sprechen, betraf stellenweise sogar religiöse Rituale wie Taufen und Beichten, da die deutschen Behörden argwöhnten, diese könnten für »politisch-polnische Agitation« genutzt werden.7
Читать дальше