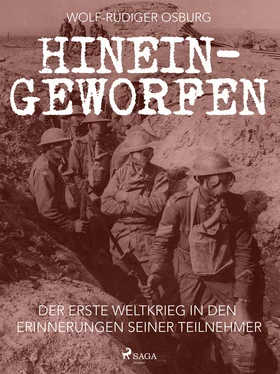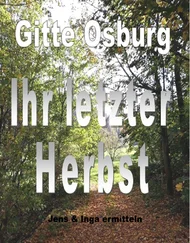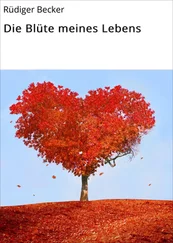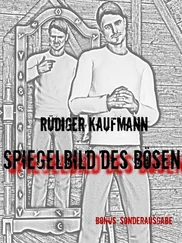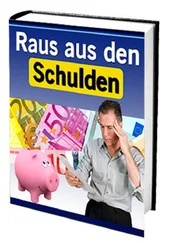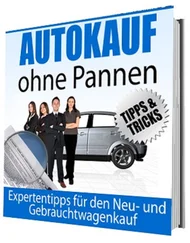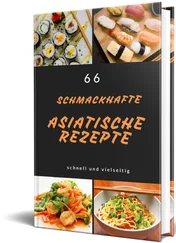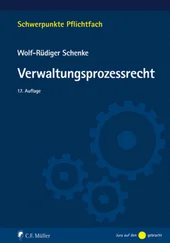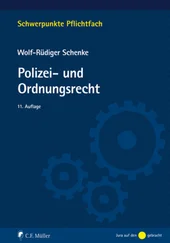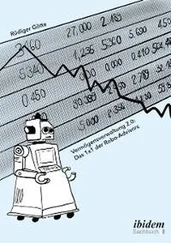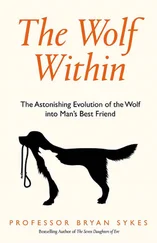Wolf-Rüdiger Osburg - Hineingeworfen
Здесь есть возможность читать онлайн «Wolf-Rüdiger Osburg - Hineingeworfen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Hineingeworfen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Hineingeworfen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Hineingeworfen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Hineingeworfen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Hineingeworfen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
R. M., geb. 1898:
Mein Großvater väterlicherseits besaß in der Gegend von Stolp eine Mühle. Er hatte zweimal geheiratet, und aus beiden Ehen gab es insgesamt zwölf Kinder. Eines davon war mein Vater. Er ist zunächst im väterlichen Gewese, Mühle mit Tierhaltung, aufgewachsen, bis er Soldat wurde, und zwar Pionier. Weil er nun die Sache recht gut machte, ist er 15 Jahre Soldat geblieben, zuletzt als Feldwebel, Mutter der Kompanie, wie es damals hieß. Es war eine Kapitulation in Richtung auf den sogenannten Zivilversorgungsschein. Nachher ist er eben preußischer Beamter geworden. Die jungen Beamten wurden von Versetzungen betroffen, und so sind meine Eltern innerhalb der deutschen Grenzen 15 Mal umgezogen. Meine Mutter erzählte, dass sie in Rawitz in Posen noch nicht einmal die Gardinen aufgesteckt hatte, als eine neue Versetzung nach Trier kam.
Dr. Curt Werner, geb. 1896:
1900 wurde in Lichterfelde – Groß-Lichterfelde hieß es damals – das Kreiskrankenhaus des Kreises Teltow gebaut. Mein Vater wurde dort Verwaltungsinspektor und wir zogen von Potsdam nach Lichterfelde, wo wir eine sehr schöne Dienstwohnung mit großem Garten hatten. Dort bin ich aufgewachsen. Ich habe eine sehr gute Kindheit verlebt und hatte mit meinen Eltern immer ein gutes Verhältnis. Wenn wir spazieren gingen – wir haben viele Spaziergänge gemacht –, erklärte mir mein Vater dies und jenes, alle Arten von Blumen, Schmetterlingen, Tieren. Das habe ich damals alles schon in der Jugend von 1900 bis zum Kriege kennengelernt. Ich wurde national, konservativ erzogen. Mein Vater gehörte zur Deutschen Volkspartei. Er war im Kriegerverein der Hauptkadettenanstalt, wo ich natürlich mit hinging. Es hat mir Spaß gemacht. Ich wäre damals wirklich gerne Soldat geworden. Wenn die Kaiserparade zum Geburtstag im Januar stattfand, fuhren wir auf jeden Fall zu »Den Linden«. Ich mochte die Marschmusik und mag sie auch heute noch. Das ist eben in einem drin gewesen.
Gustav Heckmann, geb. 1898:
Mein Vater war Sparkassendirektor in Voerde am Niederrhein. Er kam in das Dorf als Steuereinnehmer und gründete dann dort eine Sparkasse. Diese hatte für ihn insoweit eine große Bedeutung, als er mit den Mitteln der Sparkasse Leuten, die er schätzte, die, wie er sich ausdrückte, »Trieb hatten« und etwas machen wollten, helfen konnte. Er hat sich auf diese Weise viele Freunde in der Gemeinde, in der ganzen Bürgermeisterei erworben. Bismarcks »Gedanken und Erinnerungen« las er. Er gehörte dem Kriegerverein an, was nicht viel bedeutete. Seine politische Richtung war die national-liberale, vertreten durch die »Rheinisch-Westfälische Zeitung«. Mein Vater hatte gedient. Meine Mutter interessierten politische Themen nicht.
Ernst Krummrey, geb. 1896:
Ich wurde in Berge, Kreis Westhavelland, in der Nähe von Nauen geboren. Es war ein christliches Elternhaus. Mein Vater war Schuhmachermeister und hat sehr darauf geachtet, dass ich mit den Schularbeiten gut zurande kam und meine Pflichten treu und brav erfüllte. Kaisers Geburtstag war ein besonderer Tag, ein schulfreier Tag. Nach der Feier in der Schule kamen wir Jungens am Nachmittag zusammen und spielten Soldaten. Es wurden zwei Gruppen, Freund und Feind, gebildet, die sich am Eichkamp trafen. Dann begann der große Kampf. Wir hatten uns aus Holz Säbel gebastelt. Zuweilen wurde auch richtig zugehauen. Wenn schon Krieg, dann musste es ein richtiger sein.
K. Ol., geb. 1896:
Die nationale Erziehung erfolgte mehr in der Schule. Ich habe das humanistische Kaiser-Wilhelm-Gymnasium in Hannover besucht. Dort wurden wir völlig in dem Sinne erzogen, dass Frankreich unser Erbfeind sei. Das war naturgegeben. Wir jungen Menschen fragten nicht lange nach, wo das herkam. Wir wussten natürlich von der napoleonischen Zeit. 1913 war die Hundertjahrfeier der Völkerschlacht in Leipzig, die entsprechend gefeiert wurde. Wir wußten von den Raubzügen Ludwigs XIV. nach Deutschland hinein, von den Zerstörungen, die die Franzosen damals auf deutschem Boden angerichtet hatten. Das waren genügend Gründe für uns, dass die Abneigung gegen Frankreich berechtigt war. Die jungen Lehrer an unserer Schule waren zum großen Teil Reserveoffiziere. Sie waren stolz, wenn sie zu einer Übung eingezogen wurden. In diesem Sinne wurden eben auch wir, bewusst oder unbewusst, beeinflusst.
Prof. Dr. Willi Wegewitz, geb. 1898:
Als Schuljunge habe ich einen erlebt, der 1870 dabeigewesen war. Das war in der Gastwirtschaft Dunker in Ahlerstedt. Er hatte Gravelotte mitgemacht und pflegte zu sagen: »Da hebt wi di Franzosen in Grut und Mut schoten.« Auf der Präparande genossen wir einen sehr genauen Geschichtsunterricht. Vom Siebenjährigen Krieg lernten wir jede einzelne Schlacht kennen, Roßbach, Leuthen usw. Auch vom Krieg 1870/71 wussten wir jedes Datum. Die Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr 1813/1913 habe ich in Stade hautnah erlebt. Ich weiß noch, es wurde von den Seminaristen »Wallensteins Lager« aufgeführt. Das hat mich kolossal begeistert.
Hermann Kottmeier, geb. 1897:
Der 27. Januar ist für mich noch heute unvergessen. Da hielt der Direktor des Gymnasiums eine Rede und auch der Bürgermeister. Es gab große Festessen, und alles war froh und dankbar. Wer Uniform hatte, zog sie an. Die Kinder waren stolz auf den Vater, die Schüler waren stolz auf den Lehrer. Unser Direktor war klein von Figur, aber er war Hauptmann bei einem preußischen Garde-Jäger-Bataillon und hatte einen wundervollen Helm. Wir waren sehr stolz auf ihn.
G. Ro., geb. 1898:
Ich war in der Schulzeit leidenschaftlicher Anhänger der Farmer in den afrikanischen Kolonien. Wir hatten einen Lehrer, der immer so nett von Afrika erzählen konnte. Mein Bruder war Landwirtschaftslehrling – Eleve nannte man das damals – in Ostpreußen geworden. Für uns stand fest, dass, wenn wir so weit wären, er als Älterer vorausgehen sollte und den Ort, Kongo oder Lomé, das spielte gar keine Rolle, aussuchen sollte. Die Idee war, dort den Militärdienst abzuleisten, um auf diese Weise erst einmal Land und Leute kennenzulernen. Ich ging deshalb zur Landwirtschaftsschule nach Hildesheim. Obwohl ich gleich zu den Schwarzen wollte, konnte ich dort mit dem Einjährigen den richtigen Schulabschluss bekommen. Ich brauchte das Einjährige vor allem nachher für das Militär.
H. J., geb. 1896:
In den Schulferien bin ich immer zum Exerzierplatz gegangen, dort wo heute in Hamburg der Volkspark ist, Osdorf bis Lurup. In der Ferne hörte man das Abschießen von Platzpatronen und dann kam das Signal zum Sammeln. Ich habe alles genau gesehen. Das Musikkorps wurde herausgezogen. Die Spielleute der Kompanie, jede Kompanie hatte zwei Hornisten und zwei Tamboure, stellten sich vor dem Musikkorps auf. Auf der rechten Flügelseite wurden Richtungsmänner aufgebaut. Und dann ging es los: »Still gestanden, das Gewehr über!« Dann hieß es: »Parademarsch, auf der Stelle getreten!« Wenn das Musikkorps und die Spielleute losmarschierten, musste die 1. Kompanie noch so lange auf der Stelle treten, bis die Musik einsetzte. Dann erst marschierte die 1. Kompanie los, und die 2. Kompanie musste auf der Stelle treten. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Die 76er spielten den »Grenadiermarsch« und die 31er hatten ihren »Alexandermarsch«. An Neujahr war morgens immer ein großes Wecken. Das war Tradition. Ich bin zu den 31ern gegangen, weil es zu den 76ern an die Bundesstraße zu weit war. Die 31er spielten zunächst ihr Lied und dann kam »Freut Euch des Lebens«. Dies wiederholte sich bei Kaisers Geburtstag am 27. Januar. Am Vorabend war immer der große Zapfenstreich. Das mochte ich gern.
Ludwig Karl Diebold, geb. 1899:
In der damaligen Zeit war alles auf den Soldaten ausgerichtet. Wir hatten vier Regimenter in Germersheim. Als wir 10 Jahre alt waren, ist eines schönen Tages der Hauptmann Sigl von der 9. Kompanie des 17. Bayerischen Infanterie-Regiments gekommen und hat gefragt, ob wir an einer vormilitärischen Ausbildung teilnehmen wollten. Wir waren dann 80 Jungen. 1915 sind wir aufgelöst worden, weil keine Offiziere mehr da waren. Ich habe eine Bescheinigung ausgestellt bekommen, dass ich in dieser vormilitärischen Ausbildung zum Halbzugführer und Zugführer ausgebildet worden bin.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Hineingeworfen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Hineingeworfen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Hineingeworfen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.