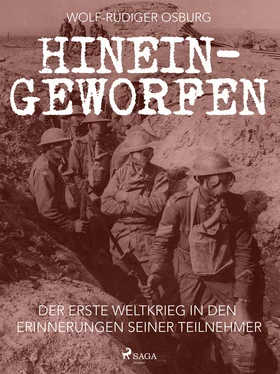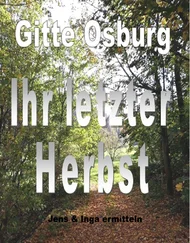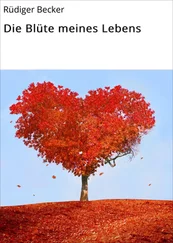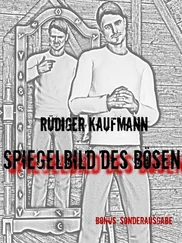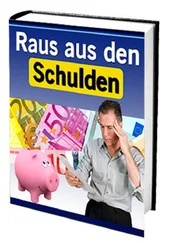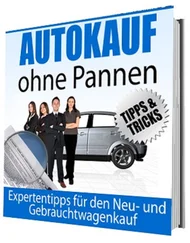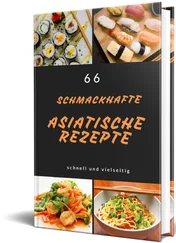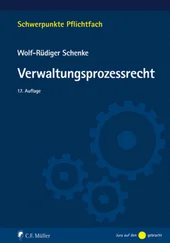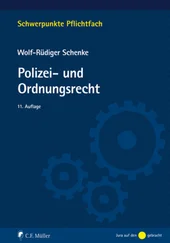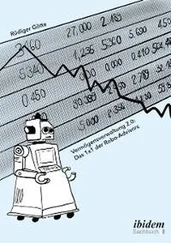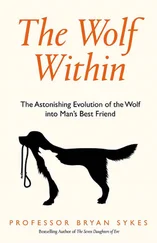Wolf-Rüdiger Osburg - Hineingeworfen
Здесь есть возможность читать онлайн «Wolf-Rüdiger Osburg - Hineingeworfen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Hineingeworfen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Hineingeworfen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Hineingeworfen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Hineingeworfen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Hineingeworfen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Die Lage Deutschlands zu Anfang der zwanziger Jahre ist alles andere als stabil. Die enormen Reparationszahlungen, die die Reichsregierung akzeptieren muss, lähmen die deutsche Wirtschaft. Der Zorn der politischen Rechten richtet sich gegen die »Erfüllungspolitiker«. Außenminister Rathenau und Matthias Erzberger, der Unterzeichner des Waffenstillstandsvertrages von 1918, werden von ehemaligen Freikorpsoffizieren ermordet. Die Zukunftsperspektiven dieser Offiziere sind denkbar schlecht. Zwar wählt die Reichswehr ihre zeitfreiwilligen Rekruten mit Vorliebe aus der Schar der »national zuverlässigen« ehemaligen Freikorpssoldaten. Mitsamt ihren Führern möchte sie sie aber nicht aufnehmen. Stattdessen entwickelt sich in der Folgezeit außerhalb der Legalität eine sogenannte »Schwarze Reichswehr« aus überplanmäßigen »Zeitfreiwilligen« und als Arbeitskommandos getarnten zusätzlichen Verbänden.
Als Deutschland mit einigen Reparationsleistungen in Rückstand gerät, nutzen Frankreich und Belgien Anfang 1923 die Gelegenheit zur Besetzung des Ruhrgebiets. Die Volksstimmung ist erregt, was General Ludendorff und Adolf Hitler, der Führer der zu dieser Zeit noch unbedeutenden »Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei«, im November 1923 von München aus zu nutzen versuchen. Zwar missglückt ihr Putsch innerhalb weniger Tage, jedoch hat sich zum ersten Mal eine politische Macht gezeigt, die für die Geschichte dieses Jahrhunderts verhängnisvoll werden soll. Die Inflation des Jahres 1923, die in der zweiten Jahreshälfte ihren Höhepunkt erreicht, stürzt viele Familien in große Not. Erst die Stabilisierung der Währung Ende 1923 setzt diesem Alptraum ein Ende und schafft die Voraussetzung für ein geordnetes Wirtschaftsleben, dem auch relative innenpolitische Ruhe folgt. Es sind dies die »goldenen« zwanziger Jahre, die in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts die Menschen verzaubern, bis sie der Ausbruch der Weltwirtschaftskrise im Oktober 1929 in die Arme der Nationalsozialisten zu treiben beginnt.
Als der erste allumfassende Krieg auf europäischem Boden in diesem Jahrhundert schon über 20 Jahre zurückliegt, bricht der Zweite Weltkrieg aus. Die wenigsten Kriegsteilnehmer des Ersten Weltkriegs erleben diesen Krieg ganz vorne an der Front mit. Wenn überhaupt, werden sie meist nur zu Beginn des Krieges im Feld eingesetzt beziehungsweise versehen ihren Dienst in der Miltärverwaltung.
Jugend
»Ich wurde am 20. April 1895 als fünftes Kind des Hauptzollassistenten Heinrich Hayen hier in Oldenburg geboren, besuchte die Gertrudenschule, und nach Konfirmation und Schulschluss begann ich eine Lehre als Feinmechaniker. Nach zweieinhalb Jahren habe ich diese Lehre beendet. Das war Anfang 1914. Dann kam der Krieg.« Dies ist der Auftakt meines Gesprächs mit Otto Hayen. Mehr als so einen knappen Steckbrief seiner Jugendjahre lasse ich in dem Interview nicht zu. Meine Ungeduld, etwas über Verdun zu hören, ist einfach zu groß.
Mit meiner Entscheidung im Frühjahr 1991, aus den Interviews ein Buch zu machen, gehe ich dazu über, die Interviews umfassender anzulegen. Nun beziehe ich auch Fragen zur Kindheit ein. Bald schon fällt mir auf, dass die meisten meiner Gegenüber hierüber gerne Auskunft geben. Ihre Kindheit ist ihnen gerade im Alter sehr nah. Dies ist umso bemerkenswerter, als die Gegenwart für sie nicht immer so klar zu sein scheint. Ein Celler Gesprächspartner kann mir nicht beantworten, wer der Herr in den Siebzigern auf einem Foto in seinem Bücherregal ist. Erst sein Pfleger teilt mir mit, dass es sich um seinen jüngst verstorbenen Sohn handelt. An seine Eltern aber erinnert er sich in der Abgeschiedenheit des Altenheims gut. Ich frage mich, ob es meiner Generation später einmal genauso gehen wird oder ob dies ein Zeichen für einst stärkere Familienbande ist.
Im Frühjahr 1991 treffe ich Hans Seidelmann, den ich an drei Wochenenden in Folge besuchen und zu dem ich bis ins Jahr 1998 in Kontakt stehen werde. Er sagt von sich, als junger Mensch ein Muttersöhnchen gewesen zu sein. Dazu passt seine besonders ausgeprägte Neigung, detailliert über seine Kindheit in dem kleinen Kurort Bad Kudowa zu sprechen. Es lässt sich kein friedlicheres Bild von einer Kindheit zeichnen, der einzige Sohn in einem musischen Elternhaus, die feste Gemeinschaft in diesem beschaulichen Badeort in den schlesischen Bergen. Vor dem Hintergrund der schrecklichen Ereignisse des Ersten Weltkrieges hebt sich seine Kindheit im Frieden deutlich ab. Jetzt beginne ich, mich wirklich für die biografischen Anfänge meiner Gesprächspartner zu interessieren, einerlei ob sie aus Arbeitervierteln oder aus Bürgerhäusern stammen. Hier sind meine Gegenüber für ihr späteres Leben geprägt worden. Ihr Leben hat nicht erst mit dem Kriegsausbruch begonnen. Ich erfahre eine ganze Menge über die deutsche Gesellschaft der Vorkriegszeit am Anfang des vorigen Jahrhunderts. Stück für Stück entsteht ein Gemälde der damaligen Zeit. Das Bild ist alles andere als einheitlich. Auf der einen Seite die bewusste Einengung auf althergebrachte Werte und Einrichtungen wie das Militär oder ein auf nationale Erziehung bedachtes Schulwesen. Gleichzeitig befindet sich Deutschland im Umbruch. Die Arbeiterbewegung steht längst nicht mehr in ihren Anfängen. Viele Jugendliche suchen ihren eigenen Weg. Die Technik hält in weiten Teilen des Alltags Einzug. Die ersten Pkws fahren durch die Straßen. Die Frühwerke der Luftfahrt werden bestaunt. Es entsteht eine Dynamik, die berauscht. Am Ende dieser Euphorie steht der Ausbruch des Ersten Weltkrieges.
Zeugnisse
Hans Seidelmann, geb. 1898:
Mein Vater war Reserveoffizier, selbstverständlich ganz vaterlandstreu eingestellt. Ich bin in Schlesien aufgewachsen und lebte als Kind in dem wundervollen und sehr bekannten Bad Kudowa. Es war ein ganz kleiner Ort mit wenigen Einwohnern, in dem nur im Sommer Hochbetrieb herrschte. Im Winter war es ein verschlafenes, verträumtes, entzückend in den Bergen gelegenes Örtchen. Da konzentrierte sich das Familienleben in erster Linie auf die Kunst. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen Abend in meinem Elternhaus erlebt habe, an dem nicht nach dem Abendessen meine Mutter, eine glänzende Pianistin, und mein Vater, ein begeisterter, hervorragender Sänger, Stücke von Schubert oder anderen Komponisten gespielt haben. Dies sind Erinnerungen, an denen ich noch heute in tiefer Verehrung hänge. Meine Eltern stellten einen Mittelpunkt in Bad Kudowa dar. Es gab dort vorwiegend Ärzte, das andere waren die Hausvermieter, die den ganzen Winter nichts zu tun hatten und sich fürchterlich langweilten.
Der Haltung in meinem Elternhaus entsprach es, dass mein Vater aus innerer Begeisterung in vielen Institutionen führend war. Wenn etwas los war, spielte er eine bestimmende Rolle. Wir wollen gar nicht vom 27. Januar, Kaisers Geburtstag, sprechen. Zuerst erschien der Kriegerverein mit Fahnen. Jeder, der noch eine Uniform tragen durfte, marschierte darin durch den Ort. Dann wurden Festreden gehalten. Mein Vater war immer unter den Rednern. Abends fand ein Ball oder sonst eine gesellschaftliche Veranstaltung statt, wo der Gesangsverein sang und wo auch mein Vater singen musste. In Glatz, unserer Kreisstadt, lag das Regiment 38, und die 38er hatten eine sehr gute Kapelle, die oft im Sommer in Kudowa engagiert wurde. Einmal hat meine Vater an Kaisers Geburtstag mit dieser Kapelle den Prolog des Bajazzo von Leoncavallo gesungen.
Mein Vater wollte gern, dass ich, wenn ich das Einjährige hätte, bei den Husaren dienen sollte. Als ich mit sechs Jahren in die Schule kam, stellte man fest, dass ich ein ganz schlechtes Auge hatte. Meine Mutter fuhr mit mir nach Glatz zum Augenarzt, der gleichzeitig auch die Untersuchungen fürs Militär vornahm. Er sagte meiner Mutter: »Mit einem müssen Sie sich abfinden, zum Militär kommt er nie.« Ich sage ganz ehrlich, ich war nicht unbedingt traurig darüber, denn ich bin kein Sportsmensch gewesen. Als wir dann aber nach Kudowa zurückkamen und das erzählten, war mein Vater tief unglücklich, weil ich nicht des Kaisers Rock tragen würde.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Hineingeworfen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Hineingeworfen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Hineingeworfen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.