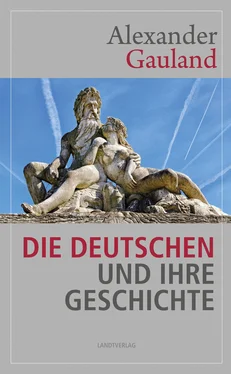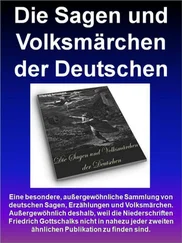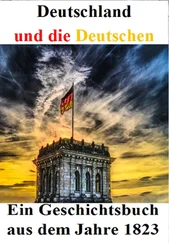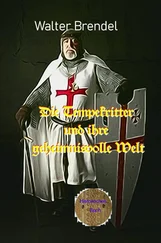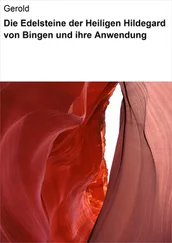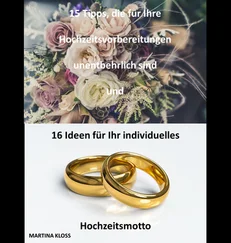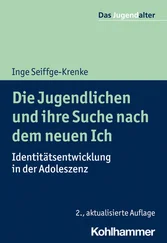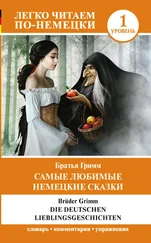Das Heilige Römische Reich umfasste an der Schwelle zur Neuzeit, also etwa um 1400, die Mitte des europäischen Kontinents. Seine eher vage Grenze erstreckte sich laut Hagen Schulze »Von Holstein die Ostseeküste entlang bis etwa zum hinterpommerschen Stolp – hier begann das Herrschaftsgebiet des souveränen und reichsunabhängigen Deutschen Ordens – zog sich dann fast genau auf derselben Linie, die nach dem Ersten Weltkrieg Deutschland und Polen trennen sollte, gen Süden, umfasste Böhmen und Mähren sowie das Herzogtum Österreich und erreichte bei Istrien das Adriatische Meer. Die Reichsgrenze sparte Venedig und sein Hinterland aus, zog sich, die Toskana umfassend, nordwestlich des Kirchenstaates quer durch Norditalien und erreichte nördlich von Civitavecchia das Tyrrhenische Meer, dem sie bei Nizza wieder nordwärts entstieg. Sie dehnte sich westlich Savoyens, der Freigrafschaft Burgund, Lothringens, Luxemburgs und der Grafschaft Hennegau und erreichte an der westlichen Schelde, zwischen Gent und Antwerpen, die Nordsee. Manche Gebiete, etwa Norditalien, Savoyen, die Freigrafschaft Burgund und die aufrührerische Schweizer Eidgenossenschaft gehörten nur noch nominell dem Reich an, andere gehörten entschieden nicht zu jenen Kerngebieten, die damals als ›teutsche Lande‹ bezeichnet wurden: In Brabant und Teilen der Herzogtümer Lothringen und Luxemburg sprach man Französisch und in den Ländern der Wenzelskrone, also in Böhmen, Mähren und Schlesien, war deutsch im wesentlichen die Sprache der Städte – das Landvolk, aber auch Teile der Stadtbevölkerung sprachen tschechisch, in Schlesien auch polnisch.«
Und in dieses explosive Völkergemisch, das weit davon entfernt war, Nationalstaat zu sein, das keine Staatsnation hatte und kein Staat war, fiel jetzt der Funke der Glaubensspaltung. Ihr Beginn sieht die Konfrontation zweier Männer, die verschiedener nicht sein konnten: des Habsburgers Karl V., seit 1519 mit dem Geld der Fugger erwählter römischdeutscher Kaiser, und des Augustiner-Mönches Martin Luther. Wenn Friedrich von Hohenstaufen der erste moderne Mensch auf dem Thron war, so Karl V. der letzte mittelalterliche Kaiser. Doch anders als bei Friedrich II., dessen wenige steinerne Porträts meist apokryph sind, besitzen wir von Karl die Bilder Tizians, die uns einen meist in schwarz gekleideten, entrückten, einsam in der Eiseskälte seiner hohen Berufung verharrenden Menschen zeigen, unbeweglich wie ein Idol, wie sein Großvater Maximilian erschreckt ausgerufen haben soll. Der Kulturhistoriker Egon Friedell, der die Habsburger nicht mochte, hat in den Bildern Tizians den Fluch dieses Geschlechts entdecken wollen, kein Herz besitzen zu dürfen. Doch es war wohl eher der Schmerz über die verlorene Einheit der Christenheit und die am Ende in seiner Abdankung gipfelnde Einsicht, dass alles umsonst war, »verlorene Siege«, wie die Erinnerungen eines deutschen Heerführers aus dem Zweiten Weltkrieg überschrieben sind.
Karl war von seiner Persönlichkeit wie von seiner Stellung her der klassische Konservative, ein verantwortungsethischer Traditionalist, unfähig zu begreifen, was in Luther vorging und was er wollte. Er hat bis zuletzt gezögert, die Reformation und den Protestantismus gewaltsam zu unterdrücken, und er hat das zugesagte freie Geleit für Luther zum und vom Reichstag in Worms gehalten, denn er wollte – wie er sagte – nicht auch schamrot werden wie sein Vorgänger Sigismund, der Jan Huß unter Bruch dieses Versprechens festnehmen und verbrennen ließ. Als bei Pavia 1524 die französische Armee vernichtet und der französische König Franz I. gefangen genommen wurde, verbot der Kaiser alle Jubelfeste, da der Sieg gegen Christen erfochten sei, und ordnete Prozessionen und Bittgottesdienste an. In vierzig Druckzeilen hat Karl V. den deutschen Ständen auf dem Reichstag in Worms sein Credo verkündet: Verteidigung des katholischen Glaubens, der geheiligten Zeremonien und heiligen Bräuche, wie es seine Vorgänger gehalten haben, »vivre et mourir à leur exemple«. Reformen ja, aber nur im wörtlichen Sinn als Rückführung auf die geheiligten Bräuche.
Auf der anderen Seite dieser welthistorischen Auseinandersetzung finden wir einen mittelalterlichen Mönch, keinen gebildeten Humanisten wie Erasmus, keinen geschmeidigen Diplomaten wie den päpstlichen Legaten Cajetan, sondern einen frommen Bauern, den nur eine Frage umtreibt: Wie gewinne ich einen gnädigen Gott, wie finde ich Erlösung und Seelenheil? und der es wörtlich meint mit dem biblischen »Was hülfe es mir, wenn ich die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an meiner Seele?« Das Reich, die Türkengefahr, die Franzosen, Habsburg, die Wirkung seiner Lehre auf den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft – all das ist Luther gleichgültig, denn Politik interessiert ihn nicht, und Geschichte ist ihm unwichtig. Als die Bauern unter Hinweis auf ihn und seine Lehre politische und soziale Forderungen stellen, also die urchristliche Botschaft beim Wort nehmen, antwortet er mit seiner Schrift »Wider die räuberischen und mörderischen Bauern« und fordert, »dass sie erwürgt werden, wie tolle Hunde« – ein erstaunlicher Mangel an Empathie wie an geschichtlichem Verständnis.
Im Jahre 1511 reist Luther über Oberitalien nach Rom, doch er findet kein einziges Lobeswort für die Schönheit der Kunstwerke oder die Ehrwürdigkeit der antiken Bauten. Am Kölner Dom und am Ulmer Münster interessiert ihn ausschließlich die schlechte Akustik und am Rom der Päpste das darin verbaute Geld aus Deutschland. In der Persönlichkeit Luthers manifestiert sich schon, was später den Protestantismus ausmacht – das Wort und die Musik. Es fehlen der Sinn für Schönheit und Anmut, was Nietzsche zu dem Verdikt veranlasste: »Die Deutschen haben Europa um die letzte große Kulturernte gebracht, die es für Europa heimzubringen gab – die Renaissance«, und Gottfried Benn ähnlich hart urteilen ließ: »Die Reformation, das heißt das Niederziehen des 15. Jahrhunderts, dieses riesigen Ansatzes von Genialität in Malerei und Plastik zugunsten düsterer Tölpelvisionen – ein niedersächsisches Kränzchen von Luther bis Löns! Protestant, – aber Protest immer nur gegen die hohen Dinge.«
Das lutherische Aufbegehren ist reinste Gesinnungsethik, die Folgen für die Welt und das Reich interessieren ihn nicht: »Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde – denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, da es am Tag ist, dass sie des öfteren geirrt und sich selbst widersprochen haben –, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wider das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir, Amen!«
Luther, so sieht es Egon Friedell, »war in seiner seelischen Grundstruktur noch eine durchaus mittelalterliche Erscheinung. Seine ganze Gestalt hat etwas imposant einheitliches, hieratisches, steinernes, gebundenes, sie erinnert in ihrer scharfen und starren Profilierung an eine gotische Bildsäule. Sein Wollen war von einer genialen dogmatischen Einseitigkeit, schematisch und gradlinig, sein Denken triebhaft, affektbetont, im Gefühl verankert: Er dachte gewissermaßen in fixen Ideen. Er blieb verschont von dem Fluch und der Begnadung des modernen Menschen, die Dinge von allen Seiten, sozusagen mit Facettenaugen betrachten zu müssen«.
Er ähnelte dem Kaiser mehr, als er wusste: Auch er wollte zurück zur mittelalterlichen Frömmigkeit und der Entartung und Verweltlichung ein Ende bereiten, auch er bezweifelte den seichten Optimismus der Humanisten und sah in den irdischen Dingen den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse, nur war sein Wirken revolutionär, wo das des Kaisers konservativ war. Und noch etwas trennte ihn vom Kaiser: »Die menschlichen Dinge bedeuten ihm mehr als die göttlichen« hat er über Erasmus gesagt, was als Tadel gemeint war; über den Kaiser gesprochen, ist es ein Lob. Denn Luthers Unbedingtheit, sein »Hier stehe ich, ich kann nicht anders« vererbte sich weiter in der deutschen Geschichte und hatte Folgen, die ein kluger Beobachter der deutschen Dinge in den Satz kleidete: »Das deutsche Volk nimmt die ideellen Dinge nicht als Fahne wie andere Völker, sondern um einige Grade wörtlicher als sie und die realen um ebensoviel zu leichtsinnig«; oder wie Goethe es in Dichtung und Wahrheit formulierte: »Uns war es darum zu tun, den Menschen kennen zu lernen; die Menschen überhaupt ließen wir gerne gewähren«.
Читать дальше