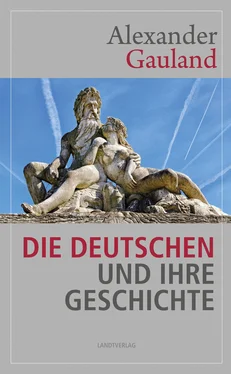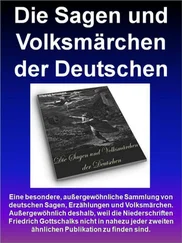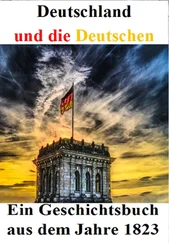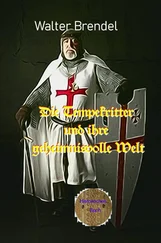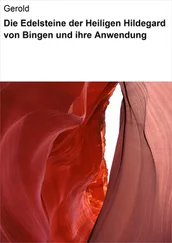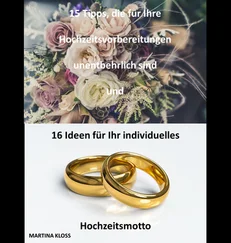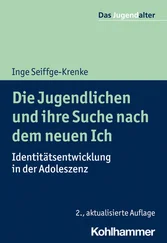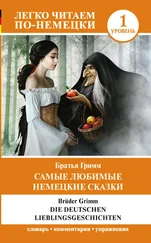Am besten illustriert wohl eine Anekdote des Kaisers Weltsicht. »Der Kaiser Friedrich ging einmal auf die Falkenjagd, und er hatte einen ganz ausgezeichneten Falken, den er mehr als eine Stadt schätzte. Er ließ ihn auf einen Kranich los; der aber stieg hoch. Der Falke flog noch viel höher als er. Er sah unter sich einen jungen Adler. Er stieß auf ihn, dass er zu Boden stürzte, und hielt ihn so lange, bis er tot war. Der Kaiser lief hin in der Meinung, es sei ein Kranich; er fand wie es war. Da rief er zornig seinen Scharfrichter herbei und befahl ihm, dem Falken den Kopf abzuhauen, weil er seinen Herren getötet habe.«
Was in den grausamen Kämpfen mit Papsttum und Städten matt zu werden begann, der Glanz der kaiserlichen Persönlichkeit, bewährte sich noch einmal auf dem Kreuzzug, den er als Gebannter unternahm. Durch einen zehnjährigen Vertrag erhielt das Abendland Jerusalem zurück, mit Ausnahme des heiligen Bereiches von Omar-Moschee, Felsendom und Tempel Salomos. Ohne einen Schwertstreich, allein aufgrund seiner Persönlichkeit, gewann der Kaiser, was noch keiner vor ihm erreicht hatte. Dass der Papst dem Sultan eine Möglichkeit eröffnete, den Kaiser zu fangen und zu töten, belegt den abgrundtiefen Hass der Kirche auf den Erfolg des Staufers. Dass der Sultan diese Chance verschmähte und den Kaiser davon in Kenntnis setzte, zeigt eine andere Welt des Islam, an die wir uns gelegentlich erinnern sollten. Kein Wunder, dass der Kaiser nach dieser Erfahrung an die Könige und Fürsten Europas schrieb: »Lange genug war ich Amboss, jetzt will ich Hammer sein.«
Das Schicksal ist grausam zu den aus lichten Höhen herabstürzenden Staufern. Der Kaiser muss noch erleben, wie sein Lieblingssohn Enzio gefangen genommen wird. 23 Jahre wird er hinter Kerkermauern verbringen und dort den grauenhaften Untergang des staufischen Hauses durchleben: Der Kaiser stirbt 1250, König Manfred verliert die Krone Siziliens und 1266 in der Schlacht bei Benevent das Leben; zwei Jahre später wird der letzte Staufer, Konradin, auf dem Marktplatz von Neapel enthauptet. Nichts bleibt als der Spruch, mit dem das Volk von Palermo einst dem Dreijährigen bei der ersten Krönung zugejubelt hatte: »Christ ist Sieger, Christ ist König, Christ ist Kaiser« und der geometrische Traum von Castel del Monte, seinem persönlichen Sanssouci, halb Morgenland, halb Abendland. In Deutschland beginnt die kaiserlose, die schreckliche Zeit. In Italien dämmert die Morgenröte der Renaissance herauf.
650 Jahre später erscheint in Deutschland ein Roman, in dem der jüdische Schriftsteller Leo Perutz beschreibt, wie ein alter Baron mit Hilfe eines Rauschmittels einen durch die Jahrhunderte verborgen gebliebenen Nachfahren des Kaisers auf den Thron führen will. Doch die Bauern rufen nicht »Hosianna«, sondern »Kreuziget ihn« und zünden das Gutshaus an. Wenige Tage später wird Adolf Hitler Reichskanzler und das Buch verbrannt. Wer von den Bewunderern des Kaisers auf eine echte Erneuerung eines tausendjährigen Reiches gehofft hatte wie der Dichter Stefan George, erlebt den Triumph des Verbrechens. Zehn Jahre später wird Stauffenberg den vergeblichen Versuch machen, das Ideal des Bamberger Reiters durch die Tötung des Tyrannen zu erneuern. Noch einmal, ein letztes Mal, erhellt hier der staufische Zauber die deutsche Geschichte.
Der antirömische Protest 1 – Luther gegen Karl V .
Als die Kurfürsten nach dem Interregnum 1273 einstimmig den schwächsten der Vasallen Friedrichs, den Grafen von Habsburg, zum deutschen König wählen, ist das wie ein Atemholen. Das Reichsgut ist verschleudert, Italien und Burgund sind verloren und die Mitte des Kontinents ist inzwischen wirtschaftlich und kulturell hinter dem Westen, also England, Frankreich, Kastilien und Portugal, zurückgeblieben. Das Fehlen einer Hauptstadt und archaische Verwaltungsstrukturen behindern die weitere Entwicklung. Grundlage des Wohlstandes ist noch immer das Land, auch wenn die Bauern nur wenig davon besitzen. Drei Stände machen die Gesellschaft aus, Pfaffen, Ritter und Bauern, oder wie es in einem bischöflichen Mahnschreiben heißt: »Dreigeteilt ist das Haus Gottes, das man als Einheit glaubt: Die einen beten, die anderen kämpfen und andere arbeiten. Diese drei sind vereint und leiden keine Spaltung.« Das Schwert soll den Landmann schützen, doch es beginnt, ihn zu knechten. Die alte Ordnung reicht nicht mehr hin. Handel und städtisches Bürgertum beanspruchen ihren Platz, und die Hanse, ein Städte- und Kaufmannsbündnis, füllt das Machtvakuum, das der Untergang der Staufer hinterlassen hat. Ihr Schwerpunkt liegt im Norden und Osten, eben da, wo die kaiserliche Gewalt am schwächsten ist. Ihre Macht zehrt am Reich.
Rudolf I. wendet Aufmerksamkeit und Kraft notgedrungen vom italienischen Süden ab und dem Südosten des Reiches zu. So gewinnt er in der Auseinandersetzung mit König Ottokar von Böhmen Österreich und die Steiermark, und seine Nachfolger erringen auch das böhmische Kernland. Italien entrückt dem Reich noch mehr, nachdem mit der Schweizer Eidgenossenschaft ein neuer Riegel zwischen den Reichsteilen entsteht. Noch ist die Krone nicht bei den Habsburgern quasi erblich, und so wechseln in den nächsten zweihundert Jahren die Dynastien. Den Habsburger Kaisern folgen Luxemburger Kaiser, unterbrochen von einem Nassauer und einem Bayern, der das letzte Mal den Versuch unternimmt, mit Romzug und eiserner Langobardenkrone das staufische Erbe anzutreten und die Ghibellinen, die Parteigänger des Kaisers, in den oberitalienischen Städten zu stärken.
Doch das bleibt Romantik, ohne realpolitische Substanz. Die Zukunft des Reiches liegt diesseits der Alpen, im Südosten und im Osten, wo die noch von den Staufern privilegierten Deutschordensritter das spätere Preußen gründen. Und auch im Westen gelingt den Habsburgern und Luxemburgern die Ausbreitung ihrer Territorialmacht am Oberlauf von Rhein, Neckar und Donau. Das erste Mal entsteht auch so etwas wie eine Hauptstadt in Prag, wo Karl IV. 1348 die erste deutsche Universität gründet.
Aber schon wetterleuchtet am Horizont eine neue Spaltung der abendländischen Christenheit. In den Hussitenkriegen, die nach der Verbrennung des Ketzers Jan Huß ausbrechen, beginnen die späteren Schrecken des Dreißigjährigen Krieges schon Gestalt anzunehmen. Es ist in erster Linie ein Religionskrieg, aber auch eine nationale Auseinandersetzung zwischen Tschechen und Deutschen. Der letzte in Rom vom Papst gekrönte Kaiser, Friedrich III., legt durch seine Heiratspolitik schließlich die Grundlagen der neuen spanischdeutschen Weltmonarchie. In seiner langen, von 1440 bis 1493 dauernden Regierungszeit handelte er nach dem später zum geflügelten Wort werdenden Motto: Andere führen Kriege, du aber, glückliches Österreich, heiratest.
Auch die Verfassung des von nun an »Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation« gewinnt in diesen Jahren feste Gestalt. Die 1356 als Reichsgrundgesetz erlassene Goldene Bulle regelt die Königswahl durch die drei geistlichen Kurfürsten (Mainz, Trier und Köln) und die vier weltlichen, den König von Böhmen, den Pfalzgrafen und die Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen. Die Wahl soll künftig immer in Frankfurt, die Krönung in Aachen erfolgen. So ist das Reich ohne die Hausmacht seiner regierenden Kaiser zwar kaum noch Machtfaktor, aber immer noch Friedensordnung. Noch ist nicht entschieden, ob am Ende eine neue Staatlichkeit oder der Zerfall stehen werden. Diese Frage entschied erst die Reformation zugunsten des Zerfalls. Doch zuvor versuchte ausgerechnet ein mittelalterlicher Kaiser, der letzte Ritter, der Habsburger Maximilian, das Reich zu reformieren und ihm neue innere Festigkeit zu geben. Noch war es nicht zu einem rein metaphysischen Körper verkümmert, und die Einführung eines zentralen Reichsregiments als Exekutive der Reichsstände hätte sein Schicksal wenden können. Ein ewiger Landfriede, die Errichtung des Reichskammergerichts und die Einteilung in zehn Reichskreise zum Zwecke der Reichsverteidigung waren ein Anfang, um die monarchia universalis zu modernisieren, doch auch hier war die Kirchenspaltung mehr Abbruch als Aufbruch.
Читать дальше