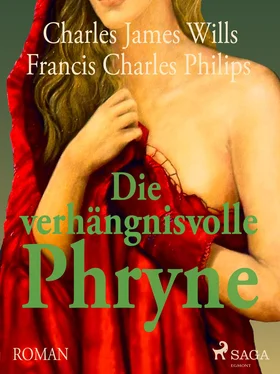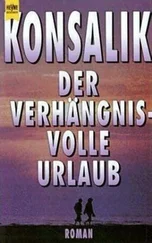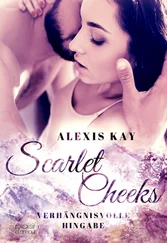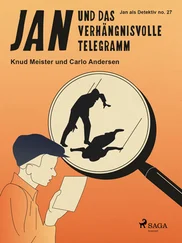Nicht einmal die Cigarette hatte der Elende ausgehen lassen.
„Wie es Ihnen beliebt,“ sagte die Dame enttäuscht, und als der junge Mann sie nun zu ihrem Sitz zurückführte, sah sie mehr wie eine Niobe aus, als je zuvor.
Ruhig ordnete — oder richtiger, verwirrte — der Maler noch einmal das üppige Haar und zog sich dann wieder hinter seine grosse Leinwand zurück.
„Der Elende!“ sagte die Witwe bei sich, „der kalte, fischblütige, unbeholfne Tropf! Wie verschieden, wie so ganz anders würde sich der selige Pichon unter solchen Umständen benommen haben.“ Und ihre Gedanken wanderten unwillkürlich nach dem grossen Marmordenkmal auf dem Père-la-chaise, und zwei Thränen wirklichen Schmerzes — oder Aergers erschienen zwischen den langen seidnen Wimpern, welche die lieblichen Augen beschatteten.
Ja, George Leigh war augenscheinlich, was die Franzosen einen „Joseph“ nennen, ein herzloser, boshafter Joseph der schlimmsten Sorte.
„Mache ich Ihnen nicht sehr viel Mühe?“ fragte die verliebte Witwe nach einer langen Pause.
„Mühe, liebe Madame? Nein, wahrhaftig nicht! Sie sind das beste Modell, das man sich wünschen kann. In der Regel schwätzen die Modelle, und Sie haben gewiss seit zehn Minuten kein Wort gesprochen. Und dabei schwätzen sie meist Unsinn — und was für Unsinn! Wollen Sie so freundlich sein, das Kinn etwas zu heben, ich möchte versuchen, ob ich nicht den Lichtschimmer auf dem Haar festhalten kann.“
„Ah,“ dachte Niobe, als sie that, wie er gebeten, „an das Bild denkt er, nicht an mich. Ich glaube wahrhaftig, er betrachtet mich nur als eine Art lebendiger Gliederpuppe.“ Und sie warf einen feindseligen Blick nach der lebensgrossen Gelenkfigur von Papiermaché, die, als Niobe fertig drapiert, in einer Ecke des Ateliers stand. „Und was werden Sie mit mir anfangen, wenn ich vollendet bin, Monsieur Leigh?“ fragte sie nicht ohne Spannung.
„O, ich werde Sie nach dem ‚Salon‘ schicken,“ erwiderte der Maler in ruhigem, befriedigtem Ton.
„Und mich verkaufen?“ sagte die Witwe feierlich.
„Du lieber Himmel, nein,“ entgegnete der Künstler und betrachtete sein Werk mit halbgeschlossenen Augen. „Ich habe Sie schon lange verkauft. Israels nimmt alle meine Bilder.“
Die Witwe seufzte leise, aber dieser Seufzer ging an den Ohren des Enthusiasten vor der Staffelei ungehört vorüber.
Und wieder herrschte tiefes Schweigen.
Das war wirklich herzlose Undankbarkeit! Darum also hatte die schöne Frau Pichon so viele tödlich lange Stunden gesessen, als ob sie versteinert wäre, nur damit ihre lieblichen Züge von einem geldgierigen Fremden wiedergegeben und für die schmutzigen Banknoten eines filzigen Handelsjuden verschachert würden? Nein! Fleisch und Blut vermochten das nicht zu ertragen. Und die hübsche Frau Pichon, die unzweifelhaft von Fleisch und Blut war, sprang entrüstet auf.
„Ich fühle mich nicht ganz wohl, Monsieur Leigh,“ sagte sie mit Thränen in der Stimme. „Es gibt Augenblicke, in denen die Erinnerung an meinen lieben armen Pichon und der Gedanke an das, was ich mit ihm, dem von mir geschiedenen Engel, verloren habe, mich überwältigt. Sie müssen mich jetzt entschuldigen,“ fügte sie hastig hinzu, während sie ihre kastanienbraunen Flechten vor Leighs grossem venetianischen Spiegel sorgfältig wieder ordnete. Es waren zornige Augen, deren Glanz das Glas zurückwarf!
„Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, liebe Madame,“ sagte der Maler.
„Sprechen Sie jetzt nicht mit mir, Monsieur Leigh,“ rief sie, ihn mit einer ungeduldigen Handbewegung abwehrend; „mein Herz ist zu voll.“ Mit diesen Worten schoss die ergrimmte Witwe aus dem Zimmer und schmetterte die Thür ins Schloss, wie sie noch niemals zugeworfen worden war.
„Weiber sind doch sonderbare Geschöpfe,“ murmelte Leigh für sich, während er fortfuhr, nach der Erinnerung Lichter und Schatten in dem Haar aufzusetzen. „Sie muss Monsieur Pichon aber doch innig geliebt haben, das arme Kind.“ Und dann fing er an zu pfeifen:
„Je suis le mari de la reine —
Ri de la reine, ri de la reine.“
Wir alle kennen Banquerouteville-sur-Mer. In der guten alten Zeit, als die Gerichtsvollzieher noch schöne Tage hatten und englische Verschwender noch beständig ins Gefängnis wandern wussten, war Banquerouteville-sur-Mer der viel ersehnte Hafen der Ruhe für Schuldner, die nicht bezahlen konnten oder wollten. Banquerouteville ist ein heiterer und billiger Ort, fünfundzwanzig Franken gehen aufs Pfund und ein Frank ist dort jeden Tag so viel wert, als ein Schilling, oder eigentlich noch mehr.
Der gewöhnliche Grund, den Engländer für einen längern Aufenthalt in Banquerouteville geltend machen, sind die Vorteile, die es in Bezug auf Erziehung und Unterricht bietet, und es gibt in der That dort beinahe so viel Schulen, wie Hotels und Pensionen. Ueber die gute Beschaffenheit der Luft kann kein Zweifel bestehen, die Umgebung ist reizend, die Bäder herrlich und die Miete gering.
Etwa eine Meile von der Stadt entfernt liegt das Château des Tourterelles. Es erfreut sich dieses Namens seit mindestens hundertundfünfzig Jahren, und wenn auch boshafte Menschen darüber spotteten und allerhand schlechte Witze über das Zusammentreffen machten, so war es doch ein rein zufälliger Umstand, dass das Château des Tourterelles das war, was wir in zweifelhaftem Deutsch ein Mädchenpensionat nennen würden. Frau Pouilly, die Vorsteherin, war eine ausserordentlich kluge Dame, und wenn es jemals eine gegeben hat, eine Frau von Welt. Sie hatte das Geschäft vor vielen Jahren für eine schöne runde Summe gekauft und hatte von vornherein verstanden, es so zu leiten, dass es sich bezahlt machte. Sie liess ihre jungen Mädchen nicht hungern und sie strengte sie nicht allzu sehr an, aber sie legte den Hauptnachdruck darauf, dass die Artikel, welche durch ihre Erziehungsfabrik gegangen waren, wenigstens dem äussern Eindruck nach, als wohlerzogene junge Damen mit den höchsten Grundsätzen daraus hervorkamen. Hatte sie das Missgeschick, dass ihr ein wirkliches schwarzes Schaf in die Hände geriet, so zögerte Frau Pouilly nicht einen Augenblick; die Missethäterin wurde aus dem Himmel des Château des Tourterelles in die tiefe Finsternis ausserhalb seiner kleinen Welt gestossen.
Es war ein sehr geschäftiger Tag. Der Schulsaal war gefegt und geschmückt worden; dreihundert Rohrstühle, alle sorgfältig numeriert und in Reihen gestellt, waren von dreihundert Verwandten und Freunden der Frau Pouilly und ihrer Schülerinnen besetzt. Die Professoren (in Frankreich werden alle Lehrer Professor genannt, es kostet nichts und klingt ganz hübsch), in einen Halbkreis geordnet, boten einen ehrfurchtgebietenden Anblick dar — es war ihrer ein rundes Dutzend — und sie sahen, für diesen Tag wenigstens, wie zwölf Akademiker aus. Sie alle trugen die vorschriftsmässige weisse Halsbinde, die bei Franzosen das Zeichen eines ernsten Vorgangs ist. Und in Madames Erscheinung lag etwas überaus Erhabenes. Ihr reiches Kleid von schwerer schwarzer Seide, dessen Steifigkeit besser durch einen Vergleich mit einer Panzerplatte, als durch den sonst üblichen mit einem Brett beschrieben werden müsste, flösste dem männlichen Teil der Zuhörer unverkennbar Furcht und Achtung, den Damen unverhüllten Neid ein. Was von Madames Kleid ausging, das war kein sanftes Frou-frou, — nein, das war ein förmliches Krachen.
Der Pfarrer von der Domkirche führte den Vorsitz. Die achtzig jungen Damen waren Bilder der Gesundheit und der Freude, denn die Feier galt der öffentlichen Preisverteilung, und nach ihrem Schluss begannen die grossen Sommerferien für die Anstalt der Frau Pouilly.
Die jungen Damen sangen, spielten Chopin, deklamierten Racine, und bei jeder Leistung wurde der diskrete Beifall der Zuhörer etwas lauter. Hierauf verteilte der alte Geistliche die Preise und beschloss diesen Teil seiner Aufgabe damit, dass er Frau Pouillys ältester und hübschester Schülerin als Preis für allgemeines Wohlverhalten und stetige und erhebliche Fortschritte einen Lorbeerkranz aufs Haupt drückte. Wir würden diesen letzten Teil der Feierlichkeit für unglaublich lächerlich halten, in Frankreich denkt man anders, und der Schüler oder die Schülerin, welche so glücklich sind, mit dem Kranz geschmückt zu werden, sind auf dieses einfache Siegeszeichen ebenso stolz, als die erfolgreichen Ringkämpfer bei den olympischen Spielen des Altertums es waren. Als die Feierlichkeit vorüber war, verliessen die Zuhörer langsam den Saal, die Professoren verbeugten sich gegen ihre Schülerinnen und die Gäste, und dann wurden die jungen Damen sich selbst überlassen.
Читать дальше