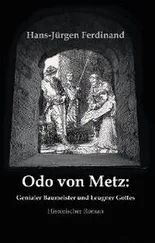Hans-Caspar von Zobeltitz
Bea, beate und Be
Drei Generationen
Roman
Saga
In der Sommeschlacht 1916 fiel der Generalleutnant Cornelius. Eine Maschinengewehrkugel traf ihn, als er in der vordersten Linie der Infanterie seiner Division eine Erkundung vornahm. Die Nachricht von seinem Tode verbreitete sich schnell über alle Haupt- und Stabsquartiere der Westfront und löste ein stolzes Bedauern aus. Generalleutnant Cornelius war in der Armee ein bekannter Mann gewesen, ein hervorragender Soldat, bei Vorgesetzten und Untergebenen gleich beliebt, nur vielleicht etwas zu weich zum eigentlichen Führer. Kameraden, die ihn persönlich näher kannten, schoben diese Weichheit auf seine häuslichen Verhältnisse. Er hatte ziemlich spät wohlhabend geheiratet und stand, wie man sich lächelnd erzählte, stark unter dem Pantoffel. Er hatte seine Frau stets über die Massen verwöhnt, und es liefen Anekdoten um, die ihn bei Einkäufen für den Haushalt und mit dem Staubwedel in der Hand schilderten. Diese Geschichten wurden auch jetzt mit leisen Stimmen wieder aufgefrischt, man entsann sich bei ihnen aber auch voll Beileids der Frau, die jetzt einsam und wohl recht hilflos, führerlos dastand. Man sandte ihr, auch aus dem Grossen Hauptquartier in Charleville, Telegramme, und ein Vertreter des Kaisers war bei der Beisetzung zugegen, die nach der Überführung in Berlin stattfand.
Dass sie in Berlin stattfand, war für alle Eingeweihten ein Zeichen dafür, dass die Witwe nun zu ihrer einzigen Tochter ziehen würde, die mit einem Arzt, dem Doktor Karl Bürgler, verheiratet war. Auch über diese Ehe wurde allerlei berichtet. Sie war eigentlich gegen den Willen der Mutter zustande gekommen, der ein Sanitätsoffizier nicht hoch genug in Rang und Ansehen für ihre Tochter erschienen war; hier sollte aber der General ein Machtwort gesprochen haben, vielleicht das einzige zwischen seiner grünen und silbernen Hochzeit. Doktor Bürgler, der zwei Jahre vor dem Kriege seinen Abschied aus dem aktiven Dienst genommen und sich als Facharzt für Lungenleiden in Berlin niedergelassen hatte, war bei der Beisetzung seines Schwiegervaters nicht anwesend. Man war darüber nicht verwundert, denn man wusste, dass er als Chefarzt eines Feldlazarettes an der Westfront in diesen Grosskampfzeiten unabkömmlich war.
Es waren trübe und ernste Tage, als Frau Beate Cornelius in das Bürglersche Haus in der Königsmarckstrasse in Berlin-Dahlem einzog. Der Krieg lastete nun doppelt schwer auf ihr. Sie fühlte sich nicht in der Lage, den eigenen Haushalt in Kassel, der letzten Garnisonstadt ihres Mannes, selbst aufzulösen, sie überliess dies ihrer Tochter, während sie sich im Fremdenzimmer der Villa einkapselte, sich hierher auch die Mahlzeiten erbat und nur ein menschliches Wesen um sich duldete, ihre dreijährige Enkelin Be. Als dies Kind im Spätherbst 1913 geboren worden war, hatte es nicht einen Augenblick für die Mutter einen Zweifel gegeben, dass es den Vornamen Beate bekommen musste, an dem seine Grossmutter so hing und den sie auch selbst trug.
Beate Bürgler fand in Kassel ungewohnte Arbeit vor. Die elterliche Wohnung war gross und vollgesteckt mit Möbeln. Sie wusste sich kaum Rat, wo sie mit den vielen Sachen bleiben sollte, besonders mit den Stücken, von denen sie annehmen musste, dass die Mutter besonders eng mit ihnen verbunden war und die sie jetzt in ihrer Trauer ständig vermissen würde. Schliesslich gab sie in dem Gefühl, dass es ihre Pflicht sei, der Mutter erst einmal wieder die gewohnte Umgebung zu schaffen, den Auftrag, das Arbeitszimmer des Vaters, das Wohnzimmer der Mutter und Teile der Einrichtung von Schlaf- und Ankleidezimmer nach Berlin zu verladen, während der Rest an Möbeln, Bildern, Teppichen, Geschirr und so weiter in Kassel eingespeichert wurde. In Dahlem aber liess sie im Erdgeschoss das Sprech-, das Ordinationszimmer und die daneben gelegene Bücherei ihres Mannes ausräumen und deren Inhalt auf den glücklicherweise grossen Boden des Hauses schaffen, so dass Platz für eine abgeschlossene Zimmerflucht wurde, die sie nun der trauernden Mutter zur Verfügung stellen konnte.
Bea Cornelius nahm von diesen Räumen fast unbewusst Besitz, und als sie in den ersten Monaten noch dieses oder jenes vermisste, fuhr Beate wiederum nach Kassel, um auf dem Speicher herauszusuchen, was der Mutter fehlte. Es ging der Tochter nicht anders, als es ihrem Vater gegangen war: sie beugte sich dem Willen und den Wünschen Beas, obgleich Wille wie Wünsche eigentlich nie geäussert wurden. Sie trat langsam die eigentliche Herrschaft in ihrem eigenen Hause ab und widersprach nie, wenn das Dienstmädchen oder das Kinderfräulein berichteten: Ihre Exzellenz hätten dieses oder jenes so oder so angeordnet. Ängstlich war sie auch um das leibliche Wohl der Mutter besorgt, sie suchte und fand Schleichwege, auf denen sie in dieser Zeit schweren Mangels an Nahrungsmitteln Fleisch, Butter, Kaffee und anderes heranholte. Es war ja Geld genug vorhanden, um auch Überpreise zu bezahlen: die Zinsen aus Beas erheblichen Vermögenswerten und aus dem, was Beate als Heiratsgut mitbekommen hatte, liefen pünktlich auf den Bankkonten ein, die Post brachte zu jedem Monatsersten die stattliche Pension, die Bea als Generalswitwe erhielt, und die Summe, die Karl Bürgler seiner Frau von seiner Feldbesoldung anweisen liess. Ja, trotzdem Beate nicht sparte, sammelten sich auf der Bank Überschüsse an, die sie in Kriegsanleihe anlegte, denn Bea überliess ihr die Vermögensverwaltung. „Du wirst das schon richtig machen, Kind, und die Herren auf der Bank sind ja zuverlässig. Ich verstehe von diesen Dingen nichts. Das hat immer dein guter Vater für mich erledigt.“
Alle diese Dinge erforderten aber Zeit; allein die Wege, die zurückzulegen waren, kosteten Stunden, denn die Verkehrsmittel waren im Kriegsnotstand eingeschränkt und die Droschken verschwunden. So kam Beate, die vor dem Einzug Beas still als Kriegsfrau vor sich hingelebt hatte, in eine Hetze des täglichen Lebens hinein, die sich noch dadurch verstärkte, dass sie die Pflichten, die sie in einer Leichtverwundetenküche und in einer Büchersammelstelle übernommen hatte, nicht aufgeben wollte. Sie bemerkte gar nicht, dass dabei eines an Mutterfürsorge und Mutterliebe zu kurz kam: Be, ihr Kind.
Und sie beging — jung und eigentlich noch recht töricht, wie sie war — einen grossen Fehler: aus einer gewissen Scheu schrieb sie ihrem Manne nicht, welche Veränderungen sie im Hause hatte vornehmen lassen. Sie schob diesen Brief von einer Woche auf die andere, von einem Monat auf den anderen, sie sagte: weshalb soll ich ihn bei seiner schweren Arbeit draussen aufregen, ich teile es ihm mit, wenn er mir einen Urlaub ankündet, dann erfährt er es noch früh genug; es ist ja auch alles nur vorübergehend, er braucht die Räume jetzt nicht; und wenn der Krieg vorbei ist, muss sich Bea doch ein eigenes Heim suchen.
Ein trübes Kriegschristfest ging vorüber. Das Frühjahr 1917 kam und mit ihm Beates Geburtstag, ihr fünfundzwanzigster. Und am frühen Morgen dieses Tages war Karl plötzlich da, stand vor Beate, nahm sie in den Arm, küsste sie. „Ich hab’ mich freimachen können, Lieb, auf eine knappe Woche, zu deinem Geburtstag, zu deinem fünfundzwanzigsten Geburtstag.“ Draussen strahlte der Mai, und der Mann, ganz von Urlaubsstimmung ergriffen, war gleich die Treppe herauf in Beates Schlafzimmer gestürzt, sass nun auf ihrem Bettrand, fuhr ihr durchs wirre dunkle Haar, lachte. „Liebhaben will ich dich, liebhaben, du.“ Dann sprang er auf. „Wo ist Be? wo ist mein Mädel?“ Ins Kinderzimmer lief er, jauchzte und schrie, und das Kind jauchzte und schrie auch. Beate aber hockte erschreckt und bewegungslos in ihren Kissen. Denkt er denn gar nicht daran, dass wir Trauer im Hause haben? Und dann überfiel es sie heiss: Seine Zimmer, um Gotteswillen, seine Zimmer. Sie sprang auf, warf sich ihren Schlafrock über, hastete ihm nach. „Sei doch nicht so laut, Karl, Bea schläft doch noch.“ Er hatte das Kind spielerisch hochgehoben, nun setzte er es nieder. Ein Schatten fiel auf sein frohes Gesicht. „Ach so — richtig — Mama.“ — Aus den Tagen, die ihm die Heimat schenken sollten, die er sich von Liebe und Entspannung erfüllt ausgemalt hatte, wurden trübe Stunden, voll ewigen Rücksichtnehmen-Müssens. Er sagte kein Wort, dass man ihn aus seinem eigensten Reich verdrängt, aber er bat: „Lass uns irgendwohin fahren, Beate, für die paar jämmerlich kurzen Tage, die uns geschenkt sind, und wenn es nur nach Potsdam ist.“ Aber sie meinte: „Ich kann doch Bea nicht allein lassen.“ Er wurde ernst: „Denk doch daran, dass ich wieder hinausgehe, es kann doch das letztemal sein ...“ Sie weinte auf. „Sag so etwas nicht, ich flehe dich an, sag so etwas nicht“, um dann doch zu enden: „Ich kann nicht fort. Du musst das verstehen. Beas Trauer ist noch zu frisch, sie würde nicht begreifen, dass wir froh sein können.“
Читать дальше