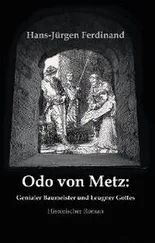Oben in ihrem Zimmer hielt Sophus, als sie eintrat, eine ihrer Modepuppen, die sie immer noch mit Flicken benähte und besteckte, in der Hand. „Hast du das gemacht?“ fragte er. Sie nickte. „Ich habe noch mehr von dem Zeug. Es ist so eine Kinderei von mir.“ — „Zeig’ doch mal her.“ — Rot wurde sie, denn sie schämte sich ihrer Puppenwirtschaft, aber er nahm die Sache ernst. „Machst du dir deine Kleider auch selber?“ — „Natürlich, die Schneiderinnen können doch alle nichts.“ — „Zeichnest du dir vorher Entwürfe?“ — „Nein, zeichnen kann ich nicht. Ich muss Stoff in der Hand haben, weisst du. Ich sehe die Kleider gleich plastisch. Farben ausdenken fällt mir schwer, aber wenn ich sie nebeneinander vor mir habe, dann kann ich sie abstimmen.“ Er hatte die Staffelei zurechtgestellt, die Kohle in die Hand genommen und setzte die ersten Striche auf die Leinwand. Sie sass im vollen Licht am Fenster. „Gut hast du das Tuch umgelegt“, sagte er noch, dann wurde er still.
Er sah sie an und sie ihn. Ihr Ausdruck wurde immer ernster, denn sie fühlte, dass er nicht einfach leicht etwas hinschluderte, sondern arbeitete. Das übertrug sich auf sie. Auf seiner Stirn erschien eine senkrechte, steile Falte, und da krauste sie auch die Stirn. Er trat zur Seite. „So geht es nicht. Du wirst mir müde. Dein Gesicht wird leer und langweilig. Aber ich kann nicht reden beim Malen, kann dich nicht unterhalten. Du müsstest etwas tun, was dich ablenkt. Zieh eine von deinen Puppen an, das wäre das beste.“ Sie hatte einen Vorrat von Stoffresten da, holte sich Nadeln und Schere, stellte einen Tisch neben sich. So fasste er sie neu, halb im Profil mit gesenktem Kopf.
Als es zu dunkeln begann und er aufhören wollte, kam Bea. Er, von Hause sehr wohlerzogen, sehr gewandt, küsste ihr die Hand. Sie sah ihn prüfend an, warf auch einen Blick auf die Leinwand, nickte, ohne zu urteilen, fragte ihn dann nach seiner Familie. Sie wusste unter den Seebergs Bescheid. Hier war er ablehnend. „Was soll ich mit dem Adel?“ sagte er, „als Sophus von Seeberg hungert’s sich nur schwerer.“ — „Immer langsam“, erwiderte sie sehr ruhig, „ihr Jungen sollt so etwas nicht einfach über Bord werfen, sollt lieber daran denken, dass Überlieferung verpflichtet.“ Später, als Sophus gegangen war, meinte sie zu Be: „Dein Freund gefällt mir. Aber sieh dich vor, er ist ein verdammt hübscher Bengel. Du bist mit deinen siebzehn gerade in dem Alter, dich schnell und heftig zu verlieben. Und so was kann eklig wehtun.“
An Schellberg dachte Be und lächelte schmerzlich. Was wusste Bea von ihr?
Beate erklärte die Malerei für Unsinn. „Sie hält dich nur von deinen Arbeiten ab. In anderthalb Jahren willst du ins Abitur steigen, da hast du meines Erachtens jede Stunde nötig.“ Be trotzte auf. „Ich glaube, du konntest bisher mit meinen Zeugnissen zufrieden sein.“ — „Du bist gross genug, um zu wissen, was du tust. Und da Bea es für richtig hält ...“ Das war ja stets ihr ausschlaggebender Satz.
So kam Sophus fast täglich ins Haus. Er zögerte die Arbeit hin, stand oft hinter der Staffelei und blickte, ohne zu malen, auf Be, die ihre Stoffe faltete und steckte. Bis sie seine Augen fühlte und rief: „Du sollst nicht so hersehen, Sophus.“ Er log: „Ich seh gar nicht dich an, sondern auf das, was du tust. Du hast Talent, Mädel.“
Zu Weihnachten war das Bild fertig. Er hatte nicht erlaubt, dass sie es während der Arbeit betrachtete. Nun stand sie davor. „Fein, Sophus. Aber du hast geschmeichelt. So hübsch bin ich nicht.“ — „Du bist hübscher, Be.“ — „Du sollst keinen Unsinn reden, verstehst du, sonst ist es aus mit unserer Freundschaft.“ Er schenkte ihr das Bild. Sie freute sich, obgleich sie nie daran gezweifelt hatte, dass er es ihr schenken würde. Einen Kuss gab sie ihm. Er zog sie an sich. Gleich machte sie sich los. „Brav sein, Sophus.“
Über das Fest fuhr er zu seinen Eltern und blieb fast den ganzen Januar fort. Briefe kamen von ihm, er hatte einen Porträtauftrag in der Nachbarschaft von Grölichberg erhalten, eine alte Dame malte er und bat nun: „Besorge mir einen Brokatstoff. Goldgrund mit Farbflecken drin. Er muss zu silbergrauem Haar und sehr frischem Teint passen und zu noch vollen Schultern. Du wirst schon das Richtige finden.“ Sie fuhr sofort in die Stadt, durchsuchte die Läden, wählte lange und war stolz, als er schrieb: „Genau das, was ich wollte. Ausgezeichnet. Ich wusste ja, dass man sich auf dich verlassen kann. Wir sollten zusammen arbeiten, dann könnte etwas aus uns werden.“ Und im nächsten Brief stand: „Ich habe Pläne, Be, grossartige Pläne. Und Sehnsucht nach dir.“
Als er zurückkam, war er erregt, besessen von seinen neuen Gedanken. „Wir machen zusammen einen Laden auf, einen Modeladen. Nicht gleich, später. Nach deinem Abitur, denn vorher lassen sie dich ja doch nicht los. Du entwirfst die Kleider. Ich zeichne die Frauen, wie sie in ihnen aussehen werden. Das wird ziehen. Wir werfen unseren Geschmack zusammen. Du musst natürlich erst auf eine Modeschule, den technischen Kram lernen. Aber da wird ein halbes Jahr genügen.“ Sie liess ihn ausreden, denn es gefiel ihr, was er sagte. Aber dann winkte sie doch ab. „Ist ja Unsinn, Sophus. So was kostet Betriebskapital. Woher sollen wir das nehmen? Bei uns ist es schon lange knapp, Beate spart, wo sie kann, das merke ich längst. Und dann: ich soll doch Medizin studieren.“ — „Hast du Neigung dazu, wirkliche Neigung?“ — „Darauf kommt es doch nicht an. Vater ist Arzt, ich werde Ärztin. So steht es fest.“ Es klang nicht sehr überzeugend, wie sie es sagte. Sie musste wieder an Schellberg denken und an das ‚So‘, an dies langgezogene, ablehnende ‚So‘, das seine Antwort gewesen, als sie ihm von ihrer Arztzukunft sprach.
Sophus war ein Starrkopf. Er liess nicht locker, nicht im Frühling, nicht im Sommer; immer wieder brachte er seinen Plan vor. Er holte sich Detta zu Hilfe, und sie war sofort auf seiner Seite. Gemeinsam fiel es ihnen nicht schwer, Be zu überzeugen, wenn sie sich auch noch nicht ganz ergab; die Scheu vor dem Willen der Mutter hielt sie von der letzten Entscheidung zurück.
Detta hing sich jetzt eng an Be. Sie nutzte ihr Wissen aus. „Diesmal muss ich das verfluchte Examen schaffen.“ Be paukte mit ihr, sah ihre Arbeiten durch. Dafür lud Detta sie auf Wochenend in ihren Wagen und oft Sophus dazu. Sie lagen am Wasser, sie schwammen. Detta und Be hatten ihr Zelt und Sophus baute sich eine Hütte aus Schilf daneben, in die er seinen Schlafsack schob. Aber bevor sie zur Ruhe gingen, lagen sie nebeneinander, sahen in den Mond oder in das Kochfeuer, das sie angezündet hatten und redeten. Sie philosophierten ins Halbdunkel hinein, wie nur Jugend philosophieren kann, die Liebe, Unendlichkeit, Gott, Welt, Vaterland, Freiheit, Macht, Willen, Treue, Hass in grossen Worten ineinandermischt, sich begeistert, sich aufwühlt, sich streitet und wieder verträgt und dabei echt und leidenschaftlich empfindet. Sie sprachen, sie glaubten an sich und ihre Worte. Oft schob sich Sophus dann dicht an Be heran, griff nach ihrer Hand, küsste ihre Fingerspitzen. Oder er bettete seinen Kopf dicht neben den ihren, dass sein blondes Haar ihr braunes berührte. Dann kam es vor, dass sie die Gesichter zueinander wandten und sich in dem unsicheren Lichte lange ansahen. In ihren Augen wurde ein Leuchten wach, sie spürten den Atem des anderen, der wärmer war als die warme Sommernacht. Sie zitterten beide. Sie liessen Detta sprechen, bemühten sich, ihr zuzuhören, aber dachten nur an sich. Leise flüsterte Sophus dann wohl: „Kleine Be“ oder „Ich hab’ dich lieb, Be.“ Be hörte es und schloss die Augen. Einmal stand Detta auf und ging bis ans Seeufer; ein Geräusch war auf dem Wasser gewesen, Fische waren gesprungen oder eine Ente war eingefallen. Sie lauschten, wie die morschen Zweige unter ihren Schuhen knackten, sie verfolgten ihre Schritte, die sich mehr und mehr entfernten. Sophus richtete sich ein wenig auf und beugte sich über Be, er senkte langsam seinen Mund zu ihren Lippen. Sie schlang die Arme um seinen Hals und zog ihn zu sich. Sie küssten sich. Aber schon machte sich Be wieder frei. „Wo bist du denn, Detta?“ rief sie laut. — Als sie am nächsten Morgen in den See hinausschwammen, sagte sie: „Das darfst du nicht wieder tun, Sophus.“ Und als er etwas erwidern wollte, schnitt sie sein erstes Wort ab: „Nein — nein. Es ist nicht gut. Nicht für mich. Nicht für dich.“
Читать дальше