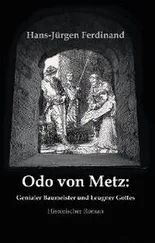In diesem Sommer war sie nur wenige Tage beim Vater; Detta sollte mit ihrem Wagen kommen und sie abholen. Sie wollten gemeinsam durchs Frankenland fahren. Be hatte sich das gewünscht: Rothenburg und Amorbach, Bamberg, Nürnberg, Bayreuth, Städte und Flecken, das Maintal und die Berge, Schlösser und Kirchen, Burgen und Museen. Und Detta wollte zum Schluss auf die Wasserkuppe, wenn die Flugtage in der Rhön begannen. Schellberg war nicht auf Hochfried. „Er hat sich erst zum Herbst angesagt“, berichtete Doktor Bürgler, als Be fragte. Sie lief nicht durch den Wald, sie blieb im Haus, war ruhiger als früher. Der Vater merkte es. „Drückt dich was, Mädel?“ — „Ja, Vater, die Zukunft. Ostern mache ich mein Abitur.“ Er nahm ihren Arm, führte sie in sein Arbeitszimmer, setzte sich ihr gegenüber. „Hast du Angst vorm Examen?“ Sie lächelte. „Das nicht.“ Gleich wurde ihr Ausdruck wieder ernst. „Aber hinterher — ich möchte nicht Medizin studieren.“ — „Was dann?“ — „Überhaupt nicht studieren. Ich will was Praktisches anfangen. Arzt — Ärztin: das ist mir im Grunde fremd. Wenn ich irgend etwas dafür in mir spürte, würde ich doch hier schon ins Labor laufen, würde dich ausgepresst haben mit Fragen. Nichts fühl’ ich, nichts. Ich könnte mich dazu zwingen. Aber das hat doch keinen Sinn.“ Er unterbrach sie nicht. Sie wird mir schon sagen, was sie will, dachte er. Da fuhr sie auch schon fort: „Lernen, was zum Studium erforderlich — das könnte ich natürlich. Das macht mir keine Sorge. Ich kenne meinen Kopf. Aber ein Arzt ohne das Gefühl innerer Berufung, das wird doch nichts Ordentliches. Und nun gar eine Ärztin. Es sitzen genug Ärzte ohne Brot da, ohne Praxis, aber mit Schulden für ihre Instrumente, für ihre Einrichtung. Soll ich ihre Zahl vermehren? Soll ich ihnen als Frau Konkurrenz machen?“ Und nun entwickelte sie ihm Sophus’ Plan, ohne dessen Namen zu nennen: Modeschule, ein halbes Jahr Arbeit in einem Geschäft und dann versuchen, sich selbständig zu machen. Sie sprach sich in Eifer. Er sah sie an: wie sie Beate gleichen kann. — Beate, als sie noch jung war — damals, als sie verlobt waren, als sie heirateten, vorm Kriege. Es war ihm wie etwas Entschwundenes, Verlorenes. „Hast du schon mit deiner Mutter darüber gesprochen?“ — „Das ist es ja, Vater, davor hab’ ich Angst.“ Nun sah sie ihn an, hoffte, dass er ihr eine Brücke bauen würde; aber es erfolgte nichts. So raffte sie sich noch einmal auf: „Könntest du nicht an Beate schreiben?“ — „Ich an deine Mutter? — Nein, Kind, das geht nicht.“ — Heftig wehrte er sich. „Nein — nein; wir verkehren seit Jahren doch nur durch unsere Anwälte.“ — „Auch, wenn es sich um mich handelt?“ — „Auch dann.“ Er sagte die zwei Worte stockend, er fühlte wohl, dass ein Vorwurf, ein berechtigter Vorwurf in ihrer Frage lag.
Sie wagte nicht, gleich weiter zu reden, zu bohren. Zum erstenmal empfand sie die tiefe Kluft zwischen den Eltern und war beschämt, dass sie noch nie vorher über diese zerschlagene Ehe nachgedacht hatte. Eben hatte sie vom Vater gefordert, dass er ihr den Weg zur Mutter erleichtern sollte, und nun musste sie sich fragen: hätte ich nicht längst versuchen sollen, Bindeglied zwischen diesen beiden Menschen zu werden? ich, ihr Kind? „Warum bist du damals von Mutter fortgegangen?“ Ganz langsam, ganz leise sprach sie den Satz.
Er stand auf, jäh; mit schnellen Schritten ging er zum Fenster, wandte ihr den Rücken zu, sah hinein in das Dunkel der Schwarzwaldtannen.
Da war sie auch schon neben ihm, legte ihren Arm um seine Schulter, lehnte sich an ihn. „Ich habe dir weh getan eben, Vater, verzeih. Aber musste diese Frage nicht einmal kommen? Was weiss ich denn von euch beiden?“
„Ich bin nicht von deiner Mutter fortgegangen, Be. Sie hat mich fortgetrieben.“
Noch näher trat sie an ihn heran, er sollte doch fühlen, rein körperlich fühlen, dass sie zu ihm gehörte. „Ihr liebtet euch doch?“
Er schob sie von sich, sanft, aber doch so willensstark, dass sie dem Druck nachgab. Müde glitt ihr Arm herab.
„Lass mich allein, Be, bitte. Es hat keinen Sinn, über diese Dinge zu sprechen. Später vielleicht einmal ... wenn du grösser bist, älter ... dann wirst du mich wohl verstehen ... uns beide.“
„Liebst du denn eine andere Frau?“
Er sah: sie erschrak über ihre eigene Frage, sie wurde rot.
„Nein, kleine Be.“
Nun hatte er sogar ein Lächeln, ein fernes, müdes Lächeln.
Zur Tür brachte er sie. „Zerbrich dir nicht den Kopf. Mache dir keine unnötigen Gedanken. Deine Mutter hat dich lieb, und Ich habe dich lieb. Lass es dir genug sein.“ — — —
Am nächsten Tag war Detta da mit ihrem Wagen.
„Nanu, Be, wie siehst du denn aus? Als ob du die ganze Nacht geheult hättest.“
Be nickte trübe. „Hab’ ich auch, Detta.“
Und dann kam die Abfahrt von Hochfried. Personal stand am Auto, Schwestern, Kurgäste. Be fühlte, dass dem Vater der Abschied schwer wurde. „Wenn du Fragen hast wegen deiner Zukunft, wende dich an Schellberg“, sagte er. Und Be dachte: Schellberg ... ist da in mir nicht auch etwas verschüttet wie zwischen Beate und Vater?
Der Wagen rollte davon.
Sie sah sich um. Vater winkte. Sie musste sich zusammennehmen, um nicht wieder aufzuweinen. Detta hätte sie nicht verstanden, hätte gescholten mit ihren lauten Worten: Schlappstiefel — Heulliese.
Und dann war Rothenburg da und Nürnberg und dann die bewaldeten Täler der fränkischen Schweiz mit ihren Burgen und begrünten Felsecken. Und Bayreuth mit den Wagner-Erinnerungen und Bamberg mit dem Reiter im Dom. Die Sommersonne schien, und das Bügeleisen des Lebens glättete die Falten und löschte das Erinnern an die wehen Minuten. Auf der Wasserkuppe setzte sich Detta in ein Segelflugzeug, und Be zitterte um die Freundin, als eine Bö unter die Tragflächen griff und der kleine Apparat abzugleiten drohte.
Die Gegenwart war stärker.
Und sie blieb es in Berlin.
Das letzte halbe Jahr vor dem Abitur forderte wirkliche Arbeit von Be, doppelte Arbeit, weil sie sich für Detta mitverantwortlich fühlte, die immer ausbrechen wollte: zum Sport, ins Wochenende, zu den Freunden. Be hielt sie an der Stange, sie schob auch Sophus zur Seite. „Störe uns jetzt nicht.“
Die Zeit verging wie im Fluge. Im März bestanden Be und Detta die Reifeprüfung.
Die Feigheit, die verruchte Feigheit. Beate schalt sich in schlaflosen Nächten, dass sie diese Feigheit nicht überwinden konnte, um endlich, endlich Bea ehrlich zu beichten, wie es um die Trümmer ihrer Vermögen bestellt war. In den Nächten, wenn die Angst sie stark und stärker überfiel, wenn das Zukunftsbild im Halbwachsein trüb und trüber wurde, fasste sie die stärksten Entschlüsse: das Personal entlassen, das Haus verkaufen, in eine Drei- oder Bierzimmerwohnung ziehen, am besten von Berlin fort in eine Kleinstadt. Es musste etwas geschehen, denn die Schulden wuchsen. Sie hatte schon gelernt, das Finanzamt um Stundung zu bitten, die Lieferanten zu vertrösten; aber sie hatte auch erkannt, dass das nur ein Hinausschieben bedeutete; zuletzt musste sie doch auf die Bank gehen und Papiere verkaufen. Und zwar immer für Dinge, von denen letzten Endes niemand etwas hatte: Steuern für das Haus, Gebühren für den Speicher in Kassel, auf dem eigentlich nur unnötiges Gerümpel stand, an das höchstens einmal Bea dachte. „Weisst du, Beate, die schöne Base, die uns der General von Rechberg zur Hochzeit schenkte — dein Vater hatte sie so gern“ — oder: „der grosse Bücherschrank, der auf der Diele stand — entsinnst du dich noch, Beate?“ Aber dass Bea eben immer wieder von diesen Stücken sprach, das war der Stachel. Durfte Beate sie fortgeben, durfte sie die Mutter um diesen Erinnerungsbesitz berauben?
Читать дальше