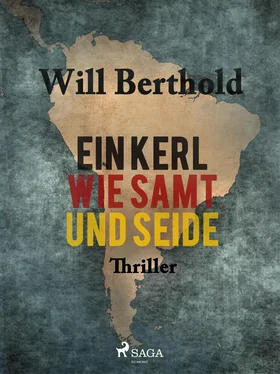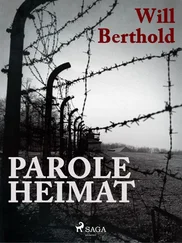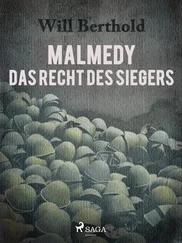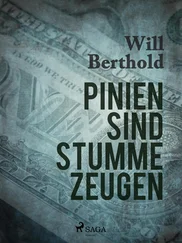Captain Spoonwood, der Maletta nach umständlichen Sicherheits-Checks und Rückfragen im Clearing-Office empfing, ließ auf den ersten Blick nicht erkennen, zu welcher Kategorie er gehörte. Ein Mann, dem sein Schicksal wie ins Gesicht gestempelt schien: Flucht aus Galizien nach Deutschland. Flucht aus Deutschland in die Staaten. Spoonwood, offensichtlich ein geborener Löffelholz – österreichische Offiziere hatten sich vor dem Ersten Weltkrieg ein Vergnügen daraus gemacht, die jüdische Bevölkerung mit absonderlichen Nachnamen zu benennen –, sprach klares Deutsch ohne englische oder jiddische Wortbrokken. Er wirkte viel zu dienstlich, um freundlich oder unfreundlich zu erscheinen.
»Nehmen Sie Platz, Herr Maletta«, sagte er. »Ich denke, wir werden nicht allzulange brauchen.« Spoonwood glättete den auf seinem Schreibtisch liegenden Fragebogen des Besuchers. Er sah Maletta an, als blickte er durch ihn hindurch: »Ich habe Captain Freetown gebeten, Sie zu mir zu schicken«, erklärte er. »Ich bin schon seit einiger Zeit gespannt auf Sie und –«
»Warum, Captain?« unterbrach ihn Maletta.
»Ich kenne Teile Ihrer Vorgeschichte aus deutschen Akten.« Erstmals zeigte sich in seinem Gesicht der Ansatz eines feinen Lächelns. »Marc könnte daraus spielend ein spannendes Drehbuch für einen Hollywood-Film fertigen.«
»Vorläufig liegt das Copyright noch bei mir«, erwiderte der Besucher gereizt.
»Sure«, räumte der Clearing-Officer ein, »jedenfalls bringt ein Mann wie Sie etwas Würze in diese fad-braune Einheitssauce.« Er griff nach dem Fragebogen und schob ihn dann, als hätte er es sich anders überlegt, wieder beiseite: »Marc sagte mir, daß Sie nach einer gewissen Lisa Schöller suchen.«
Der Examinierte nickte.
»Wir haben sie gefunden«, fuhr der Offizier mit den Ohren, die so weit abstanden, daß man an ihnen Kleiderbügel aufhängen könnte, fort: »Sie wissen, daß es sich dabei um die Tochter eines hohen Nazibonzen handelt.«
»Ich weiß«, versetzte Maletta. Ohne Schärfe fügte er hinzu: »Ich weiß aber auch, daß in Deutschland die Zeit der Sippenhaftung vorbei ist, Sir. Isn’t it?«
»Past and gone«, bestätigte der Captain. In seinem Gesicht, das so häßlich war, daß es auf den Besucher schon wieder faszinierend wirkte, verstärkte sich das dünne Lächeln.
»Wo ist Lisa jetzt?« fragte der Clearing-Kandidat.
»Darüber reden wir später«, wies ihn Spoonwood zurecht. »Wenn wir mit der Clearing-Prozedur fertig sind. Sie sind also in Berlin geboren, 35 Jahre alt. Sie arbeiten zur Zeit als Kraftfahrer beim Theater-Offizier der Militär-Regierung. Ich nehme nicht an, daß das der Abschluß Ihrer beruflichen Karriere ist.«
»Ich auch nicht«, bestätigte der Besucher. »Nachdem Sie meine Akten durchgesehen haben, wissen Sie ja, daß ich Pilot, Oberleutnant der Luftwaffe, Fluglehrer, eine Art Entertainer und zuletzt Todeskandidat mit ein paar Hinrichtungsterminen war.«
Es ging auf 17 Uhr, und es sah nicht so aus, als würde die Unterredung schnell vor sich gehen, obwohl es der Captain gesagt hatte und der Abstand zwischen einem US-Besatzungs-Offizier und einem deutschen Fragebogen-Kandidaten nicht mehr ganz so spürbar war.
Die Hitzewelle hatte angehalten. Die Reifen der Autos blieben in den aufgeweichten Teerdecken der Straßen stecken. Die anhaltende Trockenheit riß die Feldwege auf, auf dem Land betete man in Bittgottesdiensten um Regen. Die Sonne brannte vom Himmel und verwandelte die staubige Erde in einen glühenden Rost.
Die ersten Gäste der Garten-Party in Schleißheim vor München hatten ihre Uniformjacken ausgezogen und waren in den Schatten geflüchtet. Die Ordonnanzen, große, ausgesucht attraktive Negersoldaten, fachmännisch dirigiert von Charly, dem aus der Gaststätte Pulverturmausgeliehenen Kellner, kamen beim Servieren der Getränke kaum nach, und so weilten die ersten Gäste bereits in einem hochprozentigen Nirwana, noch ehe die letzten angekommen waren.
Bud C. Williams aus Washington D.C. feierte seine Beförderung zum Colonel bei gleichzeitiger Ernennung zum Chef des Alabama- und Indiana-Depots ausgiebig; gestern bei der Amtseinführung durch General Patton im Kreise höherer Chargen, heute umgeben von Bekannten und Freunden des Military Governments of Munich auf einem Gartenfest. Wie immer erging dazu keine persönliche Einladung; es war eine Open-House-Party, zu der jeder erscheinen konnte, der den Gastgeber kannte. Spezielle Aufforderungen erhielten nur Teilnehmer des ›Intimate-Circle‹, der sich meistens erst dann zusammenfand, wenn die anderen bereits gegangen waren.
Die Stimmung war von Anfang an ausgezeichnet. Auf dem Barbecue wurden Steaks und Spareribs vorbereitet und zwischendurch immer wieder erlesene Titbits angeboten. Ganz zuletzt würde dann der Hausherr nur wenige Teilnehmer zu noch ganz anderen Leckerbissen nach oben bitten.
Mit hochrotem Kopf und einer für seine kurzen Beine überraschenden Geschwindigkeit fegte Stubby durch Haus und Garten, als trüge er Rollschuhe an den Füßen. Obwohl am gestrigen Tag mehr offiziell gefeiert wurde, war er gegen Mittag mit einem kapitalen Hangover erwacht, hatte seinen Kater mit einer Prärie-Oyster und drei Bourbons bekämpft und hinterher, um rasch wieder in Fahrt zu kommen, zwei Aufputschpillen geschluckt. Schließlich war er der Gastgeber und verantwortlich für Speisen und Getränke, für Naschwerk, Zigaretten, Nylonstrümpfe und für die kleinen Geschenke, die die Buhlschaft erhalten. Die Girls für den vorgerückten Abend besorgten seine Freunde, denen ihre Dienststellen Kontakte zu blonden oder schwarzen, langbeinigen oder prallbusigen, willigen oder kratzbürstigen Geschöpfen erlaubte; sie arbeiteten als Dolmetscherinnen oder Sekretärinnen, und falls sie wirklich ›Fräuleins‹ waren, dann jedenfalls von der feinsten Sorte.
»Don’t be a party-spoil«, sagte Stubby zu Peaboddy und Freetown, als er bemerkte, daß sich die beiden Amerikaner auf französisch verabschieden wollten. »Ihr könnt doch nicht jetzt schon gehen, wo’s gleich lustig wird.«
»We have still a lot to do, Bud«, entschuldigte sich der Colonel. »Sorry. And thanks again.«
Die beiden ließen sich nicht aufhalten und verließen als erste vorzeitig die Party, wofür sie sich morgen beglückwünschen sollten.
Major Silversmith lag unter einem Kastanienbaum und trank Eiswasser; nur Eiswasser; er wollte sich seine Fitneß bewahren für die Hurly-Burly-Session in der Beletage, die er beim letzten Mal ›Tabunesia‹ betitelt hatte. Er sah auf die Uhr – er mußte sich noch mindestens drei Stunden gedulden und mit Icewater anheizen.
Die Zusammensetzung der Gäste – fast ausschließlich Offiziere – spiegelte die Oligarchie der Besatzungsmacht wider. Ein Männer-Club. Wo immer GIs, Unteroffiziere oder Offiziere zur Geselligkeit zusammenkamen, waren sie unter sich und – wollten es nicht bleiben. Der Männerüberschuß war hier so kraß wie damals bei ihren kalifornischen Vorfahren, denen 1850 ein Dreimaster mit 900 Luxusgeschöpfen aus den feinsten Etablissements von London, Paris, Amsterdam und Marseille angekündigt worden war. Die Männer von San Francisco standen aufgeregt an der Mole, schwenkten die Hüte und reckten die Hälse, als unter Trompetenstößen die ersehnte Fracht ausgeladen wurde; es waren keine 900 Edel-Kokotten, sondern nur 60 strapazierte Straßenmädchen, die alle nach 14 Tagen verheiratet waren, oft zu Stammüttern angesehener Familien avancierend.
Mit der Heiratserlaubnis mußten die GIs in Deutschland vorläufig noch warten. Der britische Feldmarschall Montgomery hatte bis jetzt nur das Verbrüderungs-Verbot mit deutschen Kindern etwas gelockert, aber die Soldaten – ob britische oder amerikanische – wußten, wie sie das ›Cherchez-la femme‹ hinter sich brächten: In ihrem Jargon hieß es »Hello, Blondie«.
Читать дальше